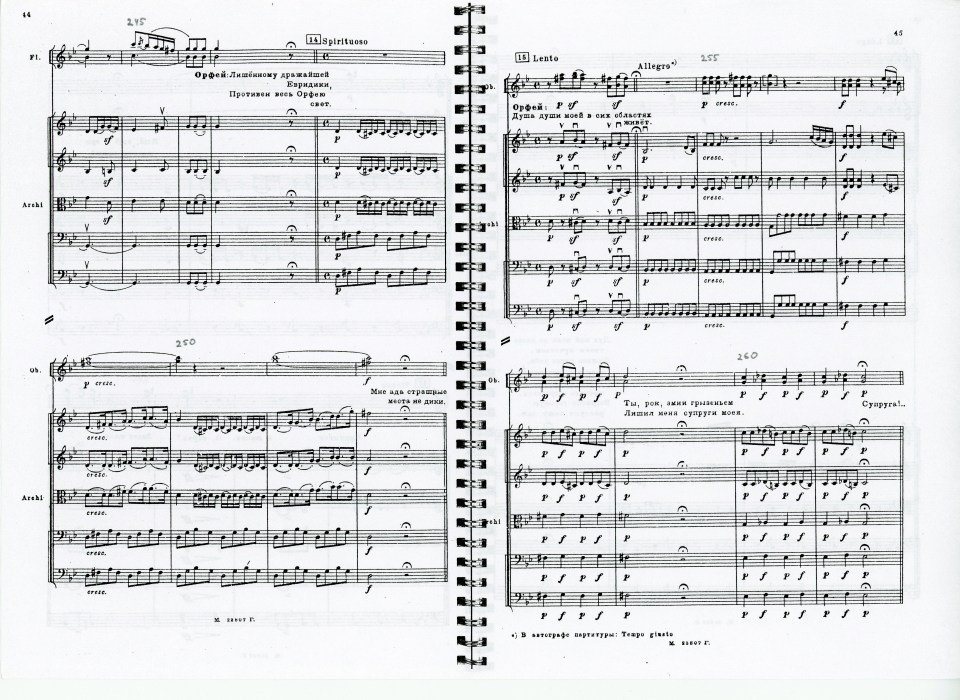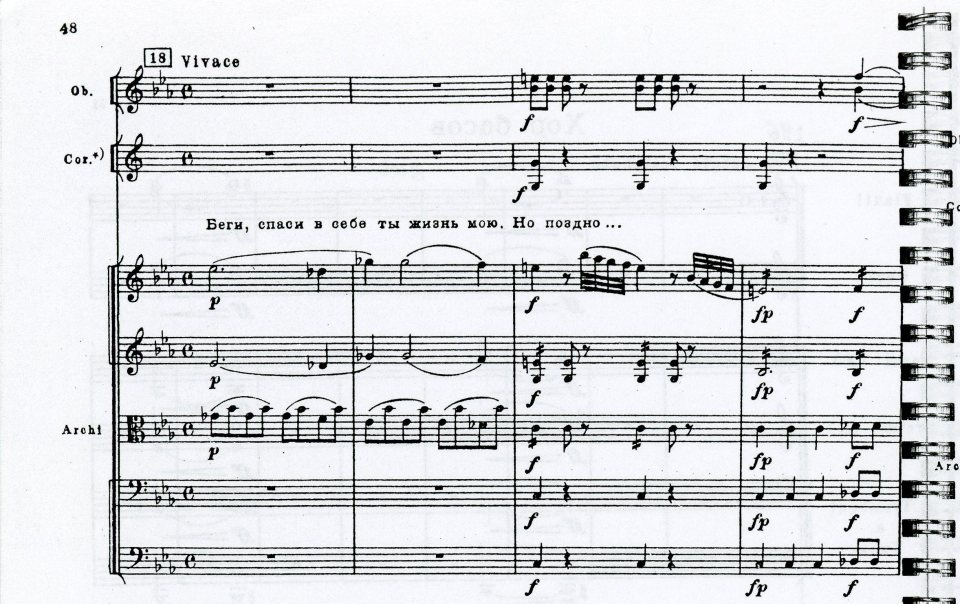Startseite » 2014
Archiv für das Jahr 2014
Interview von Marek Dippold mit Karl Ottomar Treibmann
Am 1. Juni 2012 hat Marek Dippold im Rahmen seiner Untersuchungen zur Fünften Sinfonie von Karl Ottomar Treibmann ein Interview mit dem Komponisten geführt. Die Studie wird im Herbst 2014 in den Schriften online: Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« erscheinen. Das Interview können Sie schon heute lesen.
Marek Dippold: Ihre Biographin Ulrike Liedtke bezeichnet Ihre Fünfte Sinfonie als »Aufbruch-Sinfonie«. Sie haben erste Skizzen bereits 1983 angefertigt und sie ab Mitte 1986 bis März 1988 vollendet. Woher kam ihre Motivation, in dieser Zeit des Stillstands in der DDR solch einen Aufbruch musikalisch umzusetzen?
Karl Ottomar Treibmann: Ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Dinge: Der Stillstand, der hier herrschte, hat eigentlich nichts mit dem Stillstand in der Musik zu tun. Musik ist ein bewegtes Medium. Musik hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Natürlich können Sie Musik komponieren, die ganz langsam ist und sich nicht bewegt, dann könnte man sagen: Das hat etwas mit Stillstand zu tun. Aber ich bin in meinen Arbeiten immer davon ausgegangen, dass ich an bestimmten tradierten Gattungen – Sonate, Sinfonie, Oper – mich orientiert habe, die für mich vorbildhaft als Gattungen gewirkt haben. Und wenn ich eine Sinfonie schreibe, war für mich klar: Hier müssen Kontraste entworfen werden. Das ist in all meinen Stücken so, seit meiner Ersten Sinfonie. Materialkontraste werfen Fragestellungen auf, wenn man einen Satz mit dem anderen vergleicht. So kommt beispielsweise auch nach dem Chaos in der Mitte des zweiten Satzes meiner Consort-Sonate ein Kontrastprogramm. Diese Kontrastprogramme sind für die Kommunikation sehr wichtig und ich habe aus dieser Vorstellung meine Musik entwickelt.
Über die Fünfte habe ich lange nachgedacht, und Mitte der 1980er Jahre habe ich von Walter Markov, dem großen Leipziger Historiker, die beim Reclam-Verlag erschienenen Dokumente zur Französischen Revolution gelesen. Diese haben mich emotional bewegt. Was da los war: Wenn Sie das in den Geschichtsbüchern lesen, sehen Sie es so, aber wenn Sie die Original-Dokumente lesen, dann kann das schon sehr berührend sein, weil das dann noch unmittelbar wirkt. Ja, ich weiß auch nicht, jedenfalls passierte es dann, als ich mit dem Stück gearbeitet habe, dass da die Marseillaise im ersten Satz rhythmisch anklingt und im Schluss, in der Dreiklangsbildung der letzten Töne auch zitiert wird. Das passte in mein sinfonisches Konzept.
Dippold: Sie erwähnten die Schriften von Walter Markov. Inwieweit sahen Sie in den 1980er Jahren Parallelen zum Vorfeld der französischen Revolution?
Treibmann: Ich will mal so sagen: Wenn Sie hier gelebt haben und gemerkt haben, was hier los war und sind von einer bestimmten Mentalität geprägt, dann musste man ja irgendwas tun. Man wusste, so geht es nicht weiter. Deshalb drängt das und drängt das und drängt das. Das kann man im ersten Satz bemerken und das kann man im Schlusssatz bemerken. Nun musste aber auch ein Ruhepunkt her. Und so ist die Meditation entstanden. Die war allerdings schon vorher angedacht. Dazu gibt es zwei Vorfassungen: Ich habe eine Schauspielmusik gemacht nach einem Stück von Volker Braun: Die Schmitten. Da wurde an einer Stelle Lyrik gebraucht. Ich habe da ein Ensemble zusammengestellt: Cello, Vibraphon, Oboe. Dort ist diese Struktur vorgeahnt. Und dann habe ich zum 60. Geburtstag meines Freundes Alfred Mörstedt Girlanden für einen Freund komponiert. Dieses Stück schien mir geeignet, in eine große Form transformiert zu werden. Da kommt natürlich etwas anderes zustande, die Dinge wachsen sich aus. Ich habe dann von der systematischen Seite her noch einmal die Tonfolge verbessert, die Struktur strenger, konsequenter, in meinem Sinne entwickelt und dann diesen Streicherfächer darüber gelegt, der sich von oben nach unten schiebt. Die Stimmung ist von einer zarten Situation aus dem Schauspiel abgeleitet.
Dippold: Sie waren als Universitätsprofessor und Bezirksvorsitzender des Komponistenverbandes sowohl mit Studenten als auch mit Ihren Kollegen – Künstlern und Wissenschaftlern – in regem Austausch. Wie sehr wurde der Wunsch nach gesellschaftlichem Wandel, Freiheit usw. bis 1988 schon thematisiert?
Treibmann: Wissen Sie, ich habe in den 70er Jahren meine Oper Der Preis geschrieben. Da geht es nur um die Verantwortung des Einzelnen. Und das ist eigentlich immer mein Anliegen. Tja, im Austausch mit Kollegen oder auch im Komponistenverband spielte das keine Rolle. Über die Werke, die damals komponiert worden sind, haben wir natürlich gesprochen. Aber es waren im Grunde keine politischen Diskussionen. Das hat sich dort wenig abgespielt. Aber wir haben im engeren Freundeskreis sehr intensiv über diese Stagnation nachgedacht.
Es gab in der Universität ein strenges Reglement. Und da gab es jedes Jahr diese Einführungswochen. Zum Glück hatte ich eine künstlerische Professur, die nannte sich »Professur mit künstlerischer Lehrtätigkeit«. Da brauchte ich mit Vorlesungen nie in den sauren Apfel beißen. Zu Vorlesungen zu den jeweiligen Parteitagen waren die wissenschaftlichen Professoren aber natürlich angehalten, das hat die meisten auch nicht begeistert. Im Tonsatzunterricht haben wir immer unsere Arbeit gemacht. Ich weiß noch 1989, als meine beiden Sinfonien uraufgeführt worden sind, da habe ich meinen Studenten diese vorgespielt.
Dippold: In den Werken vor der Fünften Sinfonie haben Sie vor allem Widersprüche und Probleme aus dieser Zeit der Stagnation heraus thematisiert. Meines Erachtens nach ist die Fünfte Sinfonie die erste, in der Sie sagen: Hier muss man etwas tun, hier muss es zu einem Aufbruch kommen. War das damals ein neuer Aspekt in ihrem kompositorischen Schaffen?
Treibmann: Das ist möglich. Ich weiß nicht. Das kann ich schlecht beurteilen. Die Chorsinfonie Der Frieden ist ein hartes Stück. Dort gibt es Trümmer, zuletzt bleibt übrig: »Unterm Sternenzelt muss ein großer Frieden wohnen.« Oder »Tu was!«, »Tu was für den Frieden!« wird dort geschrien. Ich würde diese Dinge alle im Fluss sehen. Der erste Satz der Ersten Sinfonie: nur eine Pulsation, dann gibt es einen chaotischen Satz, dann Lyrik: Die Musik braucht ja eine Balance. Oder die Zweite Sinfonie, sie endet mit einem riesigen Hymnus und vorher ein Satz, wo alles zusammenbricht. Was zu tun war, hat dann die Zeit gebracht. Das Leben hat uns immer wieder Konflikte vor Augen geführt. Eigentlich war immer etwas zu tun. Es waren konfliktreiche Zeiten. Wir wollten hier ja auch ein normales Leben führen. Deshalb kam es mir nicht in den Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, bis sich was ändert. Mit meinen Stücken wollte ich Akzente setzten, Denkanstöße, Hoffnung vermitteln. Wenn man sich künstlerisch betätigt, ist man natürlich immer in der Situation, dass man etwas zu Papier bringt. Kunst vermittelt Empfindungen, die nicht nur zeitgebunden waren. Wissen Sie, das ist alles schwierig, die DDR ist lange vorbei. So ging das damals nicht weiter. Aber wie das weiter gehen würde, da waren sogar die Politiker überrascht.
Dippold: Die Bezeichnung Ihres dritten Satzes, »Dithyrambus«, konzipierten Sie als Geste gegenüber Karl Amadeus Hartmann und dessen Achter Sinfonie. Dort jedoch erscheint mir der II. Teil, der mit »Dithyrambus« überschrieben ist, wesentlich zwiegespaltener und komplexer in der Anlage als Ihr dritter Satz. Hartmann entfernt sich meines Erachtens nach vom dithyrambischen Charakter bis zu einem gewissen Grad.
Treibmann: Das ist möglich. Das war halt seine Art, und dies ist meine Art. Das kann man schlecht vergleichen. Der expressive Zugriff Hartmanns hat mich schon immer fasziniert. Was soll ich da weiter sagen…
Dippold: Ich meine, ob Sie da irgendeinen Ausgangspunkt hatten, den Sie etwas als Keimzelle aus Hartmanns Sinfonik genommen haben?
Treibmann: Nein, überhaupt nicht. Ich nehme niemals Anleihen von irgendwo her. Ich wollte es nur als eine Bewunderung für diesen großen Meister.
Dippold: Sie hatten vorhin bereits den Maler Alfred Mörstedt erwähnt. Darüber hinaus zählten Sie den Maler Wolfgang Mattheuer zu Ihrem Freundeskreis und auch Sie selbst sind künstlerisch tätig. Sind Sie Synästhet? Hören Sie Farben?
Treibmann: Wenn ich komponiere und die Partitur schreibe, höre ich natürlich Klänge.
Dippold: Ich meine darüber hinaus gehend, wie Kandinksy und Schönberg etwa Farben eines Bildes gehört haben. Diese nannten ihre Werke »Farbsinfonien«, Sie bezeichnen umgekehrt ihre Kompositionsmittel wie zum Beispiel die terzgeschichtete Klangmassenverschiebungen im ersten Satz der Fünften als »Klangbilder«.
Treibmann: Nein, Farben hören in dem Sinne kann ich nicht. – Ich versuche für jeden Satz eine eigene Klangstruktur zu entwerfen. Wenn Sie Schönberg sagen und das Bläserquintett nehmen, da haben Sie nur ein Klangbild. Ich möchte die Sätze klar voneinander absetzen. Der Begriff »Klangbild« weckt vielleicht falsche Assoziationen. Klangraum ist vielleicht besser. Auf der einen Seite sind es diese Terztürme, dann Diatonik, auf der anderen Seite diese Zwölftonreihe, aus denen Klangräume entwickelt werden.
Dippold: Sie meinen also mit »Klangbild« oder »Klangraum«: Für jeden Satz haben Sie eine Klangstruktur, die so einzigartig ist, dass man, wenn man einen Teil daraus hört – und ein guter Hörer ist –, zum Schluss kommt: Das muss zu diesem Satz gehören, weil es nur diesem Klangbild entspricht.
Treibmann: Ja, das würde ich unterstützen. Das hat auch noch eine psychologische Überlegung. Der Hörer will sich ja in irgendeinem Klima orientieren können. Wenn Sie nur graue Masse komponieren, dann ist die Orientierung sehr schnell verloren. Aber durch diese Klangorientierung, auf denen dann die Impulsationen, die Struktur, die Dramaturgie sich entwickelt, dann kann der Hörer einsteigen. Denn es ist ja wirklich das Problem der zeitgenössischen Musik, dass sie keiner hören will, es fehlt die harmonische Heimat, die schon bei Reger in die Binsen geht, nehmen Sie sein drittes Streichquartett op. 74, da gibt es knallharte Dinge. Aber sowohl er als auch Richard Strauss haben ja immer diese tonale Bindung gehabt. Und heute muss man sich überlegen, wie man diese Bindung auf anderem Wege herstellt. Ich will eine Musik schreiben, weil ich kommunizieren will. Da kann ich also nicht nur auf Dissonanzen nach Gutdünken setzen. Zur Klangstruktur des ersten Satzes bin ich angeregt worden vom Adagio aus Mahlers Zehnter Sinfonie. Dort gibt es am Ende den großen neuntönigen Akkord. Der ist eiskalt. Und im Grunde ist es dieser Akkord, bloß, dass ich ihn systematisiert habe und er sich nun bewegt. Und damit klingt das dann ganz mild. Dem Klangcharakter ist also durch diese Addition, durch diese Bewegung die Kälte genommen. Dann hatte ich mir gedacht: das könnte funktionieren. Im „Idiot“ kommt das schon vorher vor, auch wenn es etwas anders funktioniert als in der Fünften. Deshalb: Klangbilder zur Orientierung. Ich habe immer schon improvisiert, als Kind nach Reger mit den entsprechenden Harmonien und dem verminderten Akkord, der überall hin wandern kann.
Dippold: Sie sind ausgebildet worden unter anderem bei Fritz Geißler und Carlernst Ortwein, genannt Conny Odd, der ja auch Popularmusik gemacht hat. Inwieweit wurde es damals, bei Ihrer Ausbildung, besprochen, diese Problematik, ohne echte tonale Bindung eine Klammer für den Hörer zu finden?
Treibmann: Das hat keine Rolle gespielt. Conny Odd war ein phantastischer Instrumentator und Filmkomponist. Und da gab er eine Szene vor und wir haben mit der Stoppuhr gesessen und eine Szene komponiert. Oder wir haben Čajkovskijs Jahreszeiten für Orchester ausgesetzt. Und bei Geißler hatten wir ja – das war bedeutend – Zwölftontechnik gemacht. Das haben einige Alte damals gemacht: Er oder auch Arnold Matz, der Solobratscher des Gewandhausorchesters, ein sehr interessanter Komponist, die haben die Zwölftontechnik so verwendet, dass sie nicht nachzählbar ist, also verschleiert.
Dippold: Also nicht so reduziert und verdichtet wie bei Schönberg oder gar Webern.
Treibmann: Sie können ja eine Reihe so bauen und so bauen. Das war schon eine Kritik an den Zuständen, denn damals war das ja anrüchig, das war ja Sünde. Das war aber auch das spannende. Geißlers Zweite oder Dritte Sinfonie, das sind große, expressive Stücke, die durchaus einen Klangcharakter haben so wie bei Hartmann. Geißler hat später eine Wendung zum Populären gemacht, sagen wir, indem er sich mehr dem konservativen Erbe zuwandte. Oder auch Penderecki, der war so gut, und dann macht er solche Sachen, plötzlich bekommt das so eine für mich nicht überzeugende Diktion, wenn dann Stille Nacht vorkommt, wo es nicht hingehört. Ich bin deshalb zu anderen Formen gekommen. Ich dachte eben: man kann nicht nach dem ›Man-nehme-Rezept‹ arbeiten, weil man kommunizieren will. Der Kommunikationswille ist ja bei Geißler und Penderecki da. Für mich war der systematische Aspekt bedeutend. Dass ich also über klangsystemastisch entwickelte Klangbilder, die miteinander kontrastieren, kommunikativ sein kann, ohne, dass jemand sagt, das klingt ja wie Richard Strauss. Also so was kommt ja sonst vor, da sind Sie schnell dort gelandet, wenn Sie nicht systematisch vorgehen. Es ist schwer zu komponieren, wenn man sich nicht von Vorbildern lösen kann. Hartmann, Henze oder auch Lutosławski waren für mich immer Vorbilder, aber nicht, indem ich sie nachmache, sondern in ihrer Haltung.
Dippold: Herr Treibmann, vielen Dank für das Gespräch.
Kateryna Schöning: Das Melodram in Russland im ausgehenden 18. Jahrhundert
Das Melodram in Russland im ausgehenden 18. Jahrhundert
Giuseppe Sartis Euripides’ Alkestis (1790)
und Evstignej I. Fomins Orfeo (1791/92)
Dr. Kateryna Schöning (HMT Leipzig)
Sofern nicht anders vermerkt, stammen alle Übersetzungen von der Verfasserin.
Untersuchungen zur Geschichte des Melodrams in Russland bilden bis heute ein Desiderat sowohl in der russischen als auch in der internationalen Forschung zur Geschichte dieses Genres. Die russische Musikwissenschaft begann eine gründliche Beschäftigung mit der Musiktheatergeschichte vor 1800 erst in den 1920er Jahren. Allgemeine Aufmerksamkeit gewann vorrangig Evstignej Ipat’evič Fomin / Евстигней Ипатьевич Фомин (1761–1800), der »eine neue russische Oper« geschaffen habe.[1] Zunächst versuchte die Forschung jedoch die lückenhafte Kenntnis seiner Biographie zu erweitern und die umstrittene Autorschaft mehrerer Werke zu diskutieren (Finagin 1927, Findeisen 1928 und Rabinovič 1948).[2] Erheblicher Quellenmangel durchkreuzte Untersuchungen zu gattungsstilistischen Fragen. Was die Spezifika des Melodrams in Russland ausmachte, kam nicht zur Diskussion. Fomins Orfeo als ein Melodram zu bezeichnen, wagten nicht einmal alle Wissenschaftler. Finagin beispielsweise bestimmte Orfeo als eine Oper und zugleich als ein Melodram im »hohen Stil«: »In Orfeo sehen wir den erfolgreichen Versuch, eine ernste Musik in der Art Glucks zu schreiben«.[3] Nach 1945 trug die staatlich geförderte Aktion zur Entwicklung des nationalen Selbstbewusstseins und zur Pflege der eigenen Kultur zur Wiederbelebung des Interesses an Fomin bei. Eingebettet in eine Reihe historischer Konzerte, erlebte Fomins Orfeo in Moskau im Jahre 1947 seine sowjetische Erstaufführung.[4]

Евстигней Ипатович Фомин — «Евстигней Ипатович Фомин» участника неизвестен – собственная работа Lis23852385. Под лицензией Public domain с сайта Викисклада
Die Musikwissenschaft stellte sich ihrerseits auf die nationalen Elemente in der Musik Fomins ein. Sie übernahm den noch von Finagin aufgegriffenen Leitfaden, dass Fomins Bühnenwerke den zur Zeit der Zarin Katharina II. (1762–1796) verbreiteten Ideen der russischen Aufklärung entsprächen. Hervorgehoben wurde Fomins Intention, eine ›nationale russische Oper‹ zu schaffen: eine Oper mit russischem und in russischer Sprache dargelegtem Sujet unter Verwendung von Volksliedmelodik. Großer Wert wurde auf »das beste ›russische Werk‹ Fomins« gelegt,[5] die Oper Jamščiki na podstave.[6] In diesem Kontext wurde dann auch das Melodram Orfeo ausführlich analysiert. Die 1968 erschienene Monographie Evstignej Fomin von Boris V. Dobrochotov berichtete erstmals ausführlicher über dieses »erste russische Melodram«.[7] Als ›typisch russisch‹ galt dem Autor dabei die »sehr enge innere Verbindung des Stückes mit dem russischen tragischen Theater des 18. Jahrhunderts«,[8] worauf das Wort-Ton-Verhältnis und die angeblich musikalisch übernommenen Intonationen der russischen Sprache hindeuten sollten. Von Bedeutung seien ferner die inhaltlichen Hintergründe der Tragödie nach dem Orpheus-Mythos. Der Autor der literarischen Vorlage, der russische Dramatiker Яков Б. Княжнин / Jakov B. Knjažnin (1742–1791), war bekanntlich eine der zentralen Figuren in der russischen Bewegung der »Freidenkenden«[9] gegen den aufgeklärten Absolutismus von Katharina II.[10] Da auch der Protagonist des Dramas gegen die Macht – wenn auch gegen eine göttliche – protestierte, konstruierten die Forscher einen Zusammenhang zwischen Fomins Musik, dem russischen dramatischen Theater und der politischen Situation Russlands in den 1790er Jahren.[11] Dies übertrug sich auf die Rezeption von Fomins Melodram. Sein Vorhaben, die Tragödie von Knjažnin in Musik zu setzen, wurde letztlich als »ein fast selbstmörderisches Unterfangen« bezeichnet.[12]
Es ist bedauerlich, dass die Musikwissenschaft der 1960er Jahre der Frage nach dem ›Russischen‹ im Melodram nicht weiter nachgegangen ist. Was genau nämlich Fomin in der Musik unternommen hatte und wie sich hier die »russische Theatersprache des 18. Jahrhunderts« darin widerspiegelte, blieb ungeklärt, obwohl Dobrochotov eine präzise Deutungsanalyse angeboten hatte.[13] Die Akzente wurden jedoch verschoben: Aufgrund charakteristischer Themen und Erinnerungsmotivik tendierte die Forschung dazu, Fomins Werk als programmatisches »symphonisches Poem« zu bezeichnen.[14] Orfeo bekam mithin den Ruf, ein Musterbeispiel »für das russische Symphonische« zu sein.[15] Daraus hätte man schließen können, dass die Musik in diesem Stück zur Darstellung und Kommentierung des Textinhaltes tendierte statt eine konkrete Bearbeitung des russischen Wortes zu sein. Das Melodram als textlich-musikalische Gattung ließ sich mit diesen Leitfragen noch nicht erfassen. Selten blieben auch die Versuche, Fomins Orfeo mit anderen, nicht einmal mit russischen, Melodramen zu vergleichen.[16] Auch Еврипидовой Алкисты / Euripides’ Alkestis (1790) von Giuseppe Sarti (1729–1802) war da keine Ausnahme, das eigentlich älteste Melodram mit russischem Text. Dieses Stück war als Abschluss eines größeren Bühnenwerkes Начальное управление Олега / Načalnoe upravlenie Olega (Der Anfang der Regierung von Oleg) entstanden, das Libretto dazu stammte von niemand anderem als Katharina II.[17]
Die Forschungslage hat sich seit den 1960er Jahren nicht grundlegend geändert. Im russischsprachigen Bereich wurden die älteren Monographien bloß in neuen Auflagen und Paraphrasen nachgedruckt (etwa bei Keldysch, 1990).[18] Das Lehrbuch Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка (2004) konturierte zwar die Tradition des russischen Melodrams um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert etwas schärfer, verallgemeinerte sie allerdings zu stark.[19] Hervorgehoben wurden nun Prinzipien, die für das Melodram generell gelten (psychologische Anspannung und Symbolik der Musik) oder allgemein für Russland charakteristische Elemente wie die Attraktivität und Bildlichkeit der szenischen Darstellung. Doch immerhin wurde damit das Melodram als eine spezielle Gattung betrachtet und in den Kontext des russischen literarischen Dramas mit Musik eingebettet.[20] Die deutschsprachige Musikwissenschaft übernahm von sowjetischen Forschern den Wissensstand der 1960er Jahre.[21] Neuere Beiträge wie Eighteenth-Century Russian Music von Marina Ritzarev (2006) und Bewitching Russian Opera von Inna Naroditskaya (2012) klammern das Melodram aus, obwohl der letztgenannte Beitrag erkenntnisreiche Informationen zum Hintergrund von Načalnoe upravlenie Olega gibt.[22]
Die mangelhafte Literaturlage lässt sich durch die Unzugänglichkeit der Quellen erklären. Besonders schwierig ist die Quellenlage zu Fomins Orfeo. Das Stück wird beispielsweise in NGroveD im Werkverzeichnis gar nicht erwähnt, obwohl es zu Fomins wenigen vollständig erhaltenen Werken gehört.[23] In RISM scheinen bloß zwei kontrapunktische Sätze von Fomin auf, die er in Bologna verfasst hat.[24] Das Autograph der Orfeo-Partitur liegt heute in der Zentralbibliothek des Petersburger Mariinski-Theaters, ist aus konservatorischen Gründen allerdings schon seit mehreren Jahren nicht mehr benutzbar.[25] Die einzige verfügbare Quelle ist damit eine 1953 von Dobrochotov edierte Partitur.[26] In Deutschland wird eine Fotokopie dieser Ausgabe seit 2011 in der Universitätsbibliothek Halle aufbewahrt.[27] Angesichts der schlechten Quellenlage sind die Beschreibungen des Autographs der Partitur, die Finagin (1927) und Findeisen (1928) hinterlassen haben, leider noch immer ›aktuell‹.
Der vorliegende Beitrag erörtert, welche Elemente der ersten russischen Melodramen auf charakteristisch Russisches verweisen und welche Voraussetzungen dafür bestehen, überhaupt von der Gattung eines ›russischen Melodrams‹ sprechen zu können. Der Ausgangspunkt für diese Überlegungen ist, zu klären,
- inwieweit die im ausgehenden 18. Jahrhundert als ›russisch‹ angesehenen literarischen und musikalischen Merkmale einen Zugang ins Melodram fanden und
- ob das europäische (vor allem deutsche und französische) Modell des Melodrams in Russland adaptiert wurde.
Es erscheint deshalb nötig, zunächst einen Einblick in die Integration der russischen Sprache und des russischen Volksliedes in das russische dramatische und musikalische Theater zur Zeit Katharinas II. zu geben sowie Daten zu damaligen Melodram-Aufführungen zu referieren. Als Nächstes lässt sich eruieren, welche Lösung der erste russische Melodram-Komponist Fomin fand und was zuvor der Italiener Sarti hatte unternehmen sollen, um am Hofe Katharinas II. das erste Melodram in russischer Sprache ausführen zu können.
I.
Die russische Sprache als nationaler Bestandteil des russischen Theaters eroberte ihren Platz im dramatischen und musikalischen Theater im ausgehenden 18. Jahrhundert. Den Vorrang hatte das Drama, das zu dieser Zeit vor allem Jakov B. Knjažnin / Яков Борисович Княжнин (1740–1791), Vladislav A. Ozerov / Владислав Александрович Озеров (1769–1816), Denis I. Fonvizin / Денис Ивановоич Фонфизин (1745–1792), Gavriil R. Deržavin / Гавриил Романович Державин (1743–1816) und Andere pflegten. Die Oper setzte dagegen bevorzugt auf andere Sprachen, weil fremdsprachige Theater in Russland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dominierten: Die italienische Oper war seit 1735 zunächst mit der opera seria präsent, 1757 bürgerte sich mit Locatelli die opera buffa ein, seit 1764 war die opéra comique zu Gast, und das »Deutsche Theater« spielte mindestens von 1776 bis 1791.[28] Es war Katharina II. gelungen, Komponisten aus ganz Europa an ihren Hof zu locken.[29] Von 1764 bis 1816 standen in russischen Diensten: Galuppi, Traetta, Paisiello, Sarti, Martini, Cimarosa, Grétry, Méhul und viele andere. Die Sprache variierte von einem Theater zum anderen. Im Deutschen Theater liefen Opern auf Deutsch – sogar italienische und französische Stücke, die dort aber nur 18 % ausmachten, wurden in Übersetzung gegeben.[30] Französische und italienische Texte in den entsprechenden französischen und italienischen Theatern firmierten meist im Original.
Ins Musiktheater drang das russische Idiom mit der Entscheidung von Katharina II., die Kultur zu ›russifizieren‹ und für ihre Innenpolitik zu instrumentalisieren. Die Zarin förderte die Einführung der russischen Sprache und russischer Sitten in den höfischen Umgang, wofür sie durch eigene literarische Tätigkeit das Vorbild gab.[31] Die Libretti vieler stilistisch italienischer und französischer Opern wurden nun auf Russisch verfasst. Beispiele solcher russifizierten Opern sind Anjuta / Анюта (1772; welche Quelle einer ursprünglich französischen komischen Oper als Vorlage diente, ist unbekannt; das Libretto stammt von Michail Popov / Михаил Попов),[32] Ivan (Johann Iosif) Kerzellis Rozana i Lubim / Розана и Любим und Feniks / Феникс (Knjažnin, 1778/79), Hermann Friedrich Raupachs Dobrue soldatu / Добрые солдаты (Michail М. Cheraskov / Михаил М. Херасков 1779), Antoine Bullants Sčastlivaja Rossia / Счастливая Россия (Cheraskov, 1787) etc.[33]
Gleichzeitig profilierte sich russische Drama. Zwischen 1770 und 1780 verbreiteten sich gemischte musikdramatische Konzeptionen mit eingefügten Balletten, Chören und Volksliedern. Die eigentümliche musikalisch-literarische Mischung war schon in deren Überschriften erkennbar: Der Dichter und Dramaturg Knjažnin nannte sein Theaterstück Titovo miloserdie / Титово милосердие (1790) »eine Tragödie in drei Akten, frei gedichtet, mit dazu gehörigen Chören und Balletten«;[34] das Stück Čuvstvovanie blagotvoreni / Чувствование благотворений (1787) definierte sein Autor Anton Teils / Антон Тейльс als ein »Drama mit Ballett«,[35] und ein charakteristisches Detail der Dramaturgie bildete darin ein eingefügtes Volkslied. Die Integration von Volksliedern, ›Rezitativen‹ und ›Arien‹ ins Drama bestimmte ein »Drama in zwei Akten mit Chören in Prosa« von Petr A. Pravil’ščikov / Петр А. Правильщиков.[36]
Mit Blick auf den Zusammenhang von musikalischen und dramatischen Komponenten betrachtet die Forschung das russische Theater im 18. Jahrhundert als ein literarisch-musikalisches Phänomen.[37] Das deutet darauf hin, dass das russische Theater im ausgehenden 18. Jahrhundert Erfahrung mit gemischten Wort-Ton-Konzeptionen gesammelt hatte. Dabei handelte es sich, wie auch im Operntheater, jedoch nicht um ›Sprache zur Musik‹, also nicht darum, dass die musikalischen und gesprochenen Ebenen sich synchron entwickeln. Das Russische wurde zuvörderst als literarische Sprache verstanden, nicht als eine zur erklingenden Musik. Das Verhältnis zwischen Text und Musik war daher locker: Die Musik bildete zum Text entweder einen Hintergrund der Stimmungsschilderung, oder es gab allgemein ›charakteristische‹ Intermezzi, die freilich austauschbar sein konnten. Die Musik fungierte also gewissermaßen als separate Ebene ohne direktes Verhältnis zum Text.
Ein Bestandteil der Charakternummern sowohl im dramatischen als auch im Musiktheater Russlands war stets ein nationales Element. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts war das Volkslied nicht nur im Drama, sondern auch in den ersten Opern von gebürtigen russischen Komponisten gängig, so bei Vasili А. Paškevič / Василий А. Пашкевич (1742–1792), Fomin, Dmitri S. Bortnjanski / Дмитрий С. Бортнянский (1751–1825), Michail A. Matinski / Михаил А. Матинский (1750–1820) und Michail M. Sokolovski / Михаил М. Соколовский (geb. 1756).[38] Die zunehmende Tendenz zur Aufarbeitung dieses Vokabulars führte zur Entwicklung einer speziellen Gattung russischer Lieder-Opern (etwa in Fomins Jamščiki na podstave, 1787).[39]
Es stellt sich die Frage, wie diese Erfahrungen mit dem Wort-Ton-Verhältnis und mit der Adaption von Liedformen dem aus Europa kommenden Melodram anverwandelt wurden. Das Melodram-Fieber grassierte in Russland früh und heftig. Rousseaus Pygmalion (1762) wurde schon 1772 »als eine aufsehenerregende Neuigkeit in der französischen Botschaft in Petersburg« auf Französisch gegeben.[40] Das war durchaus früh – im selben Jahr tauchte das Stück in französischer, italienischer und deutscher Sprache auch beispielsweise in Wien auf.[41] Die Melodramen von Georg Anton Benda erreichten den russischen Hof ebenfalls schon bald. Nur vier Jahre nach der Premiere von Ariadne auf Naxos 1775 in Gotha wurde das Stück bereits von Karl Knipper im Deutschen Theater in Petersburg aufgeführt. Medea lief dort 1781, sechs Jahre nach der Uraufführung in Leipzig.[42] Dann erschien Bendas Pygmalion 1791 in Petersburg[43] und 1794 bzw. 1800 in Moskau auf der Bühne.[44] Melodramen waren also seit den 1770er Jahren kontinuierlich in zwei russischen Großstädten präsent. Doch wurden sie nicht ins Russische übersetzt. Das Melodram scheint als eine eher exotische Gattung verstanden worden zu sein, die auf der russischen Bühne kein Äquivalent oder zumindest keine würdige Umsetzung ins Russische finden konnte.
Nicht zufällig waren die ersten Versuche, ein Melodram im russischen Sprachgebiet zu schaffen, von ausländischen Beispielen eindeutig abgegrenzt, zumal schon dadurch, dass im Titel ein Hinweis auf das melodrama russo gegeben war: Mit diesem Epitheton wurde 1781 das erste in Russland komponierte Melodram Orfeo, melodrama russo von Torelli beworben.[45] Der nächste Versuch – Euripides’ Alkestis von Giuseppe Sarti (1790) auf einen Text von Katharina II. – trug keine genaue Gattungsbezeichnung. Stattdessen war von einem Stück »Im griechischen Geschmack«[46] die Rede. Der vollständige Titel des ganzen Werkes, von dem Euripides’ Alkestis einen Teil ausmachte, verweist auf ein experimentelles Suchen und die Unentschlossenheit, was das Stück nun eigentlich sei: Načalnoe upravlenie Olega, podražanie Shakespeary bez sochranenija teatral’nych obyknovenych pravil / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ (Der Anfang der Regierung von Oleg, Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnlichen Theaterregeln zu bewahren). Die Bezeichnung Melo-Dramma für ein Melodram mit russischem Text wurde erst mit Fomins Orfeo (1791/92) eingeführt.[47] Auf die ›lockere‹ Position des russischen Melodrams insgesamt deutet auch das schnelle Verschwinden der Gattung hin – die letzten russischen Melodramen liefen in den 1800er Jahren (Aleksey N. Titov / Алексей Н. Титов Andromeda i Persey und Zirzeja i Ulis, beide 1802).[48]
Dieser Abriss lässt vermuten, dass das Melodram in Russland eigene Wege zu finden versuchte. Als Basis standen ihm drei Bereiche zur Verfügung:
- das eigentliche europäische Melodram (vor allem von Benda), das sich in Russland als ganz neu und fremd erwies,
- die Verschmelzung von opera seria, opéra comique und Lieder-Oper
- und die Erfahrung des russischen Theaters in der Koordination von Sprache und Gesang.
Im letzten Punkt konnten die Melodram-Komponisten sich eher auf ein Modell einer asynchron wechselnden Reihung des deklamierten Textes und der musikalischen Nummern stützen. Präferenz hatte dabei also das Modell einer literarisch, nicht einer musikalisch determinierten Komposition.
II.
Fomin ging mit der Herausforderung, ein russisches Melodram zu schreiben, in origineller Weise um. In der Tradition des russischen Theaters betrachtete er den literarischen Text – die Tragödie Orfeo von Knjažnin – als Grundlage, die nicht zu verändern sei. Orfeo von Knjažnin verkörperte aber ohnehin alle Attribute eines Melodrams im 18. Jahrhundert.[49] Sein Sujet geht auf die griechisch-römische Antike zurück. Die Tragödie ist kurz und in sich geschlossen. Traditionsgemäß enthält sie eine Exposition (die Schilderung der schon erfolgten Katastrophe mit anschließendem Beginn der Handlung: Monolog Orpheus’ über den Tod seiner Gattin und seinen Gang in die Unterwelt), die eigentliche Handlung (mit den zentralen Monologen von Orpheus in der Unterwelt und den dynamisch sich steigernden Dialogen mit einer überpersönlichen Schicksals-Stimme und mit Eurydike) sowie einen Schluss (den Monolog Orpheus’, der die Moral der Fabel expliziert). Die poetische Gestaltung der Monologe und Dialoge fußt auf der Technik des Sprechens zu verschiedenen Adressaten (zu sich selbst und zum Zuhörer), was der musikalischen Reflexion ausreichenden Spielraum bot. Eine Besonderheit der poetischen Vorlage lag darin, dass Knjažnin genaue Hinweise zu musikalischen Nummern zwischen dem gesprochenen Text gab. Das Konzept lag in einer Reihe eigentlich melodramatischer Komponenten (gesprochener reflektierender Text in Monologen und Dialogen) und Opernelementen. Er sah dafür folgenden Ablauf vor:
- Ouvertüre
- Monolog
- Erster Chor
- Monolog
- Zweiter Chor
- Dialog
- Dritter Chor
- Monolog
- Tanz der Furien.
Außerdem vermerkte Knjažnin, dass »Orpheus die Lyra spielt, während die Furien erscheinen«.[50] Damit war also auch ein rein instrumentaler Abschnitt vorgegeben. Eine solche Gestaltung des poetischen Dramas griff in Gänze auf die oben geschilderten Traditionen des russischen dramatischen Theaters im 18. Jahrhundert zurück.
Dem poetischen Text von Knjažnin zu folgen und diesen Text zu vertonen hieß für Fomin mithin, eine Mischform aus Melodram und Oper zu konzipieren. Musikalisch zu bedenken war zweierlei:
(1) die Komposition von Musik zur gesprochenen Sprache, ein für die russische Musik neues Phänomen,
(2) und die Komposition musikalischer Einlagenummern: von Chören, der Ouvertüre, dem Auftritt Orpheus’ vor den Furien und dem Tanz der Furien.
Dabei kam dem Komponisten die Entscheidung zu, inwieweit er eine gesungene Stimme einfügen und das Stück dadurch entweder ans Melodram oder an die Oper annähern wollte. Schließlich musste er klären, ob er die vom Text vorgegebene Nummernstruktur beibehalten wollte. Daraus würde dann entweder eine Anlehnung an die russische Theatertradition mit einem Nummernaufbau oder die Anverwandlung von Bendas Modell des Melodrams mit durchkomponierter Gestaltung resultieren.
Das Problemfeld von ›Musik zur gesprochenen Sprache‹ löste Fomin, indem er Bendas melodramatische Techniken bis ins Detail kopierte. Im Orfeo findet sich das typische Vokabular des bendaschen Melodrams wieder.[51] Das Bedeutungsfeld von Schrecken, Tod, Furien, Dunkelheit und Erdbeben bringt Fomin beispielsweise durch charakteristische trillernde Motive in Analogie zu Bendas Ariadne und Medea zum Ausdruck.[52]
Das Zittern und Beben setzt er musikalisch durch schnell repetierende Töne und dynamische Kontraste um (Beispiel 2, T. 254–261). ›Kriechende Tiere‹ finden in Orfeo ihren Ausdruck, indem Fomin das Motiv der sich drehenden Riesenschlange malerisch durch akzentuierte Sekundvorhalte in den Streichern darstellte (Beispiel 3, T. 268).
Der Vorgänger dieses Verfahren liegt gewiss in Bendas Ariadne mit den kreisenden Sekundbewegungen, die auch dort eine sich windende Schlange malen:
Orpheus’ Angst und das Zischen der Schlange vertont Fomin mit einem crescendierenden Tremolo der Streicher (Beispiel 3, T. 269). Das Bedeutungsfeld ›Ungeheuer‹ erweitert sich hier auf ›Schicksal‹ und ›Schlangenbiss‹ und überträgt sich musikalisch durch schnell wechselnde Dynamik – ähnlich wie beim brüllenden Löwen aus Bendas Ariadne (Beispiel 2, T. 260–261). Auch eine andere typisch bendasche Figur – rasch aufsteigende Zweiunddreißigstelläufe als Zeichen für das Wilde und den Sturm – zieht sich durch Fomins Melodram:
Diese Formel ist in der Melodramforschung als Rache-Motiv bekannt, das beispielsweise in Sophonisbe von Christian Gottlob Neefe (1776) ebenso vorkommt.[53] Kurze sforzandi mit Vorschlägen nutzt Fomin für die Flammen und »das Donnern, das die Ohren quält«. Seelische Qual drückt er mit einer Seufzerfigur aus, die unverkennbar eine Reminiszenz an barocke Lamenti und ihre Umdeutung in den deutschen Melodramen darstellt, z. B. in Medea, T. 441ff. (Beispiel 3, T. 262–266). Die genannten Formeln in Orfeo erhalten durch ihre Wiederholung eine erinnerungsmotivische Funktion, womit die Tradition des europäischen Melodrams auch in dieser Hinsicht bestens fortgesetzt ist.[54] / [55] / [56]
Fomin folgt Benda ebenso in allen Fragen der Beziehung zwischen Sprache und Musik. Der russische Komponist probiert hierzu die drei möglichen Varianten systematisch aus: Mal geht der Text der Musik voraus, mal ist er mit der Musik synchron verbunden, mal erscheint er erst nach der Musik.[57] All diese Kombinationen demonstriert Fomin schon im ersten Monolog des Orpheus (Beispiele 2, 3 und 6):
Orpheus:
O meine teuerste Eurydike!
Für Orpheus, dem du genommen bist, erscheint die Welt unerträglich.
Die Hölle hat ihren Schrecken für mich verloren.
In diesen Gebieten lebt die Seele meiner Seele.
O Schicksal! Du beraubtest mich meiner teuersten Gattin durch den Biss einer Schlange.
Mein Geist quält sich in dauerndem Schmerz.
Ich stöhne, leide in Betrübnis und leere den bitteren Kelch der Trennung.
Noch immer sehe ich vor mir die schreckliche Schlange.
Sie dreht sich und zischt.
In ihrem Rachen droht das Gift.
Lauf weg! Rette dein Leben. Zu spät… .Übersetzung: Thomas Weiler
Eine Trillerfigur mit punktiert rhythmisiertem Motiv am Anfang der Szene geht dem Text »Die Hölle hat ihren Schrecken für mich verloren«[58] voran und malt die Schrecken dieser Unterwelt aus. Die nächste Zeile des Textes, »In diesen Gebieten lebt die Seele meiner Seele«,[59] lässt Fomin die Musik erst nach dem gesprochenen Text diesen orchestral kommentieren: Abrupt wechselt die Tonart g-Moll zu B-Dur, weil eine positive Intention angekündigt wurde – »Die Seele lebt«. Dies fällt aber sofort zur Schicksal-Schlangen-Motivik nach g-Moll zurück, noch bevor im folgenden Text mitgeteilt wird, dass die Gattin schon entschwunden sei. Ab T. 262 setzt Fomin sowohl musikalisch als auch verbal längere Sätze ein, womit er mehr Zeit für die Reflexion eines neuen Zustandes gewinnt, nun den des Leides. Die Seufzerfigur umrahmt Orpheus’ Repliken, T. 265. Diese Statik schließt an den rasch alternierenden Wort-Ton-Wechsel zwischen dem Orchester und Orpheus an, T. 266–270: Orpheus schildert, was geschehen ist, und bringt dies in die Gegenwart: »Noch immer sehe ich vor mir eine schreckliche Schlange!«[60] Weiterhin fallen Text und Musik zusammen: »Lauf weg! Rette in Dir mein Leben. Aber spät…«.[61] Im Orchester erklingt eine der schönsten Melodien Fomins, geflochten aus expressiven Sekundvorhalten, T. 271–272. In dieser geschlossenen musikalischen Phrase gebührt dann einmal die ungeteilte Aufmerksamkeit der Musik. Ähnlichkeiten der melodramatischen Techniken von Benda und Fomin zeigen sich ferner im Zusammenhang zwischen der Ouvertüre, dem abschließenden Tanz der Furien und dem melodramatischen Teil. Die ›Furien-Motivik‹ bildet den Stoff für die umrahmenden instrumentalen Sätze. Die gerade beschriebene seufzende Melodie steht zum ersten Mal schon in der Ouvertüre ab T. 87.
Dass Fomin das melodramatische Vokabular und die melodramatische Technik aus Bendas Melodramen so deutlich wiedererkennbar übernommen hat, widerspricht der von der russischen Forschung vehement vertretenen Behauptung, der Komponist habe ganz exakt die spezifischen Intonationen der russischen Sprache in der Musik umgesetzt. Bei Orfeo handelt es sich nicht darum, sondern um eine Darstellung von Affekten mit Mitteln, die so oder so ähnlich in ganz Europa in Gebrauch waren. Nicht die konkrete (russische) Sprache spielte eine Rolle, sondern die verallgemeinerte Bedeutung des Wortes und die Tradition ihrer Vertonung. Ob der Text des Melodrams dann auf Russisch, Deutsch oder Französisch aufgeführt würde, wäre letzten Endes nebensächlich. Auch die These, dass Fomin eine besondere psychische Spannung entwickelt habe, ist nur mit Blick auf die Affektinhalte korrekt. Die nicht russische Grundlage der ›Musik zur Sprache‹ in Fomins Melodram bestätigt sich auch dadurch, dass sich das Melodram von früheren, mehr folkloristischen Kompositionen Fomins deutlich unterscheidet, etwa von der Oper Jamščiki na podstave.
Durch die Objektivierung des Ausdrucks ging Fomin jedoch weiter als in anderen damals in Russland aufgeführten Melodramen. Und hier lag seine Innovation und das, was sich schließlich als für Russland als ›neu‹ bezeichnen lässt. Fomin entwickelte zwei Methoden in der Gestaltung des Melodrams: Er komponierte opernhafte Nummern, wie der dramatische Text sie verlangte, und er fügte geschlossene Orchestersätze ein, die einen Affektzustand ausdrückten, in der Textvorlage aber nicht vorgesehen waren. Die ›Opernnummern‹ versuchte Fomin zugleich der Gattung des Melodrams anzupassen. Orpheus’ Gesang zur Lyra vermittelt er durch eine typische Belcanto-Arie, in der freilich die Funktion der gesungenen Stimme von der Klarinette übernommen wird (T. 390ff.). Diese wortlose Arie stellt einen geschlossenen und rein musikalischen, statischen Ruhepunkt dar. Im Dialog zwischen Orpheus und Eurydike (T. 558–604) sind sowohl ariose als auch rezitativische Passus verflochten, stets in erfindungsreichen Kombinationen und plastisch in den Text integriert. Die Szene beginnt mit einem deklamierten Dialog – die erste Begegnung von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt –, den eine zweite Klarinetten-Arie harmonisch fortsetzt. Der nächste Dialog (T. 567–578) wandelt sich zum Recitativo accompagnato mit anschließender Wiederholung der zweiten Klarinetten-Arie, T. 579–586. Sie geht in einen letzten Dialog von Orpheus und Eurydike über, der ebenso wie am Anfang der Szene ohne Musik gesprochen wird. Der abschließende Satz ist ein neues Recitativo accompagnato, diesmal ohne instrumentale Arie, in T. 588–604. Die Annäherung an die opera seria bezeugt sich überdies dadurch, dass Fomin das letzte Rezitativ in der Tat als Recitativo überschrieb.[62] Die Deklamation blieb aber unrhythmisiert.
Die Nummernstruktur des Melodrams offenbart sich auch durch drei ähnliche Chöre, T. 296ff., T. 494ff. und T. 630ff. Fomin folgte hierbei abermals den dramatischen Text-Intentionen: Er nutzte also die Leitlinie des Melodrams einer experimentellen ›Wiederbelebung‹ der antiken Tragödie für eine musikalische Reminiszenz an die nach ihrer Funktion überpersönlichen Chöre. Musikalisch gestaltete er dies mit einem skandierenden einstimmigen Gesang der Bässe, der einen streng rhythmisierten Text markant hervorhebt.
Chor:
Sei voll der Hoffnung!
Übersetzung: Thomas Weiler
Eine andere Strategie, nämlich diejenige, semantisch prägnante und vom gesprochenen Text unabhängige Sätze einzufügen, zeigt sich in den ersten musikalischen Vorstellungen der Figuren Orpheus und Eurydike. Ihre musikalische Charakterisierung erfolgt ganz in der Manier einer Oper durch einen geschlossenen Orchestersatz vor dem jeweils ersten Auftritt. Orpheus’ erstes Erscheinen wird durch ein galantes Menuett markiert, T. 228–247. Eurydikes Auftritt geht ein zärtlicher geradtaktiger Tanz voraus, T. 530–557. Auch die Lamento-Sphäre bekommt eine zusätzliche Charakteristik durch die eingefügten stilistisch geschlossenen Abschnitte, so in der Einleitung der Ouvertüre mit seufzenden Sekundvorhalten über dem gemäßigt schreitenden Passus duriusculus-Bass. Eine Reminiszenz an den Trauersatz des 17. Jahrhunderts ist durch einen Orchesterkommentar zur seelischen Qual Orpheus’ nach seinem Klarinettenlied mit Lyra gegeben, T. 450–459.
Wenn Fomins Melodram im Bereich der ›Musik zur Sprache‹ also vollkommen europäisch bleibt, fuhr er in der formalen Gestaltung der Komposition durch die klare Nummernstruktur im Fahrwasser der russischen Theatertraditionen. Neu war, dass Fomin diese Nummern formelhaft mittels europäischer Stilistik darbot und dadurch ein Amalgam aus Prinzipien des russischen Theaters (ins Drama eingelegte Musiknummern), europäischen Praxen (Opernarien und -rezitative) und den ersten europäischen Melodramen (ohne Gesang) schuf. Die russische Sprache bildete also zwar ›eine‹, aber nicht die bestimmende Ebene dieser musikdramatischen Mischform. Dass die Musik und die russische Sprache nicht im direkten Zusammenhang standen, lassen schon die Überschriften im Autograph der Orfeus-Partitur vermuten. Auf die erste Seite der Ouvertüre schrieb Fomin: »Originale. Orfeo и Euridica Melo-Dramma; Posto in Musica da – E. I. Fomine Acade: Filarmonico à Pietro-borgo 1791 [korrigiert zu 1792]«.[63] Am Anfang der eigentlichen melodramatischen Handlung ist der Titel leicht verändert: »Originale. Orfeo Melo-dramma. Posto in musica da Eus. I. Fomine. Academico Filarmonico à Pietro-borgo 1792«.[64] Vor Eurydikes ersten Auftritt setzte Fomin den Titel ein drittes Mal: »Originale. Orfeo Melo-Dramma. Parte seconda«.[65] Insofern im melodramatischen Teil Fomins Überschriften einander ähnlicher sind als zu der Variante vor der Ouvertüre (Orfeo Melo-Dramma und nicht Orfeo i Euridica Melo-Dramma), insofern weiters im Titel der Ouvertüre auch eine Korrektur des Entstehungsjahres steht, lässt sich vermuten, dass Fomin die nur musikalischen und die dramatischen Teile nicht zu gleicher Zeit komponiert oder zumindest als nicht gleichberechtigte Komponenten der Komposition betrachtet haben könnte. Dass Musik- und Text-Ebene nicht als Synthese wahrgenommen, zugleich jedoch durch musikalische und textliche Affektformeln gut vermittelt wurden, sicherte den Erfolg von Fomins Melodram im 18. Jahrhundert und bis in die heutige Zeit.[66]
III.
Giuseppe Sartis Melodram Euripides’ Alkestis (1790) war eines der abenteuerlichsten Unternehmen in der Geschichte des russischen Theaters. Der Auftrag ging von Katharina II. aus. Die Zarin benötigte Musik zu eigenen Texten, die sie als eine Historische Handlung zu Načalnoe upravlenie Olega, podražanie Shakespeary bez sochranenija teatral’nych obyknovenych pravil / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ (Anfang der Regierung von Oleg, Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnlichen Theaterregeln zu bewahren) bezeichnet hatte. Es handelte sich dabei um eine eklektische Zusammenfassung von Ereignissen aus der Geschichte der russischen Großfürsten Oleg († 912/922), Igor († 945) und Großfürstin Olga (nach 900–969), die in einen Ausschnitt aus Euripides’ Tragödie Alkestis mündete. Die Szene aus der griechischen Tragödie stellte dabei ein Theater im Theater dar: Fürst Oleg wohnte in Konstantinopel einer Aufführung der Alkestis auf einer eigens für ihn eingerichteten Theaterbühne bei.[67]
Die Musik dazu sollten drei verschiedene Komponisten liefern: Carlo Canobbio (1741–1822), Vasili Paškevič (1742–1797) und Giuseppe Sarti, der für den Part zu Euripides’ Alkestis verantwortlich war. Von ihm wurde eine griechische Tragödie mit »Musik im griechischen Geschmack« bestellt, für die er griechische Modi verwenden und Chöre komponieren sollte.[68] In dieser Forderung wurzelte der Zwiespalt des russischen Melodrams, der dann auch Fomins Orfeo bestimmen sollte: Das ästhetische Experiment der Wiederbelebung der antiken Tragödie eröffnete einen Spielraum für Experimente im Bereich der modischen Gattung des Melodrams. Sarti verwies man auf die gängigen Modelle von Rousseau und Benda. Der Anspruch der Verfasserin des Textes, sie wolle »schöne Chöre« bekommen, bedeutete jedoch, dem damaligen Geschmack angepasste musikalische Nummern zusätzlich einzuarbeiten. Dass Sarti kein Russisch sprach, machte die Aufgabe noch schwieriger. Man konnte gewiss nicht davon ausgehen, dass er ›Musik zur Sprache‹ entwickeln würde.

Giuseppe Sarti (1729–1802). Originally from fr.wikipedia. Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons.
Sarti schuf ein Hybrid, das alle Beteiligten befriedigen sollte. Ein melodramatischer Abschnitt eröffnet die Tragödie, in dem freie Monologe von Heracles und Dialoge zwischen Heracles und Admetus mit instrumentalen Zwischenspielen und Chorrepliken abwechseln. Der Chor fungiert als überpersönliche Stimme, die – wie im Orfeo – unisono singt, aber im Unterschied zu Fomins Melodram Recitativi accompagnati bildet:[69]
Der melodramatische Teil mündet in vier Chöre mit den griechischen Bezeichnungen »Strophe« – »Antistrophe«. Sie sind freilich nichts anderes als vier Coro unisono gesungenen Arien. Melodramatische Affektformeln sind selten. Immerhin setzte Sarti die »wilden Löwen« und »das Wilde« durch aufsteigende Zweiunddreißigstelläufe und dynamische Kontraste musikalisch um, so in T. 15–18 in der ersten Antistrophe. Die Waagschale der gattungsstilistischen Einordnung neigt sich damit eher auf die Seite der Oper, freilich mit durchaus eigentümlicher Interpretation der Chorpartie.

Beispiel 9a (Sarti, Euripides’ Alkestis, erste Antistrophe, Anfang des ersten und zweiten Abschnitts: Beginn)

Beispiel 9b (Sarti, Euripides’ Alkestis, erste Antistrophe, Anfang des ersten und zweiten Abschnitts: Fortsetzung)
Mithilfe von Nachahmung der griechischen Instrumente und Modi versuchte Sarti den melodramatischen Eindruck und seinen Bezug auf die Kunst der Griechen anzudeuten. Zur Erinnerung an antikes Instrumentarium fügte er Einsätze der Harfe, Violini pizzicato und der Flöte ein. Schwieriger war es, die Musik ›in griechischer Manier‹ anhand der im dramatischen Text en detail vorgegebenen »Modo Dorio«, »Modo Hypo-Jonio«, »Modo Hypo-Dorio« und »Modo Phrygio« auszuführen. Letzten Endes blieb Sartis Musik durmolltonal. Dass seine Umsetzung dieser Forderung ausgesprochen spekulativ war, ahnte er offensichtlich selbst. So verfasste er eine spezielle theoretische Erklärung zu Euripides’ Alkestis, in der er ausführte, wie er die Grundlagen der Wiederbelebung des antiken Dramas interpretiert habe.[70] Diese Erklärung wurde ins Russische übersetzt und im Libretto abgedruckt. Sarti versuchte das Publikum selbstbewusst von nichts weniger zu überzeugen als dass die von ihm komponierte Musik »absolut griechisch« sei. Sie müsse in moderner Manier so bearbeitet werden, dass die Zuhörer sie leicht verstünden. Dafür nutze er die gewöhnliche Harmonik:
»Die Handlung aus Euripides sollte nach ihrem Ort und Charakter im altgriechischen Geschmack dargestellt werden, die Musik sollte daher in dieser Manier sein. Infolgedessen habe ich eine absolut griechische Musik zum Gesang komponiert, deren Begleitung jedoch in der Art jetziger Harmonien gestaltet«.[71]
Auch hinsichtlich der anderen Komponenten verfiel Sarti in theoretische Diskussionen mit dem Ziel, seine zur Oper tendierte Komposition als Drama abzusichern. Nach Sarti sollten die Rezitative als »griechische Deklamation« wahrgenommen werden, auch wenn sie eigentlich »eine Art des Rezitativs« anboten.[72] Die Harfen-, Pizzicato- und Flöten-Klänge seien Nachahmungen von Lyra und Tibia. Die Modi müsse man durch die Affekte, die die Musik Sartis beinhalte, erkennen können. Falls die griechischen Merkmale dann doch nicht erfasst würden, müsse der Zuhörer sich eben selbst die Schuld geben.[73]
Die Historische Handlung wurde prachtvoll inszeniert und hatte laut einem Schreiben von Katharina II. an den Fürsten Potëmkin einen grandiosen Erfolg.[74] Historisch zeitigte Sartis Komposition von Euripides’ Alkestis für das russische Melodram Folgen. Seine Apologie verbreitete die ersten auf Russisch niedergelegten Grundzüge einer Theorie des Melodrams in den russischsprachigen Raum. Als große Aktion des Hoftheaters war Euripides’ Alkestis auch in dem Sinne signifikant, dass sie die Trias ›griechische Musik‹ – ›Drama‹ – ›heutige Musik‹ in der russischen Kunst etablierte. Fomin brauchte auf dieser Grundlage auf die griechische Kunst schon nicht mehr so präzise zu rekurrieren wie Sarti. Er hat alle von Sarti künstlich einbezogenen Elemente reduziert und nur den Coro unisono gelassen. Auch die musikalisch-dramatische Mischform aus Oper und Melodram erwies sich für die Zukunft als nützlich, die dann Fomin übernommen und deutlich überarbeitet hat. Dieser Komplex von Merkmalen bildet Eigenschaften der ersten in Russland entstandenen Melodramen.
Anmerkungen und Nachweise
[1] »новую русскую оперу«: Алексей В. Финагин, Евст. Фомин. Жизнь и творчество, в: Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования, Т. 1, Ленинград 1927, С. 87. (Aleksej V. Finagin, Evst. Fomin. Leben und Werk, in: Musik und musikalischer Alltag im alten Russland. Materialien und Untersuchungen, Bd. 1, Leningrad 1927, S. 87).
[2] Finagin, Musik und musikalischer Alltag; Николай Ф. Финдейзен, Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века, Т. 2, Вып. V/VI, Москва 1928/29 (Nikolaj F. Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland von der älteren Zeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, Bd. 2, Teile V/VI, Moskau 1928/29); Александр С. Рабинович, Русская опера до Глинки, Москва 1948 (Aleksandr S. Rabinovič, Die russische Oper vor Glinka, Moskau 1948). – Die von diesen Forschern zusammengefassten Daten aus dem Lebenslauf Fomins bilden bis heute den Wissenstand über den Komponist, hierzu siehe Sigfrid Neef, Fomin, in: MGG2, Bd. 6, Kassel 2001, Sp. 1415–1417; vgl. Juri W. Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater des 18. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Musikwissenschaft 9, 3/4 (1967), S. 305–316. Evstignej Ipat’evič Fomin (1761–1800), geboren in Sankt Petersburg, studierte von 1767 bis 1782 an der neu gegründeten Kaiserlichen Akademie der Künste (Malerei, Skulptur, Architektur und später Musik). Kurz nach dem Abschluss erhielt er ein dreijähriges staatliches Stipendium für seine Weiterbildung in Bologna bei Giovanni Battista Martini und Stanislao Mattei. Ab 1786 war er als Repetitor und Kapellmeister an den russischen städtischen Theatern und adligen Leibeigenentheatern tätig. Fomin komponierte unter anderem auf Libretti der Zarin Katharina II., was allerdings aus unbekannten Gründen zur Ungnade der Zarin und Komplikationen am Hof geführt hat. Fomin bekam eine offizielle Anstellung am Hoftheater erst 1797 bei Paul I. Mit 39 Jahren starb er unter ebenso unbekannten Ursachen in Armut. Fomin komponierte etliche Oper, ein Melodram, einzelne Chöre und ein geistliches Chorkonzert. Außerdem hat er offensichtlich Opern anderer Komponisten redigiert. Der größere Teil vom Fomins Schaffen galt schon im frühen 20. Jahrhundert als verloren oder nur partiell überliefert. Die Anzahl der Werke variierte sich von einem Forscher zum anderen: zehn Kompositionen, unter denen fünf erhalten blieben (Finagin, Musik und musikalischer Alltag, S. 98); neun Stücke mit vier vollständig erhaltenen Partituren (Борис В. Доброхотов, Евстигней Фомин, Москва 1968, С. 98–99 / Boris V. Dobrochotov, Evstignej Fomin, Moskau 1968, S. 98f.); »30 musikalisch-dramatischen Werke verschiedener Art« (Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 306). Heute ist die Meinung verbreitet, dass Fomin sieben Oper schrieb, von denen drei rekonstruiert werden konnten (Neef, Fomin, Sp. 1417):
- Новгородский богатырь Боеслаевич / Novgorodskij bogatyr’ Boeslaevič (Der Novgoroder Held Boeslaevič), komische Oper, zusammengestellt aus russischen Märchen, Liedern und anderen Quellen, 1786 (erhalten nur Orchesterstimmen);
- Ямщики на подставе / Jamščiki na podstave (Die Kutscher auf der Poststation), improvisiertes Spiel, komische Oper, 1787;
- Американцы / Amerikancy (Die Amerikaner), komische Oper, 1787/88;
- Вечеринки, или Гадай, гадай, девица / Večerinki ili Gadaj, gadaj, devica, otgadyvaj, krasnaja (Abendgesellschaften oder Lege die Karten, wahrsage, Mädchen, enträtsel dein Schicksal, Schöne), 1788 (Musik verloren);
- Золотое яблоко / Zolotoe jabloko (Der goldene Apfel), komische Oper mit Chören und Balletten, 1788/89 (fragmentarisch erhalten);
- Колдун, ворожея и сваха / Koldun, vorožeja i svacha (Zauberer, Hexe und Heiratsvermittlerin), 1789 (Musik verloren);
- Орфей / Orfej (Orpheus, Melodram 1791/92);
- ein Chor zur Tragödie Владисан / Vladizan, 1795 (verloren);
- ein Chor zur Tragödie Ярополк и Олег / Jaropolk i Oleg (Jaropolk und Oleg), 1798.
[3] »в ›Орфее‹ мы видим удачный опыт написать серьезную музыку типа Глюка«: Finagin, Evst. Fomin, S. 103.
[4] Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 105.
[5] »лучшее ›российское сочинение‹ Фомина«: ebd., S. 37.
[6] Ebd., S. 37ff. – Vgl. auch Finagin, Evst. Fomin, S. 98ff.; Юрий В. Келдыш, Очерки и иследования по истории русской музыки, Москва 1978, С. 130–140 (Juri W. Keldysch, Essays und Untersuchungen über die Geschichte der russischen Musik, Moskau 1978, S. 130–140).
[7] »первая русская мелодрама«: Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 75.
[8] »внутренняя связь ›Орфея‹ Фомина с русским трагическим театром XVIII века«; ebd., S. 76.
[9] ›Волнодумцев‹ / ›Volnodumzev‹
[10] In einer der letzten Tragödien Вадим Новгородский / Vadim Novgorodski protestierte Knjažnin ganz offen gegen zaristische Macht. Alle Exemplare der Tragödie wurden vernichten und Knjažnin selbst wurde 1791 ermordet, Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 71.
[11] Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 70ff.; vgl. Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 310; Neef, Fomin, Sp. 1416.
[12] Ebd., Sp. 1416.
[13] Dobrochotovs Anmerkungen, wie etwa »›Orpfeo‹ von Fomin gibt uns die Möglichkeit, tatsächlich ein russisches theatralisches Gespräch zu hören«, blieben ohne Erklärungen. (»›Орфей‹ Фомина дает возможность реально услышать русскую театральную речь XVIII века«: Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 76.)
[14] »симфонический характер [мелодрамы Фомина] […] приближает ›Орфея‹ к жанру программной симфонической поэмы«: ebd., S. 77; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 314. Hierbei handelte es sich um eine der Leitthemen der sowjetischen Musikwissenschaft – symphonisches Denken in der Instrumentalmusik.
[15] »Это [›Орфей‹ Фомина] лучший образец русского драматического симфонизма доглинкинского времени«: Георгий К. Абрамовский, Русская опера XVIII века, Москава 1968, С. 27. (Georgi K. Abramovski, Die russische Oper des 18. Jahrhunderts, Moskau 1968, S. 27).
[16] Stattdessen gab z. B. Keldysch eine allgemeine historische Auskunft zum Melodram in Deutschland im 18. Jahrhundert: Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307ff. Kurze historische Exkurse sind in den Geschichten der russischen Oper im 18. Jahrhundert vorhanden, siehe z. B. Abramovski, Russische Oper, S. 23 und 26.
[17] Siehe etwa Abramovski, Russische Oper, S. 23; Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 137.
[18] Юрий В. Келдыш, История русской музыки, Вып. 1, Москва 1990, С. 204сл. (Juri V. Keldysch, Geschichte der russischen Musik, Bd. 1, Moskau 1990, S. 204ff.).
[19] Татьяна В. Ильина, Мария Н. Щербакова, Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка, Москва 2004, С. 349сл. (Tat’jana V. Il’ina, Maria N. Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert: Darstellende Kunst und Musik, Moskau 2004, S. 349ff.)
[20] Ebd., S. 468ff.
[21] Siehe hierzu Neef, Fomin, Sp. 1415–1418; Marc Mühlbach, Russische Musikgeschichte im Überblick. Ein Handbuch, 1. Aufl., Berlin 2004, S. 41f.
[22] Marina Ritzarev, Eighteenth-Century Russian Music, Cornwall 2006, S. 199ff.; Inna Naroditskaya, Bewitching Russian Opera. The Tsarina from State to Stage, New York 2012, S. 113ff.
[23] Richard Taruskin, Fomin, Yevstigney Ipat’yevich, in: NGroveD, Bd. 9, London 2001, S. 71.
[24] Diese Stücke werden in der Bibliothek Accademia Filarmonica Bologna aufbewahrt. Es handelt sich um Fugues (RISM: http://opac.rism.info/search?documentid=850016616) und eine Antiphon Joannes et Paulus agnoscentes (RISM: http://opac.rism.info/search?documentid=850016615).
[25] Diese Informationen bestätigte mir auch Pavel Serbin, Direktor und Dirigent des Pratum integrum Orchestra, der 2009 eine Aufnahme von Orfeo durchgeführt hat, CD CM 0012008.
[26] Евстигней Фомин, Орфей, ред. Борис Доброхотов, Москва 1953.
[27] MPP / 4 Fom 1.
[28] Wertvolle Quelleninformationen aus dem 18. Jahrhundert gab der deutsche Gelehrte, Chronist und Sammler Jakob von Stählin (1709–1785). Er war an der Petersburger Akademie der Wissenschaften tätig. Dort oblag ihm die Katalogisierung und Verwaltung der höfischen Bibliotheken und Kunstsammlungen sowie die Erziehung von Peter III. Stählin übernahm die Redaktion der seit 1727 bei der Petersburger Akademie der Wissenschaften erschienenen St. Petersburger Zeitung, in welcher er das zeitgenössische Geschehen im russischen Theater schilderte. Dank dieser Beiträge entstanden die ersten Versuche, die Geschichte des russischen Theaters zu schildern. Hierzu Ernst Stöckl, Nachwort, in: Jakob von Stählin, Zur Geschichte des Theaters in Russland. Nachrichten von der Tanzkunst und Balletten in Russland. Nachrichten von der Musik in Russland, Leipzig 1982, S. I–XX. Zur ausführlichen Geschichte der ausländischen Entreprise in Russland siehe auch Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 112ff. und 206ff.; Aloys Mooser, Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siècle, T. II, Mont-Blanc 1953; Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 932ff. Zur Geschichte des Deutschen Theaters in Russland siehe Denis Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, 1. Aufl., Lage-Hörste 2003. Eine kurze Zusammenfassung gibt die Russische Musikgeschichte von Mühlbach, S. 28–39.
[29] Die Entscheidung, nach Russland zu kommen, wurde sicherlich durch gute Honorare motiviert. Baldassare Galuppi (in Petersburg von 1764 bis 1768) wurde mit einem Jahresgehalt von 4.000 Rublej angestellt, hierzu Findeisein, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 123. Zum Vergleich: Fomins Jahresgehalt betrug 1797 nur 600 Rublej, siehe Neef, Fomin, Sp. 1416.
[30] Hierzu Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, S. 34. Die deutsche Sprache war am russischen Hof schon vor der Regierungszeit Katharinas II. beliebt gewesen. Zu den Aufgaben von Stählin bei Zarin Anna Ivanovna (1730–1740) und ihrer Nachfolgerin Elizaveta Petrovna (1741–1761) gehörte, italienische Komödien, Opern und Intermezzi ins Deutsche zu übersetzen. Die Texte wurden zusammen mit den originalen italienischen Fassungen bei Hofe verteilt. Die St. Petersburger Zeitung erschien in deutscher Sprache mit einer russischen Übersetzung, hierzu Stöckl, Nachwort, S. Vf.
[31] Hierzu Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 213ff.
[32] Ebd., S. 95 und 213. Ein früheres Beispiel ist Arajas Cefallus und Prokris, dessen Libretto von Aleksandr P. Symarokov / Александр П. Сумароков stammt (1755).
[33] Ebd., S. 214ff.
[34] »трагедия в трех действиях вольными стихами с хорами и балетами к ней принадлежащими«, siehe Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 169–170ff.; Abramovski, Russische Oper, S. 6ff.
[35] »драма с балетом«: hierzu Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 470.
[36] »драма в двух действиях, с хорами, в прозе«: ebd.
[37] Ebd. und Abramovski, Russische Oper, S. 6.
[38] Die ersten russischen Opern mit Volkslieder sind Mel’nik / Мельник (Der Müller) von Sokolovski (1785), Sankt-Petersburgski gostinuj dvor / Санкт-Петербургский гостинный двор (Der Petersburger Gasthof) von Matinski (1779) und Fevej / Февей, Fedul s det’mi / Федул с детьми (Fedul mit Kindern) von Paškevič (1786, 1791). Hierzu Dieter Lehmann, Russlands Oper und Singspiel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1958.
[39] Keldysch, Geschichte der russischen Musik, S. 205ff.
[40] Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 308, Anm. 13.
[41] Wolfgang Schimpf, Lyrisches Theater. Das Melodrama des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1988, S. 21.
[42] Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, S. 31.
[43] Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 309.
[44] Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 107.
[45] Von diesem Melodram sind nur Orchesterstimmen erhalten geblieben. Sie werden in der Zentralen Nationalbibliothek Petersburg aufbewahrt. Siehe hierzu Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 74, Anm. 2; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307, Anm. 10.
[46] »Сообразно Греческому древнему вкусу«.
[47] Siehe die Beschreibung von originalen Partiturseiten bei Finagin, Musik und musikalischer Alltag, S. 104.
[48] Il’ina Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 481.
[49] Zur Gattung des Melodrams im 18. Jahrhundert siehe Schimpf, Lyrisches Theater; Ulrike Küster, Das Melodrama. Zum ästhetikgeschichtlichen Zusammenhang von Dichtung und Musik im 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main [u. a.] 1994.
[50] »Орфей играет на лире. Фурии показываются«.
[51] Zu den melodramatischen Techniken in Musik und Sprache von Benda siehe Küster, Das Melodrama.
[52] Den gesprochenen Text zu Fomins Orfeo im Beispiel A gebe ich mit einer deutschen Übersetzung von Thomas Weiler aus der Broschüre zur CD CM 0012008: Yevstigney Fomin (1761–1800) · Orfeo ed Euridice, 2009.
[53] Küster, Das Melodrama, S. 239.
[54] Zur Leitmotivik in Bendas Melodramen siehe ebd., S. 216ff.
[55] Jiří Antonín Benda, Medea. Melodram, Praha 1976.
[56] Georg Benda, Ariadne auf Naxos. Ein Duodrama mit musikalischen Zwischensätzen, Klavierauszug, hrsg. von Alfred Einstein, Leipzig 1920.
[57] Zu Bendas Melodramen siehe Küster, Das Melodrama, S. 234ff.
[58] Die Übersetzung ist nicht treffend. Der Text »Мне ада страшные места не дики« lässt sich besser als »Die wilde Gegend der Hölle ist mir nicht fremd« wiedergeben.
[59] »Душа души моей в сих областях живет.«
[60] »Еще, еще я зрю ужасную змею!«
[61] »Беги, спаси в себе ты жизнь мою. Но поздно…«
[62] Siehe hierzu Finagin, Evst. Fomin, S. 104.
[63] Ebd.
[64] Ebd.
[65] Ebd.
[66] Für eine erfolgreiche Aufführung des Orfeus spricht eine häufig zitierte Rezension vom 1817: »Im Melodram dieser Oper [Orpheus] war die Musik von Torelli, doch nach unserem russischen Herrn Fomin, der lange Zeit in fremden Ländern weilte, wurde die frühere Musik durch sein ausgezeichnetes Talent völlig verdunkelt, und obwohl er zu unserem allgemeinen Leidwesen aus dem Leben geschieden ist, schuf er sich im Orpheus eine bleibende Erinnerung«: zitiert nach der deutschen Übersetzung in Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307, Anm. 9.
[67] Das Stück sollte die außenpolitischen Ansprüche von Katharina II. auf Konstantinopel widerspiegeln, siehe hierzu Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 248; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 23.
[68] Siehe den Brief von Kathrina II. an den Fürsten Potëmkin vom 3. Dezember 1789: »Lieber Freund, ich bitte Dich gelegentlich daran zu erinnern, Sarti zu befehlen, die Chöre für Oleg zu schreiben; ein Chor von ihm gibt es bei uns und er ist sehr gut, hier können [die Komponisten] so gut nicht komponieren« (»Еще, мой друг, прошу тебя в досужий час вспомнить приказать Сартию сделать хоры для ›Олега‹; один его хор у нас есть и очень хорош, а здесь не умеют так хорошо компонировать«), zitiert nach Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 137.
[69] Die Beispiele zu Euripides’ Alkestis wurden einer Kopie der originalen Ausgabe 1791 entnommen: Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ, Москва у П. Юргенсона, С.-Петерсбургъ у І. Юргенсона, Варшава у Г. Зенневальда, 1791 (Anfang der Regierung von Oleg Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnliche Theaterregeln zu bewahren, Moskau bei P. Jurgenson, S.-Petersburg bei I. Jurgenson, Warschau bei G. Zennewald, 1791).
[70] Объясненіе на музыку Господиномъ Сартіемъ сочиненную для Историческаго представления: Начальное управленіе Олега: перевод Николая А. Львова, в: Начальное управленiе Олега, С. 4–6. (Erklärung zur von Herrn Sarti komponierten Musik für die Historische Handlung: Anfang der Regierung von Oleg, Übersetzung von Nikolaj A. L’vov, in: Anfang der Regierung von Oleg, S. 4–6).
[71] »Явленіе изъ Еврипида, по мѣсту и свойству своему, должно быть представлено во вкусѣ древнемъ Греческомъ, а по тому и музыка должна быть въ томъ же вкусѣ; въ слѣдствіе чего и сочинилъ я музыку совершенно Греческую относительно къ пѣнію, сопроводя оную однако по образу нынѣшней Армоніи«: ebd., S. 4.
[72] »Греческая декламація«, »нѣкоторый родъ Речитатива«: ebd.
[73] Ebd., S. 6.
[74] »an Sarti schicke ich mit einem Kurier tausend Červonych [alte Währung in Russland] und ein Geschenk für die Musik zu Oleg. Heute wurde Oleg zum dritten Mal in der Stadt aufgeführt und er [Oleg] hat einen grandiosen Erfolg«: Brief von Katharina II. an den Fürsten Potëmkin vom 1. November 1790 (»к Сартию с сим куръером посылаю за музыку к ›Олегу‹ тысячу червонных и подарок вещь. Сегодня Олега в третий раз представляют в городе, и он имеет величайший успех«), zitiert nach Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 138.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abramovski, Georgi K.: Die russische Oper des 18. Jahrhunderts, Moskau 1968 / Абрамовский, Георгий К.: Русская опера XVIII века, Москава 1968.
Anfang der Regierung von Oleg Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnliche Theaterregeln zu bewahren, Moskau bei P. Jurgenson, S.-Petersburg bei I. Jurgenson, Warschau bei G. Zennewald, 1791. / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ, Москва у П. Юргенсона, С.-Петерсбургъ у І. Юргенсона, Варшава у Г. Зенневальда, 1791. — Darin auch: Erklärung zur von Herrn Sarti komponierten Musik für die Historische Handlung: Anfang der Regierung von Oleg, Übersetzung von Nikolaj A. L’vov, S. 4–6 / Объясненіе на музыку Господиномъ Сартіемъ сочиненную для Историческаго представления: Начальное управленіе Олега: перевод Николая А. Львова, С. 4–6.
Benda, Georg Anton: Ariadne auf Naxos. Ein Duodrama mit musikalischen Zwischensätzen, Klavierauszug, hrsg. von Alfred Einstein, Leipzig 1920.
Benda, Jiří Antonín: Medea. Melodram, Praha 1976.
Dobrochotov, Boris V.: Evstignej Fomin, Moskau 1968 / Доброхотов, Борис В.: Евстигней Фомин, Москва 1968.
Findeisen, Nikolaj F.: Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland von der älteren Zeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, Bd. 2, Teile V/VI, Moskau 1928/29 / Финдейзен, Николай Ф.: Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века, Т. 2, Вып. V/VI, Москва 1928/29.
Finagin, Aleksej V.: Evst. Fomin. Leben und Werk, in: Musik und musikalischer Alltag im alten Russland. Materialien und Untersuchungen, Bd. 1, Leningrad 1927 / Финагин, Алексей В.: Евст. Фомин. Жизнь и творчество, в: Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования, Т. 1, Ленинград 1927.
Fomin, Evstignej: Orfeo, hrsg. von Boris Dobrochotov, Moskau 1953 / Фомин, Евстигней: Орфей, ред. Борис Доброхотов, Москва 1953.
Il’ina, Tat’jana V. und Maria N. Ščerbakova: Russisches 18. Jahrhundert: Darstellende Kunst und Musik, Moskau 2004 / Ильина, Татьяна В. и Мария Н. Щербакова: Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка, Москва 2004.
Keldysch, Juri W.: Essays und Untersuchungen über die Geschichte der russischen Musik, Moskau 1978, S. 130–140 / Келдыш, Юрий В.: Очерки и иследования по истории русской музыки, Москва 1978, С. 130–140.
Keldysch, Juri W.: Fomin und das russische Musiktheater des 18. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Musikwissenschaft 9, 3/4 (1967), S. 305–316.
Keldysch, Juri V.: Geschichte der russischen Musik, Bd. 1, Moskau 1990 / Келдыш, Юрий В.: История русской музыки, Вып. 1, Москва 1990.
Küster, Ulrike: Das Melodrama. Zum ästhetikgeschichtlichen Zusammenhang von Dichtung und Musik im 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main u. a. 1994.
Lehmann, Dieter: Russlands Oper und Singspiel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1958.
Lomtev, Denis: Deutsches Musiktheater in Russland, 1. Aufl., Lage-Hörste 2003.
Mooser, Aloys: Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siècle, T. II, Mont-Blanc 1953.
Mühlbach, Marc: Russische Musikgeschichte im Überblick. Ein Handbuch, 1. Aufl., Berlin 2004.
Naroditskaya, Inna: Bewitching Russian Opera. The Tsarina from State to Stage, New York 2012.
Neef, Sigfrid: Fomin, in: MGG2, Bd. 6, Kassel 2001, Sp. 1415–1417.
Rabinovič, Aleksandr S.: Die russische Oper vor Glinka, Moskau 1948 / Рабинович, Александр С.: Русская опера до Глинки, Москва 1948.
Ritzarev, Marina: Eighteenth-Century Russian Music, Cornwall 2006.
Schimpf, Wolfgang: Lyrisches Theater. Das Melodrama des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1988.
Stöckl, Ernst: Nachwort, in: Jakob von Stählin, Zur Geschichte des Theaters in Russland. Nachrichten von der Tanzkunst und Balletten in Russland. Nachrichten von der Musik in Russland, Leipzig 1982.
Taruskin, Richard: Fomin, Yevstigney Ipat’yevich, in: NGroveD, Bd. 9, London 2001, S. 71.
Elisabeth Sasso-Fruth: Das Melodramma in Italien. Felice Romanis Bearbeitungen des »Romeo und Julia«-Stoffes
Das Melodramma in Italien
Felice Romanis Bearbeitungen des »Romeo und Julia«-Stoffes
Elisabeth Sasso-Fruth (HMT Leipzig)
(Übertragungen sämtlicher italienischer und französischer Texte ins Deutsche: Elisabeth Sasso-Fruth)
Il dramma per musica deve
far piangere, inorridire, morire cantando.
(Vincenzo Bellini)
Das auf das Griechische zurückgehende Wort »Melodram« hat, zum Teil mit mehreren Bedeutungen, in viele europäische Sprachen Eingang gefunden. In einer Bedeutung bezeichnet es in zahlreichen Sprachen, etwa im Deutschen und Französischen, eine Gattung, in der Begleitmusik das gesprochene Wort untermalt. Das Italienische hat hierfür den Begriff melologo. Das Wort melodramma dagegen wird im Italienischen, angefangen bei Jacopo Peri und Claudio Monteverdi, durch die Jahrhunderte hindurch synonym zum Begriff für die Oper, opera (in musica) bzw. opera lirica, in ihren unterschiedlichen Ausprägungen verwendet.
I. Felice Romani
Im deutschen Sprachraum ist der Name Felice Romani (1788–1865) heutzutage nahezu in Vergessenheit geraten. Höchstens in Spezialistenkreisen ist er noch geläufig. Dabei war der gebürtige Genuese der meistgefragte Librettist seiner Zeit und gilt als der »Begründer des romantischen melodramma«.[1] Er arbeitete mit den namhaftesten Komponisten des frühen 19. Jahrhunderts zusammen: mit Rossini, Donizetti, Bellini, Mercadante und vielen mehr.
Seine Schaffensperiode als Librettist umfasste zwar nur gut zwanzig Jahre (von 1813 bis 1834), doch war sie mit ca. 90 Libretti sehr intensiv. Der Mittelpunkt seiner Arbeit als Librettist lag in Mailand (am Teatro alla Scala), wo Felice Romani seit 1814 wohnte. Aber auch in Venedig, Parma etc. gelangten seine Werke zur Aufführung.
Sein Ruhm, aber nicht zuletzt auch das Angebot aus Wien, als kaiserlicher Hofdichter in die Fußstapfen Metastasios zu treten, trugen ihm den Beinamen Metastasio redivivo (der wiedererstandene Metastasio) ein.[2] Felice Romani schlug die Einladung allerdings aus, schließlich wollte er nicht die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen. Doch auch hinsichtlich ihrer Libretti (Stoffwahl, sprachliche Bearbeitung etc.) weisen Metastasio und Romani große Unterschiede auf.
II. Felice Romani und Vincenzo Bellini
Besonders eng gestaltete sich die Beziehung zwischen Felice Romani und Vincenzo Bellini, was sich nicht zuletzt in der Intensität ihrer Zusammenarbeit niederschlug. Ihre Begegnung fällt in das Jahr 1827 in Mailand: Romani galt damals schon als der profilierteste Textdichter Italiens, der aus Sizilien stammende und um 13 Jahre jüngere Bellini dagegen stand noch am Anfang seines Schaffens. Von den acht Opern, die Bellini von da an noch komponieren sollte, stammt bei sieben das Libretto aus der Feder Romanis. Das erste Ergebnis ihrer Zusammenarbeit war Il Pirata, die 1827 an der Scala uraufgeführt wurde.
Wie sehr Bellini die Arbeit Romanis schätzte, geht beispielsweise aus einem Brief an seinen Freund Florimo hervor. Während der Arbeit an La Straniera war Romani erkrankt, so dass Gaetano Rossi als Librettist in Erwägung gezogen wurde. Bellini sah dadurch die Qualität der Oper gefährdet:
[…] [Rossi] mai mai potrebb’essere un verseggiatore come Romani, e specialmente per me che sono molto attaccato alle buone parole; ché vedi dal Pirata come i versi e non le situazioni mi hanno ispirato del genio […] e quindi per me Romani è necessario.
[…] [Rossi] könnte niemals ein so guter Versdichter sein wie Romani, vor allem für mich nicht, der ich doch solchen Wert auf eine gute Sprache lege; Du kannst schon am Pirata sehen, wie mich die Verse, und nicht die Situationen, inspiriert haben […] und so ist für mich Romani unabdingbar.[3]
Über der Arbeit an ihrer letzten gemeinsamen Oper, Beatrice di Tenda, kam es wegen der andauernden unpünktlichen Zuarbeit durch den chronisch überlasteten Romani zum Zerwürfnis mit Bellini. Der Streit war in Mailänder und venezianischen Zeitungen öffentlich ausgetragen worden. Obwohl sich Romani und Bellini nach der wenig erfolgreichen Uraufführung der Oper am 16. März 1833 in Venedig brieflich wieder aussöhnten,[4] kam es zu keiner weiteren Zusammenarbeit mehr. Das Libretto für das Pariser Auftragswerk I Puritani – der letzten Oper Bellinis – verfasste Carlo Pepoli (Uraufführung: 24. Januar 1835, Théâtre Italien, Paris). Im September 1835 starb Bellini in Puteaux bei Paris.
Für Romani war der Streit mit Bellini der Anfang vom Ende seiner Karriere als Librettist. 1834 ging er nach Turin, wo er fortan als Journalist arbeitete (zunächst als Direktor der Gazzetta Ufficiale Piemontese); ab 1836 stellte er seine Arbeit als Librettist vollständig ein.
III. Felice Romanis zweifache Beschäftigung
mit dem »Romeo und Julia«-Stoff
Nach Il pirata (Uraufführung: 27. Oktober 1827, Teatro alla Scala, Mailand), La straniera (Uraufführung: 14. Februar 1829, Teatro alla Scala, Mailand), und Zaira (Uraufführung: 16. Mai 1829, anlässlich der Einweihung des Teatro Ducale, Parma), ist I Capuleti e i Montecchi (Uraufführung: 11. März 1830, Teatro La Fenice, Venedig) die vierte Oper, die auf die Zusammenarbeit Vincenzo Bellinis mit Felice Romani zurückgeht. Später folgten La Sonnambula (Uraufführung: 6. März 1831, Teatro Carcano, Mailand), Norma (Uraufführung: 26. Dezember 1831, Teatro alla Scala, Mailand) und Beatrice di Tenda (Uraufführung: 16. März 1833, Teatro La Fenice, Venedig).[5]
Im Januar 1830 erhielt Bellini vom Teatro La Fenice di Venezia den Auftrag, eine Oper zu komponieren, deren Datum für die Uraufführung in der laufenden Karnevalssaison bereits auf den 11. März 1830 festgesetzt war.[6] Bellini und Romani standen also unter enorm hohen Zeitdruck. So ist es verständlich, dass sie beide für die neue »Romeo und Julia«-Oper, die Bellini dem Impresario der Fenice, Alessandro Lanari, vorgeschlagen hatte, auf schon erarbeitetes Material zurückgreifen: Bellini verwendete teilweise seine Melodien aus Zaira neu, Romani dagegen zog für seine Arbeit sein eigenes Libretto Romeo e Giulietta heran, das 1825 von Nicola Vaccai vertont und unter diesem Titel im Teatro alla Canobbiana in Mailand uraufgeführt worden war. Für Romani war es also innerhalb von fünf Jahren das zweite Mal, dass er sich mit dem »Romeo und Julia«-Stoff beschäftigte. Doch trotz des Rückgriffs auf schon vorhandenes Material sollte etwas Neues entstehen. So schrieb Bellini am 20. Januar 1830 an seinen Freund Florimo:
Il libro, Romani che già jeri è qui giunto, mi scriverà da nuovo Giulietta e Romeo, ma lo titolerà diversamente, e con diverse situazioni.
Das Buch, Giulietta e Romeo, das wird mir Romani, der gestern hier eingetroffen ist, neu schreiben, aber mit einem anderen Titel und anderen Situationen.[7]
So war also schon vor Beginn der Arbeit an der neuen Oper eine weitgehende Neuschöpfung gegenüber dem Vaccai-Libretto intendiert. Obwohl dieses als Grundlage für die neue Oper diente, sollten – mit neuem Titel und neuen Situationen – doch auch wesentlich neue Akzente gesetzt werden.
IV. Neuer Titel, neue Situationen:
Romanis Arbeiten für Vaccai und Bellini im Vergleich
Romanis »Romeo und Julia«-Libretti
vor dem Hintergrund der Stoffgeschichte
und zeitgenössischer Produktionen
Seit seinem Aufkommen in der italienischen Novellistik des 15. Jahrhunderts stieß der Stoff von Romeo und Julia auf großes Interesse seitens der Autoren und des rezipierenden Publikums, welches sich spätestens ab dem 16. Jahrhundert nicht mehr nur auf Italien beschränkte.[8] So sind auch die beiden Bearbeitungen des Stoffes durch Felice Romani als Glieder in einer europaweiten Reihe von Werken zu sehen, die sich mit der Geschichte der beiden Liebenden aus Verona auseinandersetzten.
Im ausgehenden 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren auf italienischen Bühnen mehrere neue Fassungen des »Romeo und Julia«-Stoffes aufgeführt worden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in Zusammenhang mit unserem Thema zunächst die Sprechtheaterfassungen, die auf zwei französischsprachige Autoren zurückgehen. Das Stück von Jean-François Ducis, Roméo et Juliette, tragédie imitée de l’Anglais (1772), wurde mindestens zweimal ins Italienische übersetzt.[9] Von der Tragödie von Louis-Sébastien Mercier, Les Tombeaux de Vérone, drame en 5 actes (1782), liegen ebenfalls mindestens zwei italienischsprachige Versionen vor.[10] Beide Stücke erfreuten sich in ihren italienischen Fassungen beim italienischsprachigen Publikum großer Beliebtheit und sollten, wie später zu zeigen sein wird, auch auf Romanis Schaffen Einfluss nehmen.
Obwohl Ducis im Untertitel seines Stückes darauf verweist, dass sich sein Werk an englischsprachigen Vorbildern orientiert, ist seine Tragödie nicht in der Tradition William Shakespeares zu sehen, der mit seiner Bearbeitung des »Romeo und Julia«-Stoffes im Jahr 1595 maßgebliche neue Akzente weit über den englischen Sprachraum hinaus gesetzt hatte. Während bei Shakespeare die Kerngeschichte um die beiden Titelhelden durch zahlreiche Nebenhandlungen mit durchaus auch komischen Zügen angereichert wird – was eine beträchtliche Erhöhung der Zahl der dramatis personae[11] gegenüber Vorläufermodellen zur Folge hatte –, reduziert Ducis die Handlung wieder auf ihre wesentlichen Momente und kommt so mit entsprechend wenigen Personen aus. Mercier folgt diesbezüglich dem Beispiel von Ducis. Auch bei ihm ist die Anzahl der Figuren gering gehalten, die Handlung konzentriert sich auf ihre wesentlichen Momente. Eine weitere, den beiden französischen Dramen gemeinsame Abweichung gegenüber Shakespeare besteht darin, dass sich in beiden die Handlung um eine ›Nebenfigur‹ zentriert: Bei Ducis steht Romeos Vater im Mittelpunkt,[12] bei Mercier dagegen Benvoglio, der als Arzt und Mitwisser um die Liebe der beiden Protagonisten die Funktion des namentlich seit der Novelle Luigi da Portos als Pater Lorenzo eingeführten Mönches übernimmt, auf dessen Initiative der Rettungsversuch für die Liebe Romeos und Julias zurückgeht.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten setzen die beiden französischen Sprechtheaterstücke aber durchaus auch unterschiedliche Akzente: so erfährt bei Ducis der Stoff eine deutliche Politisierung, der Streit der Familien wird bei ihm in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen Guelfen und Ghibellinen im Italien des 13. Jahrhunderts gebracht.[13] Eine Einbettung des Konfliktes in einen historischen politischen Kontext ist dagegen bei Shakespeare nicht intendiert, vielmehr unterstreicht dieser im Prologsonett mit dem Begriff mutiny die Belanglosigkeit des Anlasses für den Streit zwischen Capuleti und Montecchi.[14] Auch bei Mercier wird der Konflikt der beiden Häuser nicht vor dem Hintergrund des politischen Geschehens gesehen. Eine Besonderheit des Dramas Merciers liegt dagegen im glücklichen Ausgang, den der düstere Titel zunächst nicht suggeriert. Die zentrale Figur, der moralisierende Menschenfreund Benvoglio, überzeugt nicht nur die Familienoberhäupter, in die Heirat ihrer Kinder einzuwilligen, er wird darüber hinaus auch zum Garanten eines stabilen Friedens zwischen beiden Häusern.[15] Bei Ducis dagegen endet die Geschichte tragisch mit dem Tod der beiden Protagonisten. Trotz auch voneinander abweichender Akzentuierungen lässt sich also festhalten, dass sich das französische Sprechtheater des ausgehenden 18. Jahrhunderts, das um die Jahrhundertwende in Italien rezipiert wird, insgesamt von Shakespeare distanziert und auf Traditionen rückbesinnt, wie sie die italienische Novellistik schon vorgezeichnet hatte (Kernhandlung, reduzierte Anzahl von Figuren).
Doch nicht nur die Bühnen der Sprechtheater bekundeten um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert ihr Interesse am »Romeo und Julia«-Stoff, vielmehr datieren aus dieser Zeit auch die ersten Adaptionen für die Bühnen des Musiktheaters. Den Auftakt hierzu bildete das fünfaktige Ballett Giulietta, [sic!] e Romeo. Ballo tragico-pantomimo von Filippo Beretti nach Musik von Luigi Marescalchi (Uraufführung im Frühjahr 1785, Nuovo Regio-Ducal Teatro, Mantua).[16] Elf Jahre später, am 30. Januar 1796, fand an der Scala von Mailand die Uraufführung der Oper Giulietta e Romeo statt, die Nicola Zingarelli, der spätere Lehrer von Vincenzo Bellini am Konservatorium von Neapel, auf das Libretto von Giuseppe Maria Foppa komponiert hatte.[17]
Die folgende Synopsis zu Titel und Personenzahl insgesamt sowie die vergleichende Auflistung der einzelnen Personen geben Aufschluss, wie sehr im Opernlibretto Giuseppe Maria Foppas und den beiden Versionen Felice Romanis für Vaccai und Bellini die Stoffbearbeitungen, die auf das französischen Sprechtheater, insbesondere auf Mercier,[18] zurückgehen, nachwirken bzw. wo die Opernlibrettisten dieser Tradition gegenüber neue Akzente setzen.
Synopse zu Titeln und Personen in Sprech- und Musiktheater-Libretti
des »Romeo und Julia«-Stoffes
am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
(Die gleiche Tabelle als PDF.)
Titel
Die Titel führen, wie schon fast immer in der älteren Tradition sowie auch bei Shakespeare und Ducis, zumeist die Namen der beiden Liebenden. Wie bereits erwähnt, setzt Mercier mit seinem Titel Les Tombeaux de Vérone (Die Grabmale von Verona) einen düsteren Akzent, den er aber durch das lieto fine am Schluss überraschend konterkariert. So stellte sich bezüglich seines Stückes auch schnell die Gattungsfrage.[19] Romani beschreitet mit seinem Titel für das Vaccai-Libretto (im Folgenden: FR I) zunächst den Pfad der Tradition. Dagegen signalisiert er mit dem neuen Titel für das Bellini-Libretto (im Folgenden: FR II), dass der Opernbesucher etwas Neues gegenüber seiner Erstfassung des Stoffes von 1825 zu erwarten habe. – Die Namen der beiden Familien gehen auf den sechsten Gesang des Purgatorio der Divina Commedia (Verse 106–108) von Dante Alighieri[20] zurück, doch finden sich bei Dante keine Hinweis auf die Geschichte der beiden Liebenden,[21] mit der diese Namen später[22] verbunden wurden. Auch eine Verbindung zu dem Konflikt zwischen Ghibellinen und Guelfen wird von Dante nicht ausdrücklich hergestellt,[23] sie liegt nur insofern nahe, als dieser Canto insgesamt stark auf zeitpolitische Geschehnisse Bezug nimmt. Vor dem Hintergrund, dass Ducis aber Julias Familie, die Capuleti, und die von Romeo, die Montecchi, den unterschiedlichen politischen Lagern im Italien des 13. Jahrhunderts zugeordnet hatte – was dem italienischen Publikum im frühen 19. Jahrhundert noch präsent gewesen sein dürfte –, gewinnt die Neubetitelung durch Romani an Brisanz, evoziert sie doch mit den beiden Familiennamen sogleich den politischen Hintergrund des Italien des 13. Jahrhunderts. Dieser war zwar auch schon bei FR I klar gegeben, doch ist der Handlungsstrang der Liebe von Romeo und Julia mit dem der politisch bedingten Fehde zwischen den Guelfen (Capuleti) und den Ghibellinen (Montecchi) in FR II vom Beginn der Oper an konsequenter und geschickter verwoben.[24]
Gesamtzahl der Personen
Vom französischen Sprechtheater hin zu FR II ist eine Reduzierung der Gesamtzahl der Personen festzustellen, wobei diese aber von vornherein gering ist. Man vergleiche in diesem Zusammenhang die Anzahl der dramatis personae bei Shakespeare: Escalus, Prince of Verona – Mercutio, kinsman of the Prince and friend of Romeo – Paris, a young count, kinsman of the Prince and Mercutio, and suitor of Juliet – Page of Count Paris – Montague, head of a Veronese family at feud with the Capulets – Lady Montague – Romeo, son of Montague – Benvolio, nephew of Montague and friend of Romeo and Mercutio – Abram, servant of Montague – Balthasar, servant of Montague attending on Romeo – Capulet, head of a Veronese family at feud with Montagues – Lady Capulet – Juliet, daughter of Capulet – Tybalt, nephew of Lady Capulet – An old man of the Capulet family – Nurse of Juliet, her foster-mother – Peter, servant of Capulet attending on the Nurse – Sampson, Gregory, Anthony, Potpan, a Clown, Servingmen: of the Capulet household – Friar Laurence, a Franciscan – Friar John, a Franciscan – An Apothecary of Mantua – Three Musicians (Simon Catling, Hugh Rebeck, James Soundpost). – Members of the Watch – Citizens of Verona, maskers, torchbearers, pages, servants – Chorus.[25]
Die Väter
Die wie auch immer begründete Fehde zwischen den beiden Familien konfrontierte in der Tradition zunächst vor allem deren Oberhäupter, also die beiden Väter. Bei Ducis avancierte Romeos Vater sogar zur zentralen Figur des Stückes,[26] in FR I dagegen fällt dem Vater Julias die zentrale, da die Handlung im Wesentlichen bestimmende, Rolle zu. Das Ballett von Beretti und Marescalchi brachte noch beide Väter auf die Bühne, in den Opernlibretti von Foppa und Romani dagegen taucht der Vater von Romeo nicht mehr auf. Dies hat Konsequenzen für die Gestaltung der Figur des Romeo, der in allen drei Libretti als der einzige Vertreter der Montecchi auf der Bühne nicht nur der tragisch Liebende, sondern auch der (politische) Anführer seiner Familie ist. Diese handlungsstrategische Doppelfunktion der Figur gestattet in den beiden Versionen von Romani die Engführung der Liebes- mit der politischen Handlung, die, wie bereits erwähnt, in FR II stringenter und überzeugender erfolgt als in FR I.
Die Mutter und die Vertraute Julias
Während bei Mercier noch beide Positionen besetzt sind, fallen sie bei FR II ganz weg; Foppa und FR I dagegen arbeiten mit der einen oder der anderen Figur. In der Funktion sind sich die Vertraute und die Mutter der Julia ähnlich und auch ähnlich schwach: sie treiben die Handlung nicht voran und sind dadurch leicht austauschbar (Indiz hierfür ist auch derselbe Name für die Mutter Julias bei Mercier und für die Vertraute bei Foppa) oder gar zu eliminieren. Als wohlgesinnte Gesprächspartnerinnen Julias stellen sie strategisch eine Erweiterung der Figur der Julia dar, ohne ein wirklich ›eigenes Gesicht‹ zu bekommen. Mit ihrer Einfühlsamkeit bildet die Figur der Mutter der Julia auch einen Gegenpart zu ihrem Gatten, sie ist aber auch in diesem Zusammenhang auf eine andere, zentral handlungsbestimmende Figur, ihren Ehemann, hin ausgerichtet und erlangt kein richtiges Eigenleben.
»Te(o)baldo«
In dieser Figur fließen in den drei Opernlibretti zwei handlungsstrategisch wichtige Funktionen zusammen, die in der Tradition auf zwei Figuren aufgeteilt waren, von denen häufig eine als Bruder oder Vetter in verwandtschaftlichem Verhältnis zu Julia steht. Dieser nahe Verwandte wird in der Regel von Romeo getötet – was den Konflikt zwischen den verfeindeten Häusern neu entfacht und quasi unüberbrückbar macht.[27] Die zweite Funktion besteht darin, dass diese Figur, meist[28] aus der Gefolgschaft der Capuleti, der vom Vater Julias für seine Tochter auserkorene Bräutigam ist. Während bei Mercier diese Figur fehlt und auch mit nur einer der beiden Hauptfunktionen als Teil der Vorgeschichte die Handlung mitbedingt (Romeo hat Tebaldo getötet, daraufhin soll er ins Exil gehen, wovor ihn Benvoglio bewahrt, indem er ihn versteckt), gehen von der Figur des – nicht mit Julia verwandten – Tebaldo mit Elementen aus den beiden Funktionen in den Opernlibretti von Foppa und Romani immer wieder Impulse für den Handlungsverlauf aus. Dies trifft insbesondere für FR II zu.
Der ›Helfer‹ für Romeo und Giulietta
In der Tradition ist diese Figur entweder nur einer oder sogar beiden Familien freundschaftlich verbunden. Sofern sein Beruf genannt wird, ist der Helfer meist ein Mönch, gelegentlich auch Arzt, und trägt fast immer den Namen Lorenzo.[29] Möglicherweise bewog die Bedeutung des sprechenden Namens Benvoglio, »der das Gute will«, Mercier dazu, dem ›Gutmenschen‹ als der zentralen Figur seines moralisierenden Stückes den bei Shakespeare schon für eine Figur aus dem Lager der Montecchi verwendeten Namen zu geben. Schließlich beabsichtigt der Helfer in Merciers Version nicht nur das Gute, sondern bewirkt es am Ende sogar noch erfolgreich im lieto fine. Nicht in der Stofftradition begründet ist dagegen die Wahl des Namens »Gilberto« bei Foppa. Romani lehnt sich mit »Lorenzo« in beiden Libretti wieder stark an die Tradition an. – Durch seinen gut gemeinten, jedoch (in den meisten Versionen) verhängnisvoll verlaufenden Hilfsplan wird »Lorenzo« zum Verursacher des tragischen Endes der beiden Liebenden, in der Regel aber auch zugleich zum Begründer des Friedens zwischen den beiden Familien.
Romeo und Julia
Die beiden Liebenden, Sprösse zweier verfeindeter Familien aus Verona. In die Figur des Romeo fließt, je nachdem, ob die Rolle seines Vaters besetzt ist, auch die Funktion der politischen Führerschaft der Montecchi ein.
Strategien der Handlungsführung
in Felice Romanis »Romeo und Julia«-Libretti
In seinem Schreiben an Florimo vom 20. Januar 1830 hatte Bellini seinem Freund neben einem neuen Titel für die neue Oper auch angekündigt, dass Romani gegenüber dem Vaccai-Libretto an den Situationen ebenfalls Veränderungen vornehmen werde.[30] Im Folgenden sollen anhand dreier Beispiele Unterschiede in der Handlungsführung in FR I und FR II aufgezeigt werden.
Erstes Beispiel – das Duett von Romeo und Giulietta im ersten Akt
In beiden Libretti kommt es mit Hilfe Lorenzos im zweiten Bild des ersten Aktes jeweils zu einer heimlichen Begegnung Romeos und Giuliettas in deren gabinetto (Gemächern) (FR I: I, (6) 7–8; FR II: I, (5) 6). Während Romeo jeweils im ersten Teil des ersten Aktes bereits aufgetreten war, fällt der erste Auftritt Giuliettas bei beiden Versionen in den zweiten Teil. In FR I fällt er mit der Duettszene zusammen, während er in FR II dieser mit Rezitativ und Arie Eccomi in lieta vesta – Oh quante volte (FR II: I, 4) vorausgeht.
Der erste Auftritt Giuliettas erfüllt in FR II die Funktion, dem Publikum die weibliche Protagonistin in ihrer verzweifelten Lage vorzustellen und somit auch die folgende Duettszene vorzubereiten. Die Situation Giuliettas ist nicht nur verzweifelt, die Gefahr für sie ist auch imminent: schon ist sie als Braut gekleidet (»in lieta vesta« – »im Festkleid«), doch anstatt Freude über ihre bevorstehende Hochzeit zu empfinden, fühlt sie sich als Opfer (»vittima«), soll sie doch auf Wunsch des Vaters den ungeliebten Tebaldo heiraten, während derjenige, dem ihre Liebe gilt, als Feind ihrer Familie für sie als Bräutigam aus politischem Kalkül nicht in Frage kommt. Angesichts dieses Dilemmas lädt Giulietta in ihrem Wunschdenken die für die Trauungszeremonie bereitgestellten Gegenstände semantisch negativ auf, empfindet sie doch den ihr aufgezwungenen Weg als Braut zum Traualtar als den eines Opfers zum Opferaltar, wobei sie bei dieser imaginierten Alternative die Option ›Opfer‹ vorzieht und sich also die Hochzeitsfackeln (»nuziali tede«) als Fackeln ihres Todes (»faci ferali«) wünscht. Diese in nur wenigen Worten skizzierte Verzweiflung mündet noch im Rezitativ in den Ruf nach Romeo; in der anschließenden Arie bringt Giulietta ihre Sehnsucht nach dem (unerreichbar fern geglaubten) Geliebten zum Ausdruck.
Auch bei FR I wird das Publikum im Vorfeld des Duetts mit der verzweifelten Lage Giuliettas vertraut gemacht, doch fällt seine Konfrontation mit dem Unglück Giuliettas wesentlich sanfter aus. Dies liegt zum einen daran, dass sich Giulietta nicht selbst mitteilt, sondern der Zuschauer indirekt, zunächst aus einem Gespräch zwischen Lorenzo und Romeo (FR I: I,4) und dann aus Äußerungen der um ihre (in diesem Moment schlafende!) Tochter besorgten Mutter Adele (FR I: I,5), von Giuliettas Leid (»i suoi mali«) erfährt. Dieses erschöpft sich in diesen beiden Szenen außerdem auch in Giuliettas Sehnsucht nach Romeo und ihrem Leiden unter der Trennung – von der bevorstehenden Hochzeit aber muss sie in FR I an dieser Stelle erst noch in Kenntnis gesetzt werden, bittet doch Adele Lorenzo, die Tochter über die Entscheidung ihres Vaters aufzuklären.
In der nächsten Szene (FR I: I,6 und FR II: I,5) führt Lorenzo jeweils Romeo durch eine Geheimtür (»uscio segreto«) zu der von dem Wiedersehen völlig überraschten Giulietta. Während sie aber bei Bellini ihrem Geliebten im Brautkleid gegenüber steht, unterstreicht das Libretto für Vaccai ihre nachlässige Kleidung, hatte sie doch gerade noch geschlafen (»ella è vestita neglettamente« – »sie ist nachlässig gekleidet«). Nachdem sich die beiden Liebenden in die Arme gefallen sind, verlässt Lorenzo diskret Giuliettas Gemächer.
Das nun folgende Duett erstreckt sich in FR I über zwei Szenen, während es in FR II nur eine umfasst (FR I: I,7–8; FR II: I, 6). Die Aufteilung auf zwei Szenen bei Vaccai ist durch den Auftritt Lorenzos in der achten Szene bedingt, der die Liebenden aufsucht, um sie vor einer Gefahr zu warnen – ist doch Capellio auf dem Weg zu Giuliettas Gemach. Auch bei Bellini wird das Gespräch des Paares gestört: In der Ferne ist festliche Musik (nämlich die Hochzeitsmusik für Giuliettas Trauung) zu hören (»Odesi festiva musica da lontano«). Obwohl sich das Duett bei Bellini nur über eine Szene erstreckt, ist der Text in seiner Version allerdings erheblich länger als bei Vaccai. Dabei fällt vor allem die sehr unterschiedliche Länge der beiden Texte nach dem jeweiligen Störmoment auf.
Neben der in beiden Versionen vorhandenen Unterbrechung bzw. Störung des Dialoges weisen die beiden Duette aber auch am Anfang Parallelen auf. So mischen sich in die anfängliche übergroße Wiedersehensfreude die Erinnerungen an die leidvollen Tage der Trennung. Doch in der Folge nehmen die beiden Duette einen unterschiedlichen Verlauf. Zunächst zur Entwicklung des Gespräches bei Vaccai:
[I,7]
[…]
Romeo:
Ah! che divisi ognor / Ach! andauernd getrennt
non languirem così; / werden wir nicht mehr leiden;
a noi sereni ancor / frohe Tage sind uns bestimmt,
serban fortuna i dì. / die noch Glück für uns bereit halten.
Ma sia pur barbara / Doch wenn auch das Schicksal
con me la sorte, / grausam zu mir sein sollte,
potrà dividerci / vermag uns doch nur
la sola morte. / der Tod zu trennen.[…]
Romeo:
Il crudele l’esige invano / Der Grausame verlangt dies vergebens,
a noi scampo amor darà. / die Liebe wird uns retten.A 2: / Beide:
Ah più diletto / Ach, keine Freude
non spero in terra, / erhoffe ich mir mehr auf Erden,
eterna guerra / ewigen Krieg
ci giura amor. / verheißt uns die Liebe.
[I,8]
Lorenzo:
[…] a questa stanza […] Capellio
Volge Capellio il piè … / ist im Anmarsch…Giulietta:
Fuggi… ti salva… / Flieh… bring dich in Sicherheit…
Non esitar… / Zaudere nicht…Romeo:
Odimi in pria… / Hör mich erst noch an…
Nach der eingangs von beiden zum Ausdruck gebrachten Wiedersehensfreude und dem Rückblick auf das Leid fern vom anderen richtet Romeo seinen Blick auf die Zukunft: Ob ihre Tage von Glück (»fortuna«) geprägt sein werden oder ihnen ein grausames Schicksal (»barbara […] sorte«) bereithalten sollten, nie wieder wird das Paar sich trennen lassen, dies kann nur der Tod (»morte«) bewirken. Selbst angesichts der größten Bedrohung für das Paar, die Giuliettas Vater (»Il crudele« – »der Grausame«) verkörpert, der seine Tochter mit einem anderen vermählen möchte,[31] wissen die beiden sich von der Macht und Kraft der Liebe geschützt (»a noi scampo amor darà«). Allerdings ist das erhoffte Glück des gemeinsamen Lebens noch zu fern; sie ahnen, dass ihr Leben sich wohl zu einem ewigen Krieg (»eterna guerra«) um ihrer Liebe willen gestalten wird, so dass sie am Schluss der Szene ihrer Hoffnungslosigkeit Ausdruck verleihen (»più diletto non spero in terra«).
Obwohl die gegenwärtigen Hindernisse für die Realisierung des gemeinsamen Glückes sehr greifbar sind, richten die Liebenden ihren Blick vor allem auf ihr Leben in der Zukunft. Sie sprechen dabei in abstrakten Termini und überantworten ihr Schicksal höheren Mächten. Insofern haftet dem Dialog in I,7 etwas Träumerisches an, denn trotz der konkreten Gefahr (Giulietta soll Tebaldo ehelichen) wird kein konkreter Plan formuliert. Nach der Unterbrechung des Gespräches durch das Herannahen Capellios (I,8) allerdings sind die Liebenden gezwungen, auf der Stelle zu handeln: Giulietta fordert Romeo zur sofortigen Flucht auf, doch hebt Romeo in diesem Augenblick zu einem letzten Diskurs an: »Odimi in pria…«. Will er seiner Geliebten an dieser Stelle einen konkreten Handlungsplan unterbreiten? Diese Frage bleibt offen, schaltet sich doch Lorenzo ein zweites Mal mit der Aufforderung an Romeo zu gehen in das Gespräch ein, der dieser nun Folge leistet.
Nun zum Duett Romeo – Giulietta bei Bellini:
Romeo:
[…]
vengo,vengo a morir deciso, / ich komme, komme, entschlossen zu sterben,
o a rapirti per sempre ai tuoi nemici. / oder dich für immer deinen Widersachern zu entreißen.
Meco fuggir dêi tu. / Du musst mit mir fliehen.Giulietta:
Fuggire? Che dici? / Fliehen? Was sagst du da?
Romeo:
Sì, fuggire: a noi non resta / Ja, fliehen: in dieser äußersten Not
altro scampo in danno estremo / bleibt uns kein anderer Ausweg[…]
Giulietta:
Ah! Romeo! Per me la terra / Ach, Romeo! Für mich ist die Welt
è ristretta in queste porte: / auf diese Räume beschränkt:[…]
Qui m’annoda, qui mi serra / Hier bindet mich und schließt mich
un poter d’amor più forte. / eine stärkere Macht als die Liebe ein.
Solo, ah! solo all’alma mia / Nur, ach! nur meiner Seele
venir teco il ciel darà / wird der Himmel gestatten, mit dir zu ziehen[…]
Romeo:
Che mai sento? E qual potere / Was höre ich da? Und was für eine Macht
è maggior per te d’amore? / ist für dich stärker als die Liebe?Giulietta:
Quello, ah! quello del dovere, / Die, ach! die der Pflicht,
della legge, dell’onor, sì, sì, dell’onore. / des Gesetzes, der Ehre, ja, ja, der Ehre.[…]
(Odesi festiva musica di lontano.) / (In der Ferne ist festliche Musik zu hören)
Romeo:
Odi tu? L’altar funesto / Hörst du? Schon wird der unheilvolle Altar
Già s’infiora, già t’attende. / mit Blumen geschmückt und erwartet dich.Giulietta:
Fuggi, va. / Flieh, geh.
Romeo:
No, teco io resto. / Nein, ich bleibe bei dir.
[…]
Im Unterschied zum Duett in der Vaccai-Version präsentiert sich Romeo bei Bellini nach der gemeinsamen Wiedersehensfreude unumwunden mit der Alternative, die sich für ihn im textimmanenten Hier und Jetzt stellt. Er ist fest entschlossen, entweder zu sterben (»morire«) oder Giulietta für immer ihren (und seinen) Feinden zu entreißen (»rapirti per sempre ai tuoi nemici«), um anschließend mit ihr zu fliehen (»fuggir«). Durch dieses Ansinnen Romeos wird wiederum Giulietta vor eine Handlungsalternative gestellt, nämlich entweder Romeo Folge zu leisten oder ihrem Vater zu gehorchen. Sie fühlt sich in ihrem Inneren dem Konflikt zweier widerstreitender Mächte (»potere«) ausgesetzt, nämlich zwischen der Liebe (»amore«) und der Pflicht (»dovere«). Letztere wird weiter konkretisiert: Giulietta weiß sich in der Pflicht gegenüber dem Gesetz (»legge«) und der Ehre (»onore«).
Das Dilemma, vor dem Giulietta steht und das Romani mit den Wörtern »amore« und »dovere« sehr deutlich zitiert, ist der Konflikt schlechthin, in dem sich die Helden der klassischen französischen Tragödie des 17. Jahrhunderts befinden (amour vs. devoir) und auf dem die Handlung der jeweiligen Tragödie basiert. Die klassische französische Tragödie fand im Italien des 18. Jahrhunderts im Werk Vittorio Alfieris[32] eine Fortsetzung. Romani war mit der langen Tradition der klassischen Literatur nicht nur bestens vertraut, er hatte sich, teilweise noch vor seiner Tätigkeit als Librettist, immer wieder durch Veröffentlichungen[33] oder in literarischen Debatten als Verfechter der klassischen Ideale hervorgetan und gegen romantische Strömungen Position bezogen.[34]
Während für Romeo unbestritten die Liebe (»amore«) überwiegt, stellt für Giulietta die Pflicht (»dovere«) eine stärkere Macht als die Liebe dar (»un poter d’amor più forte«). Über dieser Frage der Gewichtung kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Liebenden, die erst durch das Erklingen der festlichen Musik in der Ferne (»festiva musica«) unterbrochen wird. Dieses lässt in Kürze das Kommen des Vaters erwarten, und so fordert Giulietta, wie schon in FR I, Romeo zur Flucht auf (»fuggi, va«). Doch im Gegensatz zu FR I, wo Romeo dieser Aufforderung ziemlich schnell nachkommt, beharrt er in der Version von Bellini auf der Klärung des Konflikts mit Giulietta, weswegen er bei ihr bleiben will (»No, teco io resto«) und wofür er sich sogar schon in diesem Moment zu sterben bereit erklärt. In dieser nach dem Störmoment durch die festliche Musik weiter ausgetragenen Diskussion liegt die unterschiedliche Länge der Duette in FR I und FR II begründet: Romeo wirft Giulietta ihre Unbeugsamkeit vor, Giulietta bittet ihn, nachzugeben – was er dann letztlich tut, bezwungen durch Giuliettas Bitten (»vinto dalle preghiere di Giulietta«).
Im Unterschied zu der Vaccai-Version befassen sich die beiden Protagonisten bei Bellini also konkret und durchaus kontrovers mit der Lösung ihres Problems. Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und überantworten es nicht abstrakten Mächten. Den Figuren haftet trotz ihrer großen Sehnsucht nach einem gemeinsamen Leben nichts in dem Maße wie bei Vaccai Träumerisches an, vielmehr scheinen sie pragmatischer und real(istisch)er und damit für den Zuschauer auch ›greifbarer‹ zu sein als bei Vaccai.
Zweites Beispiel – die Figur des Tebaldo
Sowohl bei Vaccai als auch bei Bellini ist Tebaldo der von Capellio für Giulietta auserkorene Ehemann. In beiden Versionen will Capellio mit der Hand seiner Tochter Tebaldo für seine treuen Dienste belohnen und damit zugleich dem Angebot des Unterhändlers der Montecchi (der der verkleidete Romeo selbst ist) eine Absage erteilen, in dem den Capuleti der Vorschlag unterbreitet wurde, mit der Heirat Romeos und Giuliettas den Streitigkeiten zwischen den beiden Häusern für immer ein Ende zu setzen.[35] Der Figur des Romeo, die in sich, wie oben dargelegt, zwei Funktionen vereint, nämlich die des politischen Anführers der Montecchi und die des Liebenden, sind im Lager der Capuleti zwei Gegenspieler zugeordnet: Capellio als der Anführer der politischen Gegner, und Tebaldo als der Rivale um Giulietta.
Neben diesen Parallelen in FR I und FR II weist der Tebaldo-Handlungsstrang in den beiden Versionen allerdings auch große Unterschiede auf. So ist bei Vaccai Tebaldo von Beginn der Oper an als der ›verlängerte Arm‹ des Capellio dargestellt und charakterlich an diesen angelehnt. Als Romeos Gegenspieler um die Hand Giuliettas wird er – zwischen dem ersten und zweiten Akt, also hinter den Kulissen – im Duell von Romeo getötet. Dass Romeo seinen Rivalen um Giulietta tötet, entspricht der Stofftradition. Wenn Lorenzo zu Beginn des zweiten Akts Giulietta seinen Plan erläutert, sind bereits alle über Tebaldos Tod informiert. Giuliettas Motivation, sich auf den Plan Lorenzos einzulassen, ist also nicht, der Hochzeit mit Tebaldo zu entgehen, sondern der Wut des Vaters (der sie wahrscheinlich in ein Kloster stecken würde):
Lorenzo:
E non temi / Und fürchtest du nicht
L’ira paterna? / Den Zorn deines Vaters?Giulietta:
A lui sottrarmi io spero / Ich hoffe, mich ihm zu entziehen,
Col tuo favor, e a pien mutar sorte. / Mit deiner Hilfe, und mein Schicksal völlig zu ändern.
Bei Bellini wird zwar ebenfalls die Vermählung von Tebaldo mit Giulietta von Capellio betrieben, doch zeichnet Romani in dieser Version Tebaldo von Beginn der Oper an als eine Figur, die tatsächlich zärtliche Gefühle für Giulietta hegt. Auch hier kommt es zum Duell zwischen den beiden Rivalen, das aber auf der Bühne stattfindet (II,6). Lorenzos Intrige wurde schon vor dem Duell der beiden eingeleitet (II,2), die Motivation der Giulietta lag darin begründet, dass sie sich so der Heirat mit Tebaldo entziehen wollte. Das Duell von Romeo und Tebaldo wird unterbrochen durch die Trauermusik, die den vorüber ziehenden Leichenzug der (scheintoten) Giulietta begleitet. An dieser Stelle wird in FR II nun zum zweiten Mal eine entscheidende Auseinandersetzung zwischen zwei Figuren durch die musikalische Untermalung eines wichtigen Ereignisses unterbrochen: War es im Duett Romeo – Giulietta im ersten Akt die Musik für die Hochzeit Giuliettas mit Tebaldo, ist es jetzt die Trauermusik anlässlich ihres vermeintlichen Todes.
Die beiden Gegner nehmen das Duell auch nicht wieder auf. Vielmehr entsteht aus der von beiden empfundenen Trauer eine verbale Auseinandersetzung, in der Romeo Tebaldo den Tod Giuliettas zum Vorwurf macht und dieser – plötzlich zur Einsicht in seine Mitschuld gelangt – sich daraufhin untröstlich in Selbstvorwürfen ergeht. Ihr Dialog kreist um die Frage, wessen Leid das größere sei, und gipfelt darin, dass jeder nun sterben möchte. Tebaldo, gerade noch Romeos Duellgegner, ist aber nun nicht mehr in der Lage, den untröstlichen Romeo, der ihn darum bittet, zu töten.
Obgleich es hier nicht zu einer expliziten Aussöhnung der Duellanten kommt, liegt doch eine Deutung der Szene in diese Richtung nahe. In der Tradition endet die Geschichte von Romeo und Julia in der Regel mit der Versöhnung der beiden verfeindeten Familien über dem Grab ihrer Kinder. Diese geschieht bei Romani in keiner der beiden Versionen.[36] Doch während in FR I das Ende so unversöhnlich ist wie schon der ganze Handlungsverlauf von Anfang an, kündigte sich in der Figur des liebenden Tebaldo bei FR II auf der Seite der Capuleti seit Beginn die Möglichkeit eines Einlenkens an. Trotzdem ihr Schmerz auch unterschiedliche Aspekte aufweist, eint Romeo und Tebaldo doch die Trauer um die tot geglaubte Giulietta, die ihnen eine Fortsetzung des Streites, hier des Duells, nicht möglich macht.
Drittes Beispiel – die Schlussszene
Die Tradition des »Romeo und Julia«-Stoffes kennt zwei Grundvarianten für die Schlussszene. In der einen Variante, die etwa bei Shakespeare zu finden ist, nimmt Romeo in der Gruft an der Seite der vermeintlich toten Julia das tödliche Gift zu sich und stirbt daran. Als Julia erwacht, fällt ihr Blick auf den toten Romeo und sie ersticht sich mit Romeos Dolch. In der anderen Variante, wie sie beispielsweise die italienische Novellistik bevorzugt, erwacht Julia, noch bevor Romeo stirbt. Es kommt zu einem dramatischen Dialog zwischen den beiden Liebenden, dann stirbt Romeo an den Folgen des Giftes, kurz darauf stirbt Julia.[37]
Für das Musiktheater ist die zweite die reizvollere Variante, bietet sie doch die Gelegenheit, nach einer Arie des Romeo, in der er beim Anblick der vermeintlich toten Giulietta seine Trauer und Verzweiflung zum Ausdruck bringt und das Gift nimmt, die Protagonisten nach Giuliettas Erwachen in einer hochdramatischen Situation ein letztes Liebesduett im Angesicht des nahen Todes singen zu lassen. Nach Foppa und Zingarelli optiert auch Romani bei beiden Versionen seines Stoffes für diese Schlussvariante – und doch unterscheiden sich seine beiden Libretti auch in der Schlussszene wesentlich. Denn während in FR I nach dem Duett Giulietta noch ein letzter musikalischer Höhepunkt, nämlich eine Arie, gegönnt ist, die sie in Anwesenheit von Lorenzo und der inzwischen unter der Führung Capellios in die Gruft geeilten Capuleti singt und in der sie bittere Vorwürfe an ihren Vater richtet und ihren Wunsch zu sterben äußert, folgt in FR II der Tod Giuliettas unmittelbar auf den Romeos:
Romeo:
Addio… ah! Giulie… / Lebewohl…. ah! Giulie…
Giulietta:
Ei muore… oh, Dio! / Er stirbt… oh, Gott!
(Cade sul corpo di Romeo) / (Sie bricht über dem toten Romeo zusammen)«
Dann erst stürmen Lorenzo, Capellio und in ihrem Gefolge die Capuleti in die Gruft. Sie können nur mehr den Tod beider feststellen (Lorenzo: »Morti ambedue« – »sie sind beide tot«, FR II: II,11). Im Unterschied zu FR I findet also die Vereinigung Romeos und Giuliettas im Tod in FR II ihre Entsprechung auch auf der musikalischen und der Handlungsebene, ist ihr letzter musikalischer Auftritt doch ein gemeinsamer, an dessen Ende sie gleichzeitig aus dem Leben und als aktive Figuren von der Bühne scheiden.
Für die Schlussszenen der beiden Libretti ergibt sich also folgendes Schema der musikalischen Nummern:[38]
FR I:
- Arie (Romeo)
- Duett (Romeo und Giulietta)
- Arie (Giuletta)
FR II:
- Arie (Romeo)
- Duett (Romeo und Giuletta)
Diese unterschiedliche Disposition des Opernschlusses veranlasste die Mezzosopranistin Maria Malibran, 1832 bei der Aufführung der Bellini-Oper am Teatro Comunale di Bologna, in der sie die Rolle des Romeo sang,[39] zu der Anregung, das Finale von FR II durch das Vaccai-Finale zu ersetzen, was dann auch so geschah.[40] Dieses Beispiel machte Schule: Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde Bellini immer wieder mit dem Vaccai-Schluss aufgeführt, übrigens sehr zum Verdruss des Nobelpreisträgers für Literatur, Eugenio Montale, der 1966 in seinen Besprechungen der Erstaufführungen an der Mailänder Scala bemerkt:
I Capuleti e i Montecchi, settima fra le undici opere di Vincenzo Bellini, apparvero più volte alla Scala dopo il successo ottenuto a Venezia nel 1830. In ognuna di queste rappresentazioni (1834, 1837, 1844, 1849 e 1861) l’opera continuava a portare un finale che non apparteneva al Bellini ma al maestro marchigiano Nicola Vaccai, autore di una precedente Giulietta e Romeo già apparsa alla Scala nel ’26. E lo stesso libretto del Romani non era che il rimaneggiamento del testo composto dallo stesso Romani per il Vaccai. Figuratevi che cosa accadrebbe oggi se un’opera di Pizzetti portasse il finale di un’opera scritta da un altro e rappresentata appena quattro anni prima nel medesimo teatro![41]
I Capuleti e i Montecchi, die siebte der insgesamt elf Opern von Vincenzo Bellini, ist nach der erfolgreichen Erstaufführung von 1830 in Venedig mehrmals auch an der Scala gespielt worden. Bei jeder dieser Aufführungen (1834, 1837, 1844, 1849 und 1861) endete die Oper immer mit einem Finale, das nicht aus der Feder Bellinis stammt, sondern dem aus den Marken stammenden Maestro Nicola Vaccai zuzuschreiben ist, der zuvor eine Oper mit dem Titel Giulietta e Romeo komponiert hatte, die bereits 1826 an der Scala uraufgeführt worden war. Und sogar das Libretto Romanis war lediglich eine Umarbeitung des Textes, den ebenderselbe Romani schon für Vaccai geschrieben hatte. Stellen Sie sich vor, was heute passieren würde, wenn in einer Oper von Pizzetti das Finale einer Oper aus der Feder von jemand anderem zu sehen wäre, die gerade erst einmal vier Jahre vorher in demselben Theater aufgeführt worden ist!
V. Ausblick auf das französische Repertoire
Hector Berlioz
In dieser Hinsicht war Hector Berlioz mehr Glück beschieden, der sich 1831 in Florenz, wo er sich unter anderem in den wundervollen Gärten am linken Arnoufer (»dans les bois délicieux qui bordent la rive gauche de l’Arno«) schon tagelang mit Shakespearelektüren vergnügt hatte, mit großer Vorfreude ins Theater begab und auch tatsächlich Bellinis Werk in seiner ganzen Länge zu sehen bekam:
Sachant bien que je ne trouverais pas dans la capitale de la Toscane ce que Naples et Milan me faisaient tout au plus espérer, je ne songeais guère à la musique, quand les conversations de table d’hôte m’apprirent que le nouvel opéra de Bellini (I Montecchi ed i Capuleti (sic!)) allait être représenté. On disait beaucoup de bien de la musique, mais aussi beaucoup du libretto, ce qui, eu [sic!] égard au peu de cas que les Italiens font pour l’ordinaire des paroles d’un opéra, me surprenait étrangement. Ah ! ah ! c’est une innovation !!! je vais donc, après tant de misérables essais lyriques sur ce beau drame, entendre un véritable opéra de Roméo, digne du génie de Shakespeare ! Quel sujet ! Comme tout y est dessiné pour la musique !… D’abord le bal éblouissant dans la maison de Capulet, où, au milieu d’un essaim tourbillonnant de beautés, le jeune Montaigu aperçoit pour la première fois la sweet Juliet, dont la fidélité doit lui coûter la vie ; puis ces combats furieux, dans les rues de Vérone, auxquels le bouillant Tybalt semble présider comme le génie de la colère et de la vengeance ; cette inexprimable scène de nuit au balcon de Juliette, où les deux amants murmurent un concert d’amour tendre, doux et pur comme les rayons de l’astre des nuits qui les regarde en souriant amicalement, les piquantes bouffonneries de l’insouciant Mercutio, le naïf caquet de la vieille nourrice, le grave caractère de l’ermite, cherchant inutilement à ramener un peu de calme sur ces flots d’amour et de haine dont le choc tumultueux retentit jusque dans sa modeste cellule… puis l’affreuse catastrophe, l’ivresse du bonheur aux prises avec celle du désespoir, de voluptueux soupirs changés en râle de mort, et enfin le serment solennel des deux familles ennemies jurant, trop tard, sur le cadavre de leurs malheureux enfants, d’éteindre la haine qui fit verser tant de sang et de larmes. Je courus au théâtre de la Pergola. Les choristes nombreux qui couvraient la scène me parurent assez bons, leurs voix sonores et mordantes ; il y avait surtout une douzaine de petits garçons de quatorze à quinze ans, dont les contralti étaient d’un excellent effet. Les personnages se présentèrent successivement et chantèrent tous faux, à l’exception de deux femmes, dont l’une, grande et forte, remplissait le rôle de Juliette, et l’autre, petite et grêle, celui de Roméo. — Pour la troisième ou quatrième fois après Zingarelli et Vaccaï, écrire encore Roméo pour une femme !… Mais, au nom de Dieu, est-il donc décidé que l’amant de Juliette doit paraître dépourvu des attributs de la virilité ? Est-il un enfant, celui qui, en trois passes, perce le cœur du furieux Tybalt, le héros de l’escrime, et qui, plus tard, après avoir brisé les portes du tombeau de sa maîtresse, d’un bras dédaigneux, étend mort sur les degrés du monument le comte Pâris qui l’a provoqué ? Et son désespoir au moment de l’exil, sa sombre et terrible résignation en apprenant la mort de Juliette, son délire convulsif après avoir bu le poison, toutes ces passions volcaniques germent-elles d’ordinaire dans l’âme d’un eunuque ?
Trouverait-on que l’effet musical de deux voix féminines est le meilleur ?… Alors, à quoi bon des ténors, des basses, des barytons ? Faites donc jouer tous les rôles par des soprani ou des contralti, Moïse et Othello ne seront pas beaucoup plus étranges avec une voix flûtée que ne l’est Roméo. Mais il faut en prendre son parti ; la composition de l’ouvrage va me dédommager…
Quel désappointement !!! dans le libretto il n’y a point de bal chez Capulet, point de Mercutio, point de nourrice babillarde, point d’ermite grave et calme, point de scène au balcon, point de sublime monologue pour Juliette recevant la fiole de l’ermite, point de duo dans la cellule entre Roméo banni et l’ermite désolé ; point de Shakespeare, rien ; un ouvrage manqué. Et c’est un grand poëte, pourtant, c’est Félix [sic!] Romani, que les habitudes mesquines des théâtres lyriques d’Italie ont contraint à découper un si pauvre libretto dans le chef-d’œuvre shakespearien !
Le musicien, toutefois, a su rendre fort belle une des principales situations ; à la fin d’un acte, les deux amants, séparés de force par leurs parents furieux, s’échappent un instant des bras qui les retenaient et s’écrient en s’embrassant : « Nous nous reverrons aux cieux. » Bellini a mis, sur les paroles qui expriment cette idée, une phrase d’un mouvement vif, passionné, pleine d’élan et chantée à l’unisson par les deux personnages. Ces deux voix, vibrant ensemble comme une seule, symbole d’une union parfaite, donnent à la mélodie une force d’impulsion extraordinaire ; et, soit par l’encadrement de la phrase mélodique et la manière dont elle est ramenée, soit par l’étrangeté bien motivée de cet unisson auquel on est loin de s’attendre, soit enfin par la mélodie elle-même, j’avoue que j’ai été remué à l’improviste et que j’ai applaudi avec transport.[42]
Mir war sehr wohl klar, dass ich in der Hauptstadt der Toscana nicht das finden würde, worauf ich in Neapel und Mailand in höchstem Maße hoffen konnte, so hatte ich die Musik gar nicht im Sinne, als ich aus den Unterhaltungen am Esstisch erfuhr, dass die neue Oper von Bellini (I Montecchi ed i Capuleti [sic]) aufgeführt werden sollte. Man äußerte sich sehr lobend zur Musik, aber auch zum Libretto, was mich doch sehr überraschte, machen doch die Italiener gewöhnlich um die Worte einer Oper kaum Aufhebens. Ah! ah! das ist also etwas ganz Neues! ich werde also, nach so vielen erbärmlichen dichterischen Versuchen an diesem schönen Theaterstück, eine richtige Romeo-Oper zu hören bekommen, die dem Genie Shakespeares würdig ist! Was für ein Sujet! Und wie hier auch alles schon für die Musik vorgezeichnet ist!… Zunächst der rauschende Ball im Hause der Capulet, wo, inmitten einer wirbelnder Schar von Schönheiten, der junge Montaigu zum ersten Mal die sweet Juliet erblickt, zu der ihn seine Treue sein Leben kosten soll; dann die wilden Kämpfe in den Straßen von Verona, die der aufbrausende Tybalt wie der Geist der Wut und der Rache anzuführen scheint, diese unaussprechliche Nachtszene am Balkon von Juliette, in der die beiden Liebenden ein Konzert der zärtlichen Liebe murmeln, die so süß und rein ist wie die Strahlen des Nachtgestirns, das freundlich lächelnd auf sie herabblickt; die stichelnden Späße des unbekümmerten Mercutio, das naive Geschwätz der alten Amme, der schwermütige Charakter des Eremiten, der vergeblich versucht, ein bisschen Ruhe in die Wogen der Liebe und des Hasses zurückzubringen, deren lärmender Aufschlag bis in seine bescheidene Zelle dringt… schließlich die entsetzliche Katastrophe, der Rausch des Glückes im Widerstreit mit dem der Verzweiflung, die Seufzer der Lust, die zum Todesröcheln werden, und dann das feierliche Versprechen der beiden verfeindeten Familien, die, zu spät, über den Leichnamen ihrer unglücklichen Kinder, dem Hass abschwören, der sie so viel Blut und Tränen vergießen ließ. Ich eilte zum Pergola-Theater. Zahlreiche Chorsänger bevölkerten die Bühne, sie schienen mir ziemlich gut zu sein mit ihren sonoren und beissenden Stimmen; da gab es vor allem etwa ein Duzend kleiner Jungen von vierzehn, fünfzehn Jahren, deren contralti hervorragend wirkten. Nach und nach traten die Figuren auf die Bühne, sie sangen alle falsch, außer zwei Frauen, von denen die eine, sie war groß und kräftig, die Rolle der Juliette bekleidete, und die andere, klein und zierlich, Romeo darstellte. – Zum dritten oder vierten Mal nach Zingarelli und Vaccai wird da noch einmal ein Romeo für eine Frau geschrieben!… Aber, um Himmels Willen, ist das jetzt also ein für alle mal so festgesetzt, dass der Geliebte Juliettes bar der Attribute der Männlichkeit in Erscheinung zu treten hat? Ist ein Knabe dazu in der Lage, in drei Zügen das Herz des rasenden Tybalt, dieses Meisters der Fechtkunst, zu durchbohren, und später, nachdem er den Zugang zur Gruft seiner Geliebten aufgebrochen hat, den Grafen Paris, der ihn provoziert hatte, auf den Stufen des Grabmales mit verächtlicher Geste zur Strecke zu bringen? Und seine Verzweiflung im Augenblick des Exils, seine dumpfe und schreckliche Resignation bei der Nachricht von Juliettes Tod, sein Wahn und seine Todeskrämpfe, nachdem er das Gift getrunken hat, all diese vulkanischen Leidenschaften – keimen die gewöhnlich in der Seele eines Eunuchen?
Sollte man etwa befinden, dass die musikalische Wirkung von zwei Frauenstimmen besser ist?… Wozu sind denn dann Tenöre, Bässe, Baritone überhaupt nutze? Dann sollen doch gleich Soprane und contralti alle Rollen übernehmen, Moses und Othello werden mit einer Flötenstimme auch nicht sehr viel befremdlicher sein als Romeo. Aber damit hat man sich wohl abzufinden, die Komposition des Stückes wird mich schon entschädigen…
Was für eine Enttäuschung!!! in dem Libretto kommt kein Ball bei den Capulet vor, kein Mercutio, keine schwatzhafte Amme, kein schwermütiger Eremit, keine Balkonszene, kein sublimer Monolog für Juliette, wenn sie das Fläschchen aus der Hand des Eremiten entgegennimmt, kein Duett in der Zelle zwischen dem verbannten Romeo und dem untröstlichen Eremiten; kein Shakespeare, gar nichts; ein missglücktes Werk. Und dabei ist das doch ein großer Dichter, dieser Felix [sic] Romani, den die armseligen Gewohnheiten der Operntheater in Italien dazu gezwungen haben, ein so klägliches Libretto aus dem Meisterwerk Shakespeares herauszuschneiden!
Doch eine der Hauptsituationen ist dem Musiker doch sehr gut gelungen; am Ende des einen Aktes, wenn die beiden Liebenden gewaltsam von ihren wütenden Eltern getrennt werden und sich für einen Augenblick den Armen entreißen können, die sie eben noch zurückhielten und nun, sich umarmend, ausrufen: »Im Himmel werden wir uns wieder sehen«, hat Bellini die Worte, die diese Idee ausdrücken, mit einer lebhaften, leidenschaftlichen Phrase untermalt, die voller Schwung ist und von den beiden Figuren im Unisono gesungen wird. Diese beiden Stimmen, die zusammen wie eine einzige vibrieren, sind als Symbol einer perfekten Vereinigung anzusehen und verleihen der Melodie eine außergewöhnliche Antriebskraft; und, sei es aufgrund der Einbettung der melodischen Phrase und der Art ihrer Herbeiführung, sei es aufgrund des sehr wohl begründeten seltsamen Eindruckes dieses Unisono, das nicht im Entferntesten zu erwarten war, oder vielleicht auch aufgrund der Melodie selbst, muss ich jedenfalls zugeben, dass ich auf einmal gerührt war und begeistert Beifall klatschte.[43]
Die Erwartungen Berlioz’, mit der Komposition von Bellini eine ›Shakespeare-Oper‹ genießen zu können, hatten sich also nicht erfüllt, war doch die Handlung des Romani-Librettos gegenüber dem überquellenden englischen Drama auf die wesentlichen Handlungsabläufe reduziert.[44] Als Berlioz dann 1839 in seiner Symphonie dramatique Roméo et Juliette den Stoff selbst neu vertonte, trug er dieser Enttäuschung beim Theaterbesuch in Florenz Rechnung und reicherte nicht nur sein Stück wieder mit den aus Shakespeare bekannten poetischen Momenten, lyrischen Akzenten und (realen wie phantastischen) (Neben-)Figuren an[45] (z. B. Ball- und Balkonszene, Mercutio, die Königin Mab, Versöhnung der verfeindeten Familien etc.), sondern bringt im Text selbst auch seine große Bewunderung für Shakespeare explizit zum Ausdruck:
Premier amour, n’êtes-vous pas
Plus haut que toute poésie?
Ou ne seriez-vous point, dans notre exil mortel,
Cette poésie elle-même,
Dont Shakespeare lui seul eut le secret suprême
Et qu’il remporta dans le ciel?
Erste Liebe, bist du nicht
Höher als alle Poesie?
Oder bist du vielleicht, hier in unserem irdischen Dasein,
Jene Poesie selbst,
Deren höchstes Geheimnis Shakespeare allein kannte
Und das er mit sich in den Himmel nahm?
Charles Gounod
Begeistert von Berlioz’ Komposition, die er in jungen Jahren am Conservatoire de Paris zu hören bekam, ließ sich Charles Gounod zu seiner Oper Roméo et Juliette (Uraufführung 1867, Théâtre Lyrique, Paris) anregen, wobei auch er und seine Textdichter Jules Barbier und Michel Carré sich in die stoffgeschichtliche Tradition nach Shakespeare stellen, diese weiterentwickeln (z. B. im Duett Roméo und Juliette (IV, erstes Bild), wo die beiden Lieben nicht wissen, ob schon die Lerche, die Künderin des Tages (»messagère du jour«), singt und sie sich also trennen müssen, oder ob noch die Nachtigall, die Vertraute der Liebe (»confidant de l’amour«) zu hören sei) und der gegenüber sie beispielsweise mit der Figur der Pagen Stéphano, neue Akzente setzen.
Nachweise und Anmerkungen
[1] Albert Gier, Das Libretto – Theorie und Geschichte, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel 2000, S. 215.
[2] So die Witwe Felice Romanis, Emilia Branca, in der von ihr verfassten Biographie ihres Mannes (Emilia Branca, Felice Romani ed i più riputati maestri di musica del suo tempo. Cenni biografici ed aneddotici, Torino: Loescher 1882, S. 116), zitiert in: Valeria Gaffuri, Felice Romani librettista per Bellini, in: Il magnifico parassita, hrsg. von Ilaria Bonomi und Edoardo Buroni, Milano: Franco Angeli 2010, S. 76, und in: Alessandro Roccatagliati, Felice Romani Librettista, Lucca: Libreria Musicale Italiana 1996, S. 23, Anm. 11.
[3] Vincenzo Bellini an Florimo, September 1828, zitiert in: Gaffuri, S. 76. – Über Felice Romani als den idealen Librettisten für Vincenzo Bellini siehe auch: Vincenzo Bellini, Norma. Melodramma in due atti di Felice Romani, hrsg. von Carlo Parmentola, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1974, S. 51f.
[4] Vincenzo Bellini an Felice Romani, 7. Oktober 1834, zitiert in: Roccatagliati, S. 384: »Forse scriverò un’opera per Napoli, forse sarà per Milano, forse anche per Parigi, eccoti tutte le offerte che mi sono state fatte in questo momento: io mi riserberò di accettare le più utili per l’interesse e per la gloria di noi due. Ora che sono ritornato con te, o mio gran Romani, mio egregio collaboratore e protettore, mi sento riposato e contento. […] Scrivimi subito e dimmi dove sei, se a Milano o a Torino, che presto ci rivedremo. Non vedo l’ora di abbracciarti.« (»Vielleicht schreibe ich eine Oper für Neapel, vielleicht wird es für Mailand sein, vielleicht auch für Paris, hier hast du alle Angebote, die man mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemacht hat: Ich werde mir vorbehalten, diejenigen anzunehmen, die für unser beider Interesse und Ruhm am nützlichsten sind. Jetzt wo ich mich wieder mit Dir zusammen getan habe, oh Du mein großer Romani, mein vortrefflicher Mitarbeiter und Förderer, fühle ich mich erholt und zufrieden. […] Schreib mir sofort und sag mir, wo du bist, ob in Mailand oder Turin, so werden wir uns bald wiedersehen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu umarmen.«
[5] Der Vollständigkeit halber sei hier auch die Oper Bianca e Fernando (erste Aufführung am 7. April 1828 anlässlich der Einweihung des Teatro Carlo Felice, Genua) genannt, doch handelt es sich hierbei nicht um eine Neuschöpfung Romanis, sondern vielmehr um eine Überarbeitung des von Domenico Gilardoni verfassten Librettos, das Bellini unter dem Titel Bianca e Gernando vertont hatte und das 1826 am S. Carlo in Neapel uraufgeführt worden war. Der Name des männlichen Helden bei Gilardoni sollte ursprünglich ebenfalls Fernando lauten, er wurde aber modifiziert, um sich nicht dem Verdacht der Anspielung auf den König beider Sizilien, Ferdinando di Borbone, auszusetzen (vgl. hierzu: Friedrich Lippmann, Romani e Bellini. I fatti e i principi della collaborazione, in: Felice Romani – Melodrammi, Poesie, Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 86ff., und Gaffuri, S. 75).
[6] Ursprünglich war Giovanni Pacini mit der Komposition einer Oper für diesen Termin beauftragt worden. Da er jedoch parallel dazu an drei weiteren Opern arbeitete (Auftragsarbeiten für die Theater San Carlo di Napoli, Scala di Milano und Regio di Torino), wendete sich der Impresario der Fenice, Alessandro Lanari, besorgt um die rechtzeitige Fertigstellung des Auftrags für sein Opernhaus, an Bellini, der sich gerade in Venedig aufhielt. Bellini nahm den Auftrag an. Vgl. hierzu: Fabio Vittorini, Shakespeare e il melodramma romantico, Firenze: La Nuova Italia 2000, S. 351.
[7] Bellini an Florimo, 20. Januar 1830, zitiert in: Gaffuri, S. 77.
[8] Einen Überblick über die Geschichte des Stoffes von Romeo und Julia in der europäischen Literatur bis hin zu Gottfried Keller bietet Elisabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart: Kröner 8/1992, S. 689–692.
[9] Die erste Übersetzung stammt von Antonio Bonucci, Florenz, 1778, die zweite von Francesco Balbi, Venedig, 1804. Von diesem Stück ließ sich der aus Brescia stammende Luigi Scevola zu seiner Tragödie Giulietta e Romeo inspirieren. Zu diesen und weiteren »Romeo und Julia«-Stücken auf italienischen Bühnen im Vorfeld der Libretti von Romani siehe Vittorini, S. 325ff.
[10] Die erste Übersetzung aus der Feder eines Unbekannten stammt aus dem Jahre 1789 und wurde in Venedig angefertigt, die zweite wird dem Venezianer Giuseppe Ramirez zugeschrieben (1797) und sollte Anfang des 19. Jahrhunderts Cesare Della Valle zu einer Neufassung anregen, vgl. Vittorini, S. 327f.
[11] Zu den dramatis personae bei Shakespeare im Vergleich zu der Anzahl der Figuren in Nachfolgestücken siehe die folgenden Kommentare zur Synopse.
[12] Die Figur des Montaigu reichert Ducis zudem mit Motiven aus dem Inferno von Dantes Divina Commedia an, vgl. Vittorini, S. 326.
[13] Vgl. ebd., S. 326f.
[14] William Shakespeare, Romeo and Juliet – Romeo und Julia, übers. und hrsg. von Herbert Geisen, Stuttgart: Reclam 1979, bibliographisch ergänzte Ausgabe 2009, S. 8 und S. 207.
[15] Vgl. Vittorini, S. 329f.
[16] Vgl. ebd., S. 330ff. – Die Betrachtung der Balletttradition würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen.
[17] Vgl. Vittorini, S. 332ff.
[18] Vittorini folgend gehen auch wir von einem gegenüber Ducis etwas stärkeren Einfluss Merciers auf die hier besprochenen »Romeo und Julia«-Libretti aus, obwohl weder Foppa noch Romani ihn unter ihren Quellen anführen (für Foppa: Vittorini, S. 333; für Romani: ebd., S. 341ff.). Da Mercier unter anderem, wie dargestellt, auf Ducis als Vorlage zurückgreift, wird in der Synopse der Übersichtlichkeit halber die Tradition des französischen Sprechtheaters auf Mercier beschränkt.
[19] Vgl. Vittorini, S. 328.
[20] Dante Alighieri, La Divina Commedia, Vol. II: Purgatorio, hrsg. von Natalino Sapegno, Firenze: La Nuova Italia 1984, S. 67f.
[21] Wie bereits erwähnt, ist der »Romeo und Julia«-Stoff erstmals in der italienischen Novellistik des 15. Jahrhunderts, also nach Dante, dokumentiert, und zwar im Novellino des Masuccio (1476), der die Geschichte in Siena ansiedelt: vgl. Frenzel, S. 689.
[22] Ab Luigi da Porto: Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti (1524), vgl. Frenzel, S. 689.
[23] Dieser Umstand hat die Dante-Kritik seit jeher zu unterschiedlichen Mutmaßungen angeregt, siehe hierzu den entsprechenden Kommentar von Natalino Sapegno, in Dante Alighieri, S. 67f.
[24] Siehe unten.
[25] Shakespeare, S. 4/6
[26] Siehe oben.
[27] Dieser Tradition folgend, geht der Handlung von FR I und FR II jeweils die Tötung des Bruders Giuliettas durch Romeo voraus, was textimmanent die Unnachgiebigkeit des Vaters Giuliettas im Konflikt mit den Montecchi erklärt.
[28] Aber nicht immer: So ist etwa die Figur mit dieser Funktion bei Shakespeare, der Graf Paris, als Verwandter des Prinzen und Mercutios nicht den Capuleti zuzuordnen.
[29] Bei Shakespeare fließen in die Figur des Friar Laurence beide ›berufliche‹ Aspekte ein: Bei seinem ersten Auftritt (II,3) sortiert er »baleful weeds and precious-juiced flowers« (II,3, Vers 4), eine Tätigkeit, die ihn in philosophische Gedankengänge abschweifen und auch über die »medicine power« (II,3, Vers 20) der Pflanzen sinnieren lässt. Shakespeare bewegt sich damit nahe an der Realität des Mittelalters, verfügten die Klöster und Abteien doch in der Regel auch über einen Garten mit medizinischen bzw. Heilpflanzen. Vgl. hierzu: Matteo Vercelloni und Virgilio Vercelloni, L’invenzione del giardino occidentale, Milano: Editoriale Jaca Book 2009, S. 32–34.
[30] Siehe oben.
[31] An dieser Stelle ist insofern eine logische Inkohärenz des Librettos festzustellen, als noch aus I,5 hervorgeht, dass Giulietta nichts von den Plänen ihres Vaters weiß, während sie in dieser Szene darüber bereits informiert ist.
[32] Spuren des verehrten Dichters von Tragödien im klassischen Stil, Vittorio Alfieri, bei Felice Romani stellt auch Stefano Verdino fest, wenn er beispielsweise in Zusammenhang mit der Schlussarie Giuliettas, die an den Vater gerichtet ist, ihre verzweifelte Wut als eine »rabbia alfieriana«, einer Wut à la Alfieri, bezeichnet (Stefano Verdino, Come lavorava Felice Romani. Dalle fonti contemporanee ai melodrammi seri, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 162).
[33] Zu nennen wären in diesem Zusammenhang etwa seine Beiträge ab 1818/19 zum Dizionario d’ogni mitologia e antichità, dessen Fertigstellung bis 1827 er dann zusammen mit Antonio Peracchi übernahm: vgl. Roccatagliati, S. 25f.
[34] Siehe etwa seine Polemik gegen die Lombardi alla prima Crociata von Tommaso Grossi (1826) oder seine vernichtende Kritik an den Promessi sposi von Alessandro Manzoni in der Zeitschrift La vespa (1827), vgl. Roccatagliati, S. 30 und S. 44ff.
[35] Die Verflechtung des politischen Handlungsstranges mit dem der Liebe ist in den ersten Szenen von FR I und FR II unterschiedlich stringent. Während beispielsweise in FR I die Absicht Capellios, Giulietta mit Tebaldo zu vermählen, erst später mit der festen und ewigen Freundschaft (»costante ed eterna amistà«, FR I: I,1) Tebaldos begründet wird, stellt Felice Romani diesen Zusammenhang in seinem Libretto für Bellini von vornherein her.
[36] Da mit Romeo am Schluss der Oper in beiden Versionen Romanis auch der einzige handlungsrelevante Vertreter der Montecchi (neben ihm gibt es nur noch den Chor der Gefolgschaft der Montecchi) im Stück stirbt, ist die Versöhnung der beiden Häuser auf der Bühne auch gar nicht möglich.
[37] Ob Julia sich selbst tötet oder vom Schmerz angesichts des toten Romeo dahingerafft wird, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, die Tradition kennt beide Möglichkeiten. Vgl. hierzu Vittorini, Shakespeare e il melodramma romantico, S. 317ff.
[38] Vgl. Vittorini, S. 357.
[39] Giulietta wurde von Sofia Schoberlechner interpretiert.
[40] Vgl. Vittorini, S. 359f.
[41] Eugenio Montale, Prime alla Scala, in: Il secondo mestiere. Arte, musica, società, hrsg. von Giorgio Zampa, Milano: Mondadori 1996, S. 881.
[42] Hector Berlioz, Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm,Kap. XXXV.
[43] Die hier von Berlioz besprochene Szene befindet sich am Ende des ersten Aktes.
[44] Vgl. Lippmann, S. 91: « Qui, in Romani, Romeo e Giulietta parlano solo della fuga, se non della morte. Non vi è alcun corrispondente della “scena del balcone”. » – »Hier, bei Romani, sprechen Romeo und Giulietta nur von der Flucht, wenn nicht gar vom Tod. Es gibt keine Ensprechung für die ›Balkonszene‹.«
[45] Berlioz hält in seinen Mémoires fest, dass er zunächst selbst eine Prosafassung für seine Symphonie dramatique verfasste, die dann der Dichter Emile Deschamps in Verse setzte (Hector Berlioz, Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm, Kapitel XLIX).
Bibliographie
Bellini, Vincenzo: Norma. Melodramma in due atti di Felice Romani, hrsg. von Carlo Parmentola, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1974.
Berlioz, Hector: Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm.
Dante Alighieri: La Divina Commedia, Vol. II: Purgatorio, hrsg. von Natalino Sapegno, Firenze: La Nuova Italia 1984.
Frenzel, Elisabeth: Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart: Kröner 8/1992.
Gaffuri, Valeria: Felice Romani librettista per Bellini, in: Il magnifico parassita, hrsg. von Ilaria Bonomi und Edoardo Buroni, Milano: FrancoAngeli 2010, S. 75–114.
Gier, Albert: Das Libretto – Theorie und Geschichte, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel 2000.
Lippmann, Friedrich: Romani e Bellini. I fatti e i principi della collaborazione, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 83–114.
Montale, Eugenio: Prime alla Scala, in: Il secondo mestiere. Arte, musica, società, hrsg. von Giorgio Zampa, Milano: Mondadori 1996, S. 881–884.
Roccatagliati, Alessandro: Felice Romani Librettista, Lucca: Libreria Musicale Italiana 1996.
Shakespeare, William: Romeo and Juliet – Romeo und Julia, übers. und hrsg. von Herbert Geisen, Stuttgart: Reclam 1979, bibliographisch ergänzte Ausgabe 2009.
Vercelloni, Matteo, und Virgilio Vercelloni: L’invenzione del giardino occidentale, Milano: Editoriale Jaca Book 2009, deutsche Ausgabe: Geschichte der Gartenkultur, Darmstadt: Philipp von Zabern 2010.
Verdino, Stefano: Come lavorava Felice Romani. Dalle fonti tragiche contemporanee ai melodrammi seri, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 145–181.
Vottironi, Fabio: Shakespeare e il melodramma romantico, Firenze: La Nuova Italia 2000.
Diskographie
Bellini, Vincenzo: I Capuleti e i Montecchi, Emi 1985 (Riccardo Muti – Royal Opera House, Covent Garden)
Bellini, Vincenzo: I Capuleti e i Montecchi, Deutsche Grammophon 2009 (Fabio Luisi – Wiener Symphoniker)
Berlioz, Hector: Roméo et Juliette, Deutsche Grammophon 1980 (Daniel Barenboim – Orchestre de Paris)
Gounod, Charles: Roméo et Juliette, RCA Victor Red Seal 1995 (Leonard Slatkin – Münchner Rundfunkorchester)
Vaccai, Nicola: Giulietta e Romeo, Bongiovanni 1996 (Tiziano Severini – Orchestra Filarmonica Marchigiana/Teatro G. B. Pergolesi di Jesi)
Simon Leisterer: Zur Rezeption der Musik fremder Kulturen bei den Forschungsreisenden Johann Reinhold Forster und Georg Forster
Zur Rezeption der Musik fremder Kulturen bei den Forschungsreisenden Johann Reinhold Forster und Georg Forster
Der Text basiert auf einer Seminararbeit des Autors.
1. Einleitung
1.1 Zur Reiseliteratur und ihrer Popularität im 18. Jahrhundert
Schon immer gab es den Drang von Menschen, sich zu erheben[1], das Vertraute zu verlassen und Neues zu entdecken. Der Reiz des Fremden lag dabei in den unterschiedlichen Beabsichtigungen des Reisens: So kennzeichnete die Abenteuerreise, deren ältestes und berühmtestes Beispiel wohl Homers Odyssee sein dürfte, die Überwindung von Hindernissen und Herausforderungen des Fremden. Die Pilgerreisenden des Mittelalters versuchten mit heiligen Stätten und Reliquien in Kontakt zu kommen. Des Weiteren konnte das Motiv des Reisens in der Vermehrung des Wissens liegen. Seit dem 17. Jahrhundert erblühten im Zuge von Aufklärung und der langsamen Ausbildung der modernen Wissenschaften sowie der Entdeckung neuer Weltteile und der Entwicklung komfortablerer Fortbewegungsmöglichkeiten die Bildungs- und Forschungsreisen.
Und ebenso gab es immer den Drang des Menschen, die Erlebnisse und Beobachtungen weiterzugeben, z. B. über deren Verschriftlichung. So unterschiedlich die Reisen und ihre Intentionen waren, so unterschiedlich waren auch deren Formate: Es entstanden Reiseberichte, Reiseromane, Reiseskizzen, Reiseessays, Reisetagebücher, Reisenotate etc.[2] »Das frisch Gesehene wurde in den verschiedensten Stillagen notiert und verfügbar gemacht, zunächst im intimen, persönlichen Sinn, dann aber auch für die anderen, die Gruppe, die daheim Gebliebenen.«[3]
Dieser Vorstoß der Reiseliteratur in den öffentlichen Raum war eine Folge des wachsenden Interesses der Bevölkerung am Fernen und Fremden, das im England des 18. Jahrhunderts nicht zuletzt durch dessen Stellung als Seemacht und seine Neuentdeckungen von bis dato unbekannten Erdteilen gewachsen war. Zu dieser Zeit war die Reise nach den Publikationen religiösen Inhalts das zweitbeliebteste Sujet der britischen Leserschaft.[4] Dies konnten fiktive Reisegeschichten sein, wie Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe aus dem Jahr 1719, oder es waren Reiseberichte, wie sie in Richard Hakluyts dreibändiger, bereits zwischen 1598 und 1600 erschienener Sammlung The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation zu finden waren. Hakluyt und spätere Herausgeber von Reiseberichten wurden in England veritable Berühmtheiten – nicht nur im Kreis der See- und Kaufleute, sondern auch beim »normalen, zuhausesitzenden Leser«.[5]
In die Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fielen die Entdeckungsreisen des Thomas Cook, an deren zweiter der deutsche Forscher Johann Reinhold Forster und sein Sohn Georg Forster beteiligt waren. Zwischen 1772 und 1775 steuerte die Crew zahlreiche Inseln des Südmeeres an, deren Charakteristika von den beiden wissenschaftlich erfasst werden sollten.
1.2 Die Forsters und ihre Reiseberichte
Aufgrund dieses Interesses an Reise und dem Fremden dürften sich die Forsters von der Reise neben »dem Gewinn, der der Wissenschaft erwachsen solle, und dem Zuwachs des menschlichen Wissens im allgemeinen«[6] auch einen finanziellen Gewinn versprochen haben. So verkauften sie einerseits nach der Rückkehr viele ihrer mitgebrachten, von der Aura des Exotischen umgebenen Objekte, die bereits während der Expedition jeweils doppelt gesammelt wurden.[7] Als weitere Einnahmequelle, aber auch als Mittel der Erhöhung der eigenen Reputation beabsichtigte Johann Reinhold Forster andererseits die Herausgabe einer großen, für die breite Öffentlichkeit bestimmten Reisebeschreibung. Doch nach einem Zerwürfnis mit der britischen Admiralität war ihm die Veröffentlichung eines populären und somit gewinnträchtigen Reiseberichts entzogen worden. Stattdessen publizierte er 1778 ›lediglich‹ eine wissenschaftliche Abhandlung mit dem Titel Observations made during a Voyage round the World, on Physical Geography, Natural History, and Ethic Philosophy, die zwar kein Massenpublikum erreichen konnte, jedoch »schnell zu einem Standardwerk über die Südsee und insbesondere ihre Bewohner avancierte.«[8]

John Francis Rigaud: Reinhold und Georg Forster. Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forsterundsohn.jpg#mediaviewer/Datei:Forsterundsohn.jpg
Das Verbot zur Veröffentlichung einer populären Reisebeschreibung bezog sich allerdings nur auf den in Ungnade gefallenen Vater, nicht auf dessen Sohn Georg. Der junge Mann schrieb innerhalb von rund acht Monaten sein zweibändiges Werk A Voyage round the World, das noch vor Thomas Cooks eigener Reisebeschreibung im Jahr 1777 erschien. Das Werk erntete viel Anerkennung und erschien kurz darauf in deutscher Sprache, stellenweise verändert sowie angereichert mit Abschnitten aus Thomas Cooks Tagebüchern, in zwei Bänden 1778 und 1780. Der Erfolg seiner Reise um die Welt war immens und beförderte den Dreiundzwanzigjährigen »in Deutschland in die Reihe der meistgelesenen Schriftsteller jener Zeit«.[9]
Doch erfuhr das Werk auch heftige Anfeindungen. Georg Forster wurde öffentlich verdächtigt, gar nicht der tatsächliche Verfasser des Reiseberichts zu sein. Vielmehr sei es der Vater Johann Reinhold Forster gewesen, der das Werk geschrieben und lediglich unter dem Namen seines Sohnes herausgebracht hätte.[10] Auch wenn sich der Sohn dagegen wehrte und seine Autorenschaft heute unstrittig sein dürfte: Neben seinen eigenen Aufzeichnungen bildeten ebenso die Niederschriften des Vaters die Grundlage für die Reise um die Welt.[11] Und auch die Bemerkungen von Johann Reinhold Forster dürften nicht unberührt von Georgs notierten wie auch von gemeinsam diskutierten Beobachtungen und Erkenntnissen geblieben sein. Der Forster-Experte Michael E. Hoare konstatiert, dass Vater und Sohn »bei uns […] als ein wissenschaftliches Team oder eine symbiotische Einheit angesehen« würden und geht mit Blick auf die Reisebeschreibung davon aus, dass »die beiden Forsters zusammen noch vor dem Ende der Reise die ausführlicheren sowohl botanischen als auch zoologischen Beschreibungen der Reise in ein fast veröffentlichungsfertiges Stadium […] gebracht hatten.«[12] Aufgrund der kurz umrissenen engen Verflechtung der beiden Autoren werden die Werke Reise um die Welt und Bemerkungen in dieser Untersuchung nicht in vergleichender Gegenüberstellung, sondern in ergänzender Hinsicht auf ihre Rezeptionen von Musik fremder Kulturen untersucht.
2. Rezeption ›fremder‹ Musik bei den Forsters[13]
Nach derzeitiger Literaturlage gibt es noch keine Untersuchungen zur Musikrezeption bei den Forsters. Somit können keine Vergleiche zu anderen Arbeiten gezogen werden. Die Analyse wird eng an den Texten erfolgen. Die Untersuchung wird in zwei wesentliche Teilbereiche der Musikrezeption untergliedert: Zunächst soll ermittelt werden, wo und wie die Forsters explizit über Musikinstrumente und deren Eigenschaften berichten.[14] In einem zweiten Schritt werden die Wertzuschreibungen, Funktionen und Ausführungen von Musik im gesellschaftlichen Leben der Völker untersucht.
Dabei ist den kommenden Ausführungen voranzustellen, dass Georg Forsters Reise um die Welt und Johann Reinhold Forsters Bemerkungen vorrangig die Beobachtungen und Erfahrungen der Wissenschaftler im Bereich der Ethnographie und Botanik enthalten. Auf fremdartige Musik und eine Berichterstattung über sie wird kein expliziter Schwerpunkt gelegt. Nur in wenigen und in der Regel sehr kurzen Abschnitten wird das Thema behandelt. Somit stellt sich die Suche nach der Forsterschen Musikrezeption mitunter als eine äußerst spitzfindige heraus. Nichtsdestotrotz kann bereits hier vorangestellt werden, dass in den Werken sowohl Musikinstrumente und ihre Eigenschaften als auch verschiedentliche Funktionen von Musik im Leben bereister Inselkulturen beschrieben werden.
2.1 Beschreibung fremder Musikinstrumente
Von fremden Musikinstrumenten, ihrer Beschaffenheit und ihrer praktischen Nutzung berichten die Forsters nur in erstaunlich seltenen Fällen. So schreibt Georg Forster über eine Begegnung mit exotischen Instrumenten in Neuseeland:
Auch fanden wir einige musicalische Instrumente bey ihnen, nemlich eine Trompete oder vielmehr ein hölzernes Rohr, das vier Fus lang und ziemlich dünn war. Das Mundstück mochte höchstens zwey, und das äußerste Ende ohngefähr 5 Zoll im Durchschnitt halten. Sie bliesen damit immer in einerley Ton, der wie das rauhe Blöken eines Thieres klang, doch möchte ein Waldhornist vielleicht etwas mehr und besseres drauf haben herausbringen können. Eine andre Trompete war aus einem großen Tritons-Horn (murex Tritonis) gemacht, mit künstlich ausgeschnitzten Holz eingefaßt, und an demjenigen Ende, welches zum Mundstück dienen sollte, mit einer Öfnung versehen. Ein schrecklich blökender Ton war alles was sich herausbringen ließ. Ein drittes Instrument, welches unsere Leute eine Flöte nannten, bestand aus einem hohlen Rohr, das in der Mitte am weitesten war und in dieser Gegend, desgleichen an beyden Enden eine Öfnung hatte. Dies und das erste Instrument waren beyde, der Länge nach, aus zwey hohlen Stücken von Holz zusammengesetzt, die eins für das andre so eben zurecht geschnitten waren, daß sie genau auf einander paßten und eine vollkommne Röhre ausmachten.[15]
Zunächst ist die Verwendung der europäischen Begrifflichkeiten »Trompete« und »Flöte« für die unbekannten Instrumente auffällig, die Forster zwar zur Veranschaulichung benutzt und sich doch im selben Atemzug von ihnen distanziert. Auf der einen Seite benötigt er Begriffe, die ihm und den Lesenden das Unbekannte über Vertrautes näher bringen, andererseits weiß er um die Diskrepanz zwischen Bezeichnung und Erfahrenem, wenn er der vermeintlichen Trompete die Beschreibung als »vielmehr ein hölzernes Rohr« beifügt und beiläufig klarstellt, dass die Flöte nur von »unsere[n] Leute[n]« als solche bezeichnet wird.
Ferner fällt auf, wie detailliert die Beschreibung trotz der wenigen Worte ausfällt: Forster klärt über Größe, Material, Aufbau und Tonumfang auf, sodass sich der heimische Leser ein recht genaues Bild von den Instrumenten machen kann. Die Wertung lässt dabei nicht lange auf sich warten: Wie das »Blöken eines Tieres« klängen die sogenannten Trompeten. Durch den Vergleich mit animalischen Lauten wird dem neuseeländischen Instrument jede ästhetische Klangqualität abgesprochen. Der europäische Leser des späten 18. Jahrhunderts kann sich hingegen ein ungefähres Klangbild machen und sich in der Stärke seiner Zivilisation bestätigt sehen.
Ebenso berichten die Forsters sowohl in der Reise um die Welt als auch in den Bemerkungen von einer weiteren Flöte und ihrer Spielart, deren Bekanntschaft sie auf Tahiti machten:
Einer von den jungen Männern blies mit den Nasenlöchern eine Flöte von Bambusrohr, die drei Löcher hatte und ein andrer sang dazu. Die ganze Musik war […] nichts anders als eine einförmige Abwechselung von drey bis vier verschiednen Tönen, die weder unsern ganzen, noch den halben Tönen ähnlich klangen, und dem Werth der Noten nach, ein Mittelding zwischen unsern halben und Vierteln seyn mochten. Übrigens war nicht eine Spur von Melodie darinn zu entdecken; ebensowenig ward auch eine Art von Tact beobachtet, und folglich hörte man nichts als ein einschläferndes Summen. Auf diese Weise konnte die Music das Ohr freylich nicht durch falsche Töne beleidigen, aber das war auch das beste dabey, denn lieblich war sie weiter eben nicht zu hören. Es ist sonderbar, daß, da der Geschmack an der Music unter alle Völker der Erde so allgemein verbreitet ist, dennoch die Begriffe von Harmonie und Wohlklang bey verschiedenen Nationen so verschieden seyn können.[16]
Und Johann Reinhold Forster schreibt bezüglich des tahitianischen Instruments:
Weit unvollkommener als ihre Poesie und Tanzkunst, ist ihre Music. Die taheitische Flöte hat nur drey Ventile, und ist folglich auf gar wenige Noten beschränkt. Die Musik die damit gemacht wird, besteht in einem einförmigen Gesumme. Die Flöte wird mit der Nase geblasen.[17]
Beide benutzen auch hier den ihnen bekannten Begriff der Flöte für die Beschreibung des Instruments. Auffällig scheint doch die bei beiden nahezu beiläufige Äußerung, dass das Instrument mit der Nase gespielt wird. Für den europäischen Rezipienten dürfte dies eine Attraktion gewesen sein! Doch lässt sich vermuten, dass die Forsters auf ihrer jahrelangen Fahrt öfter mit solchen Blasinstrumenten in Berührung kamen, sodass sie diese Besonderheit nicht weiter ausschmückten.
Die Reisenden konstatieren nicht nur sachlich die Andersartigkeit des dortigen Tonsystems, sondern sie bemängeln darüber hinaus den monotonen Klang und den beschränkten Tonumfang der Flöte. Georg Forster geht gar noch weiter in seiner Kritik. Nicht nur das Instrument sei primitiv, sondern auch die musikalische Ausführung von Instrumentalist und Sänger: Denn zur fehlenden Melodie und seinem wahrgenommenem »Summen« wurde »ebensowenig […] eine Art von Tact beobachtet«. Auch wenn Georg Forster ihm einen generellen »Geschmack an der Music« zugesteht und ihn somit nicht völlig diskreditiert, wird der Tahitianer somit indirekt als unmusikalisch dargestellt.
Dass Georg Forster aber auch eine gewisse Faszination für ein Instrument entwickelte, lässt sich an einer Episode auf Tanna ablesen: Dort hätten die Insulaner ihm ein Instrument präsentiert,
welches gleich der Syrinx, oder Pan-Flöte, von Tonga-Tabbu, aus acht Rohr-Pfeifen bestand, mit dem Unterschied, daß hier die Röhren stufenweise kleiner wurden, und eine ganze Oktave ausmachten, obgleich der Ton jeder einzelnen Pfeife nicht völlig rein war. […] Wir kauften auch etliche achtröhrige Pfeifen ein, die nebst Boden, Pfeilen, Streitkolben und Speeren feil geboten wurden […].[18]
Die Beschreibung des Instruments wird recht knapp und sachlich gehalten. Des Weiteren fällt hier der intragruppale Vergleich auf: Die tannische »Pan-Flöte« wird mit einem anscheinend ähnlichen Instrument in Beziehung gesetzt, das auf einer anderen Insel (Tongatabu) gesichtet wurde.[19] In dieser Gegenüberstellung wird die tannische »Panflöte« der tongaischen bevorzugt, hat sie doch einen Tonumfang von immerhin »eine[r] ganze[n] Oktave«. Nicht zuletzt lässt sich die wohlwollende Sicht des Autors auf das Instrument mit seinem Kauf »etliche[r] achtröhrige[r] Pfeifen« belegen – hier begnügte er sich nicht mit dem Kauf eines oder zweier Exemplare, wie sonst wohl üblich.[20]
Als weitere häufig erwähnte, aber nur an einer Stelle tatsächlich beschriebene Instrumentengattung sind Trommeln zu nennen. In der Regel werden sie nur beiläufig und in Verbindung mit Tänzen erwähnt. Die einzige knappe Instrumentenbeschreibung findet sich in den Ausführungen zu einem Hiva-Tanz auf Raiatea.[21] Dort heißt es, es habe sich um »drei aus hartem Holz geschnitzte und mit Haifischhaut überzogene Trommeln« gehandelt. Die Beschaffenheit aus Haifischhaut ist für den Leser zwar durchaus interessant, doch über die Größe und den Klang des Instrumentes erfährt man nichts.
An wenigen Stellen finden auch Beschreibungen des Gesangs Einzug in die Ausführungen. Diese sind insbesondere im achten Abschnitt der – im Gegensatz zur chronologisch angelegten Reise um die Welt – systematisch aufgebauten Bemerkungen zu finden.[22]
In Bezug auf die Gesangskünste werden die Kulturen in vergleichender Betrachtung qualitativ-hierarchisch dargestellt: Einen angenehmen Gesang hätten die Forsters in Neuseeland und in Tanna erlebt. Bei anderen Völkern, wie den Einwohnern Tahitis, sei dieser weniger komplex gewesen:
Auch die Vocalmusik ist [in Tahiti] von keinem weiteren Umfange; sie enthält nur drey bis vier Töne, demohnerachtet sind einige ihrer Gesänge nicht ganz unangenehm. Unter den Einwohnern der freundschaftlichen Inseln hat die Musik ungleich stärkern Fortgang gehabt. Die Gesänge der Frauenzimmer auf der Insel Ea-uhwe oder Middelburg […] hatten etwas angenehmes. Noch mehr Abwechselung und Umfang findet man in den Gesängen der Tannesen und der Neuseeländer; es scheint also, daß diese von Natur mehr Anlage zur Musik haben.[23]
Die Äußerung veranschaulicht den damals sicherlich modernen, heute antiquiert wirkenden Fortschrittsgedanken Forsters: Es gäbe Ethnien wie jene in Tahiti, deren Gesänge weniger entwickelt wären, und andere, wie das Neuseelands, das einen stärkeren Fortgang durchlebt hätte und dazu »von Natur mehr Anlage zur Musik haben«. Dieser These liegt selbstverständlich das europazentrische Weltbild zugrunde, das auch am Ende des 18. Jahrhunderts unter Humanisten, als welche sich die Forsters verstanden, verbreitet war. Keines der bekannt gemachten Völker konnte seine Kunstprodukte aus ihrer Sicht in Umfang und Qualität mit europäischen Gesängen vergleichen.
Während sich die Gesangskunst nach Auffassung der Forsters also nicht mit jener der Europäer messen konnte, imponierte ihnen anscheinend die Improvisationskunst der fremden Kulturen:
Die Kunst, aus dem Stegereif Verse zu machen und sie zugleich abzusingen, ist allgemein. Ihre dramatischen Vorstellungen sind gemeiniglich dergleichen auf der Stelle erdachte Compositionen, oder ein Gemisch von Gesängen, Tänzen und Musik. Unser Welttheil hat also seine Improvvisatori nicht allein.[24]
Hier wird das improvisierte Texten und Singen als tatsächliche Kunst beschrieben. Die Qualität des Dargebotenen wird mit jener der Europäer gleichgesetzt. Dies erstaunt doch und dürfte zu damaliger Zeit eine Provokation für den ein oder anderen einheimischen Leser dargestellt haben. Eine indirekte Begründung – nicht weniger brisant – wird ausgerechnet am Beispiel der Tahitianer gegeben, denen doch nur wenige Textpassagen zuvor die Kunst des Gesanges abgesprochen wurde:
Die Taheitier pflegen, wie auch die Griechen ehemals thaten, ihre Verse stets singend zu recitiren. Diese kleinen Gedichte werden mehrentheils aus dem Stegereif gemacht. […] Die Verse haben ein förmliches Sylbenmaaß, und beym Singen wird die Quantität ausgedruckt.[25]
Hier werden die Tahitianer mit dem antiken Griechenland verglichen und dadurch in eine indirekte Beziehung mit den Europäern und deren Tradition gesetzt. Nach dieser Darstellung bliebe zwar die tahitianische Bevölkerung in ihrer Entwicklung Tausende Jahre hinter den Europäern zurück, aber ihre Wurzeln wären die gleichen. Neben diesen erstaunlichen Ausführungen fällt ein weiteres Mal der Versuch auf, das Wahrgenommene mit den eigenen Begrifflichkeiten zu beschreiben: Es wird von »Versen« gesprochen, die ein »förmliches Silbenmaaß« hätten.
Alles in allem bleibt festzuhalten, dass sich die Forsters vergleichsweise wenig mit Musikinstrumenten auseinandersetzen. In nur wenigen Aufzeichnungen werden Instrumente explizit beschrieben, wobei vor allem die flötenartigen Instrumente exemplarisch und vergleichend vorgestellt werden. Trommeln werden zwar öfter erwähnt, aber kaum beschrieben.[26] Neben ihnen findet der Gesang und seine Ausprägung Einzug in die Beschreibung. Allerdings wird er lediglich an einer Stelle dem Leser näher gebracht. Während die Instrumente und Gesänge auf weniger Zustimmung bei den Forsters stoßen, hegen sie Respekt für die Improvisationskünste der Insulaner.
2.2 Zur Rolle von Musik im gesellschaftlichen Leben
Die Forscher kamen mit der musikalischen Praxis der Inselkulturen sowohl in deren Alltag als auch zu besonderen Anlässen in Kontakt.[27] Zum Bereich des Alltags werden in dieser Untersuchung der Umgang mit und der Ausdruck von Musik gezählt, die den Ethnien als typisch und sich stets ereignend zugeschrieben werden. Als besondere Anlässe werden solche angesehen, die sich nicht oder nur selten wiederholen.
Wie bereits oben konstatiert, geben die Forsterschen Werke nur selten Einblicke in die fremden Musikinstrumente. Gleiches gilt auch für die Behandlung von Musik im Alltagsleben der bereisten Völker. Wenn allerdings Rezeptionen von Musik im Alltag ihren Niederschlag in die Schriften finden, so wird ihr ein hoher Stellenwert für die Insulaner zugeschrieben. So heißt es in Bemerkungen zu den Bewohnern von Mallikollo:
Frölichkeit, Musik, Gesang und Tänze sind bei ihnen sehr beliebt.[28]
Und zu den Neuseeländern wird im gleichen Werk festgehalten:
Fabeln und romantische Erzählungen, Musik, Lieder, Tänze sind ihr Zeitvertreib.[29]
Ähnliches wird über die Bewohner der schon früher bereisten portugiesischen Insel Madeira berichtet, die nicht nur in der Freizeit, sondern trotz widriger Lebensumstände ebenso vergnügt während der Arbeit musizierten:
[…] dennoch sind sie bey aller Unterdrückung lustig und vergnügt, singen bey der Arbeit und versammeln sich des Abends, um nach dem Schall einer einschläfernden Guitarre zu tanzen und zu springen.[30]
Schon aus den genannten Beispielen lässt sich ersehen, dass Musik im Alltagsleben laut den Forsters bei vielen Kulturen eng mit Tänzen verbunden war. Oftmals hätten diese bei Nacht und in großem Stil stattgefunden, wie es in Reise um die Welt u. a. für die Bewohner von Raiatea (Gesellschaftsinseln) beschrieben wird:
Überhaupt halten sie es mit allen Arten von sinnlicher Freuden; und daher ist Musik und Tanz allenthalben ihr Zeitvertreib. Diese Tänze sollen des Nachts ungebührlich ausschweifend seyn, doch wird keinem, als blos den Mitgliedern der Gesellschaft, der Zutritt verstattet.[31]
An dieser wiederum sachlichen und knappen Beschreibung ist zu erkennen, dass die Forsters nicht immer die Möglichkeit hatten, die Vorgänge mit eigenen Augen zu sehen. Ebenso kann ein identitätsstiftendes Moment in den abendlichen Musik- und Tanzveranstaltungen von Raiatea aufgrund ihres geschlossenen Charakters gesehen werden. Dass die Tänze ausschweifend gewesen seien, lässt auf die Länge und Lautstärke der nächtlichen Veranstaltungen schließen. Aber dürfte eine sexuelle Anzüglichkeit der Tänze darin inbegriffen sein. So ist in den Bemerkungen bezüglich desselben Volks zu lesen, die Gesänge und Tänze der Bewohner »athmen Wollust«[32]. Die sexuellen Reize, die die Autoren anscheinend verspürten, werden ebenso für die Frauen Tahitis in Verbindung mit ihren musikalischen Ausdrucksformen festgestellt.[33]
Die beiden Forsters widmen sich in vergleichsweise ausführlicher Weise dem Erlebnis eines Hivas. Allerdings widersprechen sich die beiden in der Verortung des Erlebten: Während Georg Forster die Beschreibungen auf die Insel Raiatea bezieht, spricht Johann Reinhold Forster von Tahiti. Da aber in beiden Berichterstattungen ganz ähnliche Charakteristika sowohl den Protagonisten, als auch dem Ereignis zugesprochen werden, ist davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um den gleichen Beobachtungsgegenstand handelt. Ob das Gesehene nun in Raiatea oder auf Tahiti stattfand, lässt sich nicht anhand der beiden Werke herausfinden.
Der Hiva sei ein öffentlicher Tanz gewesen und »abermalig« aufgeführt worden.[34] Er sei in vier Akte untergliedert gewesen, die von einem Trommelspiel eingeleitet worden seien, wobei diese »von vier oder fünf Leuten blos mit den Fingern, aber mit unglaublicher Geschwindigkeit geschlagen« worden seien.[35] Die Zuschreibung der geschickten Spielweise ist nicht nur als Respektsäußerung, sondern auch als Hinweis für ein schnelles Zusammenspiel der Musiker zu verstehen.
Daraufhin wären Tänzerinnen dazu gestoßen. Sie hätten sich in ihren Bewegungen zum einen nach dem Trommelspiel gerichtet, zum anderen aber auch nach einem alten Mann, dem »Ballettmeister«[36], »der mit tanzte und einige Worte hören ließ, die wir, dem Ton nach, für eine Art Gesang hielten.«[37] Um nach Georg Forsters Formulierung zu urteilen, war jener Gesang des Mannes in den Ohren der Forsters nicht angenehm, zumindest ungewohnt.
Davon abgesehen, dass die Mundbewegungen der tanzenden Frauen von beiden Forsters als äußerst unästhetisch wahrgenommen wurden,[38] imponierte ihnen der Tanz. In den Armbewegungen der Tänzerinnen sei doch »viel Grazie und in dem beständigen Spiel ihrer Finger ebenfalls etwas ungemein zierliches.«[39] Die Europäer »überhäuften die Tänzerinnen« nach der Darbietung aus Begeisterung »mit Corallen und anderm Putzwerk«.[40]
Die Aufzeichnungen der Forsters gehen in ihren Musikbeschreibungen stellenweise ebenso auf die weniger alltäglichen, besonderen Ereignisse ein, die sich im Leben der Insulaner oder in direktem Kontakt zwischen den Europäern und den Fremden zutrugen. So berichtet Georg Forster in Reise um die Welt von einem Zusammenstoß zwischen den Einwohnern Mallikolos und der Crew von Cook: Während die Einwohner sich mit den Europäern auf deren Schiff kennenlernten, eskalierte die Situation. Es war nicht genug Platz an Deck und so wurden einige Insulaner wieder zurück geschickt. Einige ließen sich von den Europäern provozieren und richteten Pfeile auf die Mannschaft, andere schwammen zurück an Land.
Kaum hatten sie dasselbe erreicht, so hörte man in unterschiednen Gegenden Lerm trommeln, und sahe die armen Schelme […] truppweise beysammen hucken, ohne Zweifel um Rath zu halten, was bei so critischen Zeitläufen zu tun sey?[41]
An dem Beispiel lässt sich erkennen, dass die Insulaner ihre Trommeln nicht nur für Tänze und andere musikalische Aufführungen nutzten, sondern auch als militärisches Mittel. Über diese Funktion von Musik wird in Bemerkungen ebenfalls über die Neuseeländer berichtet:
Sie beginnen sogar ihre Gefechte mit kriegerischem Tanz und Gesang.[42]
In einer näheren Ausführung zum neuseeländischen »Schlachtgesange« schreibt Johann Reinhold Forster:
Die Neuseeländer pflegten uns zuweilen mit ihrem Schlachtgesange zu unterhalten. Einer stimmte ihn an, und stampfte dabey heftig mit den Füssen, machte allerley Bewegungen und Gebehrden dazu, und schwenkte seine Streitaxt. Am Ende jeder Strophe folgte eine Art von Ritornell, in welches der ganze wilde Haufen, als Chor, mit lautem gräßlichen Geschrey einstimmte. Dadurch erhitzen sie sich bis zu einem gewissen Grade von Raserey, welches der einzige Gemüthszustand ist, in dem sie handgemein werden.[43]
Auffällig ist abermals die wiederholte Verwendung von Begriffen aus der europäischen Musiktheorie: Forster spricht von Strophen, einem wiederkehrenden Ritornell und einem Chor, was eigentlich nicht so recht mit diesem angeblichen »wilde[n] Haufen« und »gräßlichen Geschrey« zusammenpassen will. Um die Erfahrungen wiederzugeben, benötigt er anscheinend auch hier ein Begriffswerkzeug, das ihm und seinen Lesern bekannt ist.
Neben seiner Abwertung der wahrgenommenen Musik scheint doch die Äußerung interessant, dass sich die Neuseeländer über die Musik in einen Zustand versetzen könnten, der sich stark von ihrem eigentlichen, von Forster attestierten Wesen abhebt: Dies sei der »einzige Gemüthszustand«, der sie »handgemein« werden ließe. Wie diese Bösartigkeit aussah, lässt er im Dunkeln. Doch bleibt für ihn die Erkenntnis, dass sich die Neuseeländer über die Musik in einen aggressiven Zustand versetzen und für ein mögliches Gefecht rüsten konnten.
Eine weitere Episode handelt von einer Hochzeit auf Tahiti, der die Forsters aber nicht selbst beiwohnten. Dennoch gibt der ältere Forster in Bemerkungen die Szenerie wieder, wie sie von einem Landsmann auf Tahiti gesehen worden sein soll.[44] Dieser hätte beobachtet, wie während der Trauungsprozedur zehn bis zwölf Personen, vor allem Frauen, …
umherstanden, und einige Worte in einem singenden Tone, als Recitative, hersagten. Zwischen den Absätzen dieses Gesanges antworteten Maheine und seine Braut durch kurze Formeln.[45]
Kann den Aussagen des unbekannten Zeugen vertraut werden, dann wäre die Vokalmusik ein Ritualbestandteil tahitianischer Hochzeiten gewesen. Mehr erfährt der Leser leider nicht zu dem musikalischen Anteil an der Prozedur.
Ein weiterer, von Johann Reinhold Forster selbst beobachteter Anlass, bei dem Musik eine wichtige Rolle spielte, war ein Begräbnis auf der Insel O-Tahà, das denn auch etwas präziser beschrieben wird:
Auf der Insel O-Tahà war ich bey einem Begräbniße zugegen, wo drey kleine Mädgen tanzten, und drey Mannspersonen Zwischenspiele vorstellten. Zwischen den Aufzügen traten die Freunde und Verwandten (Hea-biddi) des Verstorbenen, vom Kopf bis auf die Füsse bekleidet, paarweise vor den Eingang der Hütte, jedoch ohne hineinzugehen. Darauf ward der Platz auf welchem das Schauspiel vorgestellt worden war, ein Fleck von 30 Schuh in Länge, und acht Schuh in der Breite, mit Zeug belegt, und dieses dem Trommelschlägern, die während der Vorstellung Musik gemacht hatten, zum Geschenke gegeben. […] nur so viel erfuhr ich, es sey gebräuchlich, daß, bey dem Absterben vornehmer Leute, der erste Leidtragende, zur Begräbnißfeyer in dem weitr oben beschriebenen Trauerkleide umher gehe, und daß Schauspiele, von Tänzen und Gesängen begleitet, angestellet würden.[46]
Die Darstellung der Szenerie zeigt auf, dass eine musikalische Umrahmung des Begräbnisses zum Ritual der Bevölkerung auf O-Tahà gehörte. Anscheinend handelte es sich hierbei um die Beerdigung eines Menschen hohen Ranges innerhalb der Gesellschaft. Wahrscheinlich wurde auch nur Bewohnern mit hohem Ansehen solch eine musikalisch garnierte Trauerfeier zuteil. Forster erwähnt auch hier die Trommelspieler, die während des Rituals Musik machten. Dass sie das niedergelegte »Zeug« geschenkt bekamen, kann als Zeichen der Achtung gegenüber den Musikern gewertet werden. Auch die Feststellung, Musiker hätten nur bei außerordentlichen Zeremonien mitgewirkt, unterstreicht die Annahme ihrer gesellschaftlichen Stellung.
Doch treten in der Darstellung nicht nur Trommler auf, sondern ebenso drei tanzende Mädchen und drei Männer, die die »Zwischenspiele vorstellten«. Was mit diesen Zwischenspielen tatsächlich gemeint ist, bleibt dem Leser verschlossen. Dass es sich bei diesem Begräbnis jedoch um eine Veranstaltung gesellschaftlichen Rangs, von einem größerem künstlerischem Programm umrahmt, handelte, wird deutlich. Der Musik wurde demnach ebenso auf O-Tahà große Bedeutung zugesprochen.
Bei zusammenfassendem Blick auf die beschriebenen Musikfelder im Leben der Gesellschaften fällt auf, dass der Stellenwert von Musik bei den bereisten Kulturen hoch gewesen sein muss und die Forsters dies bereitwillig dokumentieren. Sowohl im alltäglichen Leben als auch zu besonderen Anlässen wurde ihren Berichten zufolge musiziert – zumeist in Verbindung mit Tänzen, die freilich nicht selten als anzüglich beschrieben werden. Wertungen treten bei den Beschreibungen zur Musik im Leben der Gesellschaften ansonsten zurück. Vielmehr wird von den Forsters versucht, die Begebenheiten möglichst ›objektiv‹ wiederzugeben, auch wenn immer wieder Einwürfe subjektiver Wahrnehmungen erkenntlich sind.
Die Untersuchung zeigt zunächst, dass das Thema Musik nur in recht wenigen Passagen der Werke Reise um die Welt und Bemerkungen behandelt wird. Auch rücken nicht alle, sondern nur wenige Inselvölker diesbezüglich in den Fokus: Vor allem den Berichten zu Neuseeland und Tahiti sind Ausführungen zur Musik der fremden Kulturen zu entnehmen. Mit Blick auf die tatsächlich verbrachte Zeit vor Ort verwundert dieser Befund nicht, verweilte Cooks Mannschaft doch während zweier Aufenthalte über fünf Wochen auf Tahiti und noch deutlich länger auf Neuseeland.[47] Weshalb ebenfalls länger besuchte Inseln wie bspw. Huaheine oder die Fidschi-Inseln nicht in die Musikbeschreibungen aufgenommen wurden, lässt sich anhand der Schriften nicht erklären – schließlich ist nicht davon auszugehen, dass die Bevölkerung dort keinerlei Musik praktizierte. Wahrscheinlich ist der Grund in der wissenschaftlichen Ausrichtung der Forsters zu finden: Ihr Forschungsschwerpunkt lag auf der Botanik sowie Ethnographie und nicht auf der Musik fremder Kulturen. Demzufolge ist fast zwangsläufig der Anteil von Musikbeschreibungen gegenüber anderen Feldern nachgestellt und in einigen Inselbeschreibungen schlicht weggelassen worden.
Dennoch lassen sich einige Ergebnisse zur Musikrezeption bei Forster anhand ihrer Beschreibungen eruieren: Da ist zum einen die Art der Beschreibung, bei der die Verwendung von europäischen Musikbegriffen bei beiden Autoren auffällig ist. Begriffe wie Rezitativ, Vers, Strophe usw. zeugen von dem Drang, die Fremdheitserfahrung mit den sicheren Begriffen der Heimat zu beschreiben. Das dient nicht nur dem Autor, sondern erleichtert auch dem europäischen Zeitgenossen die Imagination des Fremden. Dass Johann Reinhold Forster häufiger auf die landesüblichen Bezeichnungen von Tänzen, Gesängen etc. eingeht, verwundert bei seiner Intention der Abfassung einer wissenschaftlichen Arbeit selbstverständlich nicht.
Zum anderen tragen die Beschreibungen inter- wie auch intragruppale Vergleiche in sich. Zu ersterem können jene zur europäischen Musik gezählt werden, die sich beispielsweise bereits indirekt in den genutzten europäischen Musikbegriffen oder direkt am Beispiel der festgestellten Improvisationskunst der Südländer, die jener Europas nicht nachstehe, auszumachen sind. Intragruppale Vergleiche werden von den Forsters dort vorgenommen, wo sie die festgestellten Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den fremden Kulturen benennen, u. a. bei Johann Reinhold Forsters Versicherung, die Vokalmusik der Tahitianer wäre jener der Einwohner Tannas und Neuseelands qualitativ nachzustellen.
Beim fokussierten Blick auf die wenigen Passagen Forsterscher Musikrezeption fällt der hohe Ausbreitungsgrad und Stellenwert von Musik im Leben der diesbezüglich beschriebenen Kulturen auf, den die beiden Chronisten beschreiben. Sowohl im Kontext des Alltagslebens als auch von Feierlichkeiten wird der Musik auf mehreren Inseln eine besondere Bedeutung zugemessen. Ihre Funktion lag sowohl in dem gemeinschaftlichen Ritual des Alltags als auch in der Umrahmung von Hochzeiten (Tahiti), Begräbnissen (O-Tahà) oder in der Vorbereitung eines Gefechts (Neuseeland).
Bezüglich den Forsterschen Ausführungen zu den Instrumenten ist festzuhalten, dass diese nur selten Gegenstand musikalischer Beschreibungen sind. Nach diesen zu urteilen, kamen die beiden Forscher nur mit wenigen exotischen Instrumenten in Kontakt. Hier sind vor allem die tahitianischen Flöten zu nennen, die mit der Nase geblasen wurden. Von der Begegnung mit fremden Harmonieinstrumenten berichten die Autoren nahezu gar nichts. Musiziert worden sei mit Flöten, vor allem aber mit Trommeln und der menschlichen Stimme. Besonders auffällig ist den Berichten zufolge die Bedeutung des Tanzes, der anscheinend bei musikalischen Aufführungspraktiken zu verschiedensten Anlässen auf den Inseln praktiziert wurde. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Musik auf den meisten beschriebenen Inseln nach Ansicht der Forsters ungewohnt rhythmusbetont, weniger harmonie- als melodiereich gewesen sein musste und überwiegend im Zusammenwirken mit Tänzen aufgeführt wurde.
Zuletzt sei noch auf die Forstersche Sicht auf die Völker und die Bewertung des Reifegrades derer Musik eingegangen: Sowohl in der Reise um die Welt als auch in den Bemerkungen werden die Insulaner als Menschen angesehen, was damals noch immer alles andere als üblich war. Durch den Vergleich der tahitianischen Musik mit jener der Griechen werden sie und ihre Kunst gar in eine gemeinsame Traditionslinie mit den Europäern gestellt. Nur seien sie unterschiedlich weit entwickelt und hätten allesamt noch nicht das Stadium der Europäer erreicht; es bleibt offen, ob die Inselvölker nach Meinung der Forsters zu einer Entwicklung und einer Geschichtlichkeit überhaupt in der Lage seien. Die weniger entwickelten Techniken in verschiedenen Bereichen der Völker seien aber durchaus auch von Vorteil für deren Mentalität gewesen. So soll ein Zitat aus den Bemerkungen den Abschluss dieser Studie bilden, das Johann Reinhold Forsters Rekapitulation seiner „Allgemeine[n] Übersicht über das Glück der Insulaner im Südmeere“ entnommen ist und ihn voller Respekt für die Insulaner zeigt:
Indeß die Knaben und Mädgen mit Tanz und Gesang sich ergötzten, und die reifere Generation an ihren Freuden thätigen Antheil nahm, entdeckten wir oft im sanften, freudigheitern Blick des ehrwürdigen Alten, ein stummes Zeugniß ihres und seines Glücks. Daher sind wir auch völlig überzeugt, daß diese Insulaner einen Grad von Zufriedenheit geniessen, den man, bey mehr gesitteten Völkern, selten bemerkt, und der desto schätzbarer ist, je allgemeiner er sich auf jeden Mitbürger erstreckt, je leichter er erreichbar ist, und je genauer er mit der gegenwärtigen Verfassung des Volks zusammenstimmt, welches, für höhere Stufen der Glückseligkeit, noch nicht empfänglich ist.[48]
Nachweise und Anmerkungen
[1] Das Wort »Reise« stammt laut Duden vom althochdeutschen »risan«, das u. a. »sich erheben« bedeutet (http://www.duden.de/rechtschreibung/Reise. zuletzt eingesehen am 23. Juni 2014).
[2] Vgl. Moennighoff, Burkhard et al.: Vorwort, zu ders. et al. (Hrsg.): Literatur und Reise, Hildesheim 2013, S. 5.
[3] Ortheil, Hanns-Josef: Schreiben und Reisen. Wie Schriftsteller vom Unterwegs-Sein erzählen, in: Moennighoff, Burkhard et al. (Hrsg.): Literatur und Reise, Hildesheim 2013, S. 7.
[4] Kalb, Gertrud: Travel Literature Reinterpreted. Robinson Crusoe und die religiöse Thematik der Reiseliteratur, in: Anglia. Zeitschrift für englische Philologie 101 (1983), S. 407.
[5] Ebenda, S. 410.
[6] Johann Reinhold Forster: “The thirst of knowledge, [and] the desire of discovering new animals new plants […]”, zitiert nach: Kaeppler, Adrienne: Die ethnographischen Sammlungen der Forsters aus dem Südpazifik. Klassische Empirie im Dienste der modernen Ethnologie, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 59.
[7] Dass die doppelte Einholung der Artefakte tatsächlich der Intention des Weiterverkaufs geschuldet ist, ist wahrscheinlich, aber nicht belegbar. Vergleiche hierzu: Kaeppler, Adrienne L.: Die ethnographischen Sammlungen der Forsters, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 63.
[8] von Hoorn, Tanja: Dem Leibe abgelesen. Georg Forster im Kontext der physischen Anthropologie des 18. Jahrhunderts, Tübingen 2004, S. 22.
[9] Neubauer, Barbara: Nachwort, in: Forster, Georg: Reise um die Welt, hrsg. von Barbara Neubauer, Berlin 1960, S. 646.
[10] Der Astronom der zweiten Cook-Reise, William Wales, Lord Sandwich und ein Rezensent der Göttinger Gelehrten Anzeigen erhoben diese Vorwürfe. Hierzu: Neubauer, Barbara: Nachwort, in: Forster, Georg: Reise um die Welt, hrsg. von Barbara Neubauer, Berlin 1960, S. 646.
[11] Ebenda, S. 645.
[12] Hoare, Michael E.: Die beiden Forster und die pazifische Wissenschaft, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 30.
[13] Als Quellen fungieren die jeweils deutschen Ausgaben der Werke – Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt gesammelt, Berlin 1783; Forster, Georg: Reise um die Welt, in: Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin (Hrsg.), Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. Streitschriften und Fragmente zur Weltreise, 2 Bde., Berlin 1972.
[14] Zu den Musikinstrumenten wird hier auch die menschliche Stimme gezählt.
[15] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 198.
[16] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 246.
[17] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 405f.
[18] Forster, Georg: Reise um die Welt, 2. Teil, S. 248ff.
[19] Allerdings wird jenes Instrument weder in der Reise um die Welt noch in den Bemerkungen explizit beschrieben.
[20] Wie oben erwähnt, kauften die Forsters in der Regel lediglich zwei Exemplare. Vgl. Kaeppler, Adrienne L.: Die ethnographischen Sammlungen der Forsters, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 63.
[21] Auf den Tanz wird in Punkt 2.2 näher eingegangen.
[22] Hier werden neben den Wissenschaften explizit auch die Künste der bereisten Länder vorgestellt. Siehe: Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 375ff.
[23] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 406.
[24] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 403.
[25] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 406f. – Im Übrigen erscheint wenige Zeilen nach dem Zitat in Johann Reinhold Forsters Text der einzige Versuch, Liedabschnitte wiederzugeben. Dabei erfolgt, neben der Textaufzeichnung und -übersetzung, eine Notation des gesungenen Rhythmus in Form von über den Worten eingetragenen Strichen für die langen Noten und Punkten für die kurzen, eingeteilt wird das Notat durch Taktstriche. Siehe Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 407.
[26] Auf die verschiedentlichen Kontexte wird in Punkt 2.2 eingegangen.
[27] Der Begriff ›Alltag‹ kann hier nicht völlig problemlos gebraucht werden, da dieser durch die Anwesenheit von Cooks Crew beeinflusst wurde. Trotzdem soll hier zwischen Beobachtungen des Musikgebrauchs im ›normalen Leben‹ und dem ›besonderen Ereignis‹ unterschieden werden.
[28] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 306.
[29] Ebenda, S. 286.
[30] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 49. – Auf Madeira wird zum einzigen Mal und nahezu beiläufig eine Gitarre als begleitendes Instrument benannt.
[31] Forster, Georg: Reise um die Welt, S. 279; ebenfalls zu dieser Insel: Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 358; siehe auch für die Bewohner von Mallikolo: Forster, Georg: Reise um die Welt, 2. Teil, S. 164.
[32] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 207.
[33] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 412; ebenfalls zur angeblichen Anzüglichkeit tahitianischer Frauen: Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 278.
[34] Vgl. Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 321.
[35] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 322.
[36] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 405.
[37] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 323. – Ähnlich in Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 405.
[38]Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 323f. Bei Johann Reinhold Forster überwiegen beinahe seine Ausführungen zu den Mundbewegungen. Diese seien »nichts als die häßlichste Verunstaltung«, »wiedrig und eckelhaft«. Siehe Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 405.
[39] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 323. Johann Reinhold Forster hebt auch die »Geschicklichkeit und Zierlichkeit« der Fingerbewegungen hervor. Er begründet dies mit ihren anatomischen Voraussetzungen, wonach ihre Finger »fast durchgehends lang gut proportioniert, und zugleich so angenehm biegsam« seien. Siehe Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 404. Gut ersichtlich ist in dieser Passage auch der wissenschaftliche Anspruch des älteren Forsters, der immer wieder die landesüblichen Termini wiederzugeben versucht. So nennt er u. a. die Bezeichnung für die galanten Fingerbewegungen, »Eorre«. Siehe Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 404.
[40] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 324.
[41] Forster, Georg: Reise um die Welt, 2. Teil, S. 167.
[42] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 286.
[43] Ebenda, S. 412.
[44] Ebenda, S. 483f.
[45] Ebenda, S. 484.
[46] Ebenda, S. 412f.; ebenfalls Bezug nehmend auf die Situation, aber keine neuen Erkenntnisse zur Musik: ebenda, S. 490.
[47] Neben der langen Zeit auf See ist die teilweise sehr kurze Verweildauer auf anderen Inseln zu beachten. Eine chronologische Auflistung der bereisten Inseln ist zu finden in: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Hrsg.): Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe, Bd. 3, bearb. von Gerhard Steiner, Berlin 1966, S. 453–455.
[48] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 509. Hier behandelt er die Bewohner Tahitis stellvertretend für die bereisten Völker.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen
Forster Johann Reinhold: Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt gesammelt, Berlin 1783.
Forster, Georg: Reise um die Welt, in: Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin (Hrsg.), Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. Streitschriften und Fragmente zur Weltreise, 2 Bde., Berlin 1972.
Literatur
Hoare, Michael E.: Die beiden Forster und die pazifische Wissenschaft, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 29–44.
von Hoorn, Tanja: Dem Leibe abgelesen. Georg Forster im Kontext der physischen Anthropologie des 18. Jahrhunderts, Tübingen 2004.
Kaeppler, Adrienne: Die ethnographischen Sammlungen der Forsters aus dem Südpazifik. Klassische Empirie im Dienste der modernen Ethnologie, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 59–76.
Kalb, Gertrud: Travel Literature Reinterpreted: Robinson Crusoe und die religiöse Thematik der Reiseliteratur, in: Anglia. Zeitschrift für englische Philologie 101 (1983), S. 407–420.
Moennighoff, Burkhard et al., Vorwort, in: Moennighoff, Burkhard et al. (Hrsg.): Literatur und Reise, Hildesheim 2013, S. 5f.
Neubauer, Barbara: Nachtwort, in: Forster, Georg: Reise um die Welt, hrsg. von Barbara Neubauer, Berlin 1960, S. 635–652.
Ortheil, Hanns-Josef: Schreiben und Reisen. Wie Schriftsteller vom Unterwegs-Sein erzählen, in: Moennighoff, Burkhard et al. (Hrsg.): Literatur und Reise, Hildesheim 2013, S. 7–31.
Elisabeth Sasso-Fruth: Literarische Aspekte in und um Romance und Mélodie
Elisabeth Sasso-Fruth (Leipzig)
Literarische Aspekte in und um Romance und Mélodie
Phillip Moll zum 70. Geburtstag
Dieser Text basiert auf einem Vortrag an der HMT Leipzig im Rahmen des Studientags Lied-Konzepte um 1800 am 21. Juni 2013. – Übertragungen sämtlicher französischer Texte ins Deutsche: Elisabeth Sasso-Fruth.
1. Musik in der Literatur: zu einem Gespräch in Gustave Flauberts Roman Madame Bovary
 In Gustave Flauberts 1857 erschienenem Roman Madame Bovary findet sich im zweiten Kapitel des zweiten Teils folgender Ausschnitt aus einem Gespräch, das zwischen Madame Bovary, dem Apotheker Homais und dem Notargehilfen Léon, der im Fortgang des Romans zum (zweiten) Liebhaber der Titelheldin werden soll, stattfindet:
In Gustave Flauberts 1857 erschienenem Roman Madame Bovary findet sich im zweiten Kapitel des zweiten Teils folgender Ausschnitt aus einem Gespräch, das zwischen Madame Bovary, dem Apotheker Homais und dem Notargehilfen Léon, der im Fortgang des Romans zum (zweiten) Liebhaber der Titelheldin werden soll, stattfindet:
– Ces spectacles [des paysages de montagnes] doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l’extase! Aussi je ne m’étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d’aller jouer du piano devant quelque site imposant.
– Vous faites de la musique? demanda-t-elle.
– Non, mais je l’aime beaucoup, répondit-il.
– Ah! Ne l’écoutez pas, madame Bovary, interrompit Homais en se penchant sur son assiette, c’est modestie pure. – Comment, mon cher! Eh! L’autre jour, dans votre chambre, vous chantiez L’ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire; vous detachiez cela comme un acteur.
Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage, sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire […].
Emma reprit:
– Et quelle musique préférez-vous?
– Oh! La musique allemande, celle qui porte à rêver.
– Connaissez-vous les Italiens?
– Pas encore; mais je les verrai l’année prochaine, quand j’irai habiter Paris, pour finir mon droit.[1]
– Diese Anblicke [der Gebirgslandschaften], müssen den Betrachter einfach in Begeisterung versetzen und stimmen ihn zwangsläufig zum Gebet, zur Ekstase! Übrigens wundere ich mich auch nicht mehr über jenen berühmten Musiker, der, um seine Phantasie noch besser anzuregen, die Gewohnheit hatte, sich zum Klavierspielen immer vor irgendeine imposante Landschaft zu begeben.
– Machen Sie selbst eigentlich auch Musik? fragte sie.
– Nein, aber ich liebe sie sehr, antwortete er.
– Ach! Hören Sie nicht auf ihn, Madame Bovary, unterbrach Homais und beugte sich dabei über seinen Teller, das ist doch die reinste Bescheidenheit. – Was sagen Sie denn da, mein Lieber! He! Neulich haben Sie in Ihrem Zimmer einfach hinreißend L’ange gardien gesungen. Ich hörte Sie vom Labor aus, Sie deklamierten das so deutlich wie ein Schauspieler.
Tatsächlich war Léon bei dem Apotheker untergebracht, wo er in der zweiten Etage ein kleines Zimmer hatte, das zum Platz hinaus ging. Das Kompliment seines Hausherrn ließ ihn erröten […].
Emma fragte weiter:
– Und welche Musik bevorzugen Sie?
– Oh! Die deutsche Musik, die, die einen zum Träumen bringt.
– Kennen Sie auch die Italiener?
– Noch nicht, aber ich werde sie nächstes Jahr sehen, wenn ich nach Paris umziehen werde, um meine Jurastudium zu beenden.
Unter vier Aspekten ist hier von Musik die Rede: Da ist zunächst die Pose des vor imposanter Kulisse spielenden berühmten Pianisten, dann die vom Apotheker zufällig belauschte Darbietung von L’ange gardien durch Léon, der sich in seinem Zimmer unbeobachtet wähnte, schließlich werden kurz die »deutsche Musik« und »die Italiener« angetippt.
Zunächst soll L’ange gardien näher betrachtet werden. Der Titel des von Léon gesungenen Stückes ist von Flaubert nicht ganz genau wiedergegeben, er lautet korrekt A mon ange gardien. Es handelt sich um eine Romance aus der Feder von Pauline Duchambge (1776–1858), die Graham Johnson als “France’s first notable woman song composer” bezeichnet.[2] Duchambge war in ihrem Schaffen äußerst produktiv: Zwischen 1816 und 1840 schrieb sie rund 400 Romances. Die Komposition A mon ange gardien entstand um 1825, also zum Ende der Blütezeit der Romance als Salonromanze in Frankreich,[3] die in die Revolutionszeit, unter das Empire und die Restauration fällt. Die Autorschaft des vertonten Textes ist unklar. Doch war dieses Gedicht um 1825 sehr bekannt und beliebt.[4]
2. Analyse von A mon ange gardien von Pauline Duchambge
Faksimile:[5]
A mon ange gardien
Bon ange ô sauvez moi d’une erreur dangereuse,
Je ne veux pas l’aimer, l’amour fait trop souffrir!
Mais il me suit partout je suis bien malheureuse
Comment faire mon ange, hélas! pour le haïr?
Quand il m’ouvre son cœur en vain je le repousse
Il pleure et moi ces pleurs me donnent de l’effroi
Je ne veux pas l’aimer, mais sa voix est si douce
Ô mon ange veillez sur moi!Il m’avait autrefois, donné la tourterelle
Que (je sais pourquoi) je préfère aujourd’hui
Lorsque je la caresse, elle me le rappelle,
Je trouve qu’elle est triste, et douce comme lui
En rêvant l’autre jour, j’interrogeai moi-même
Ces fleurs qui des amants peignent dit-on la foi…
Les fleurs que j’effeuillais disaient toutes je t’aime
Ô mon ange, veillez sur moi.Tous les lieux qu’il chérit, je les chéris de même
La couleur qu’il préfère est la mienne à présent,
Je ne chante jamais que la chanson qu’il aime
J’adopte tous les mots qu’il répète souvent
Je conserve toujours la fleur qu’il m’a donnée
Elle est là sur mon cœur… et cependant je crois
Que depuis bien long tems cette fleur est fanée
Ô mon ange veillez sur moi.(Transkription nach dem Manuskript ohne Korrektur von Interpunktion und Rechtschreibung)
An meinen Schutzengel
Guter Engel, oh rette mich vor einem gefährlichen Fehler,
Ich möchte ihn nicht lieben, Liebe bedeutet zu viel Leid!
Doch er folgt mir überall hin, ich bin ziemlich unglücklich,
Was soll ich nur tun, mein Engel, ach! um ihn zu hassen?
Wenn er mir sein Herz öffnet, dann weise ich ihn vergeblich zurück,
Er weint und mich, mich erschrecken diese Tränen,
Ich möchte ihn nicht lieben, aber seine Stimme ist so sanft,
Oh, mein Engel, wache über mich!Er hatte mir einst die Turteltaube geschenkt,
die (ich weiß wohl, warum) ich heute am liebsten habe,
Wenn ich sie liebkose, erinnert sie mich an ihn,
Ich finde, dass sie so traurig und so sanft ist wie er.
Neulich ging ich im Traum in mich
Diese Blumen, von denen es heißt, sie stünden für die Treue der Liebenden…
Die Blumen, die ich abzupfte, sagten alle: ich liebe dich.
Oh, mein Engel, wache über mich.All die Plätze, die ihm so lieb sind, sind auch mir so lieb,
Seine Lieblingsfarbe ist gerade auch die meine,
Ich singe immer nur das Lied, das er so gerne hat,
Ich sage die gleichen Worte, die er so oft ausspricht,
Ich habe noch immer die Blume, die er mir geschenkt hat,
Sie ist da, auf meinem Herzen… und doch glaube ich
Dass diese Blume schon seit langer Zeit verwelkt ist.
Oh, mein Engel, wache über mich.
2.1. Literarische Analyse von A mon ange gardien in Hinblick auf gattungstypische Merkmale der Romance
2.1.1. Aufbau und Metrik
Entsprechend der Tradition der Romance ist die vorliegende Komposition in Strophenform verfasst. Eher untypisch ist der Verzicht auf einen Refrain, doch bei »Pauline Duchambge gibt es in der Regel keine Refrains.«[6] Außerdem erinnert der Endvers der drei Strophen, der immer denselben Wortlaut aufweist, entfernt an dieses Gattungsmerkmal.
Der Wechsel von männlichen und weiblichen Versen und das alternierende Reimschema erfolgen mit Regelmäßigkeit. Diese kennzeichnet auch die Versabfolge innerhalb der Strophen: auf sieben Alexandriner folgt immer ein Achtsilbler. Mit den Alexandrinern und den Achtsilblern kommen in diesem Gedicht zwei der klassischen französischen Verse zur Anwendung, die hier auch beide genau in der Mitte zäsiert sind (also der Alexandriner nach der sechsten, der Achtsilbler nach der vierten Silbe). Nur eine einzige Abweichung weist das Manuskript in der sonst so regelmäßigen Metrik auf, nämlich im zweiten Vers der zweiten Strophe, die aus einem Elfsilbler besteht. Vermutlich liegt allerdings hier ein Versehen vor und es wurde einfach ein ne vergessen: « Que (je ne sais pourquoi) je préfère aujourd’hui ». Dann würde die Aussage in der Klammer verneint: »die (ich weiß nicht warum) ich heute am liebsten habe«. Diese Verneinungspartikel würde nicht nur dem Versschema durchgängig zur Regelmäßigkeit verhelfen, sondern auch inhaltlich besser zur ›Psychologie‹ der Sprecherin in diesem Gedicht passen (siehe unten). Insgesamt lässt sich feststellen, dass die metrischen Strukturen des Textes keine Überraschungen bergen. Dies erleichtert und fördert die Einprägsamkeit des Textes.
2.1.2. Inhalt und sprachliche Aspekte
Das für die Romance typische sentimentale Sujet[7] des Gedichtes lässt sich folgendermaßen kurz zusammenfassen: Ein Mädchen wehrt sich gegen das Gefühl der Liebe, die es für einen Mann empfindet, der ihm ebenfalls in Liebe zugeneigt ist.
Das weibliche lyrische Ich ist offensichtlich noch sehr jung und ›unschuldig‹. Dafür sprechen:
- die gebetartige Hinwendung der Sprecherin in ihrer ›Not‹ an den Schutzengel, den sie um Hilfe bittet (Gesten des Gebets: vgl. I,1 und den sich je wiederholenden Schlussvers)
- die pubertär anmutende Dringlichkeit, mit der sie dies tut (I,1 und I,4: unvermittelte Anrede des Schutzengels, emphatische Interjektion (« hélas! »), die hilflose, litaneiähnliche Selbstüberantwortung an den Schutzengel jeweils im Schlussvers aller drei Strophen)
- das ›Dilemma‹ selbst – denn worin liegt eigentlich das Problem der jungen Frau? Offensichtlich ist die Erfahrung der Liebe für sie neu, ihre Reaktionen auf die Liebesbekundungen des jungen Mannes sind erschreckt und scheinen deshalb hilflos (siehe I,3f. und I,6f.).
- ihr Umgang mit der ›Notsituation‹: Unfähigkeit zur Abstrahierung und Verortung der neuen Erfahrung im eigenen Leben, dieses Liebeserlebnis bleibt ausschließlich auf der Ebene der Emotionen verhaftet. Die umgangssprachliche umständliche Wortstellung in I,6 bildet die emotionale Verwirrung auf sprachlicher Ebene ab.
- Die einzige ›abstrakte‹ Einsicht « l’amour fait trop souffrir » (I,2) scheint mit ihrer fast apodiktischen Gesetztheit eher aus der Überlieferung bzw. einer Spruchsammlung als aus der eigenen Erfahrung der Sprecherin zu stammen. Sie verlässt sich ziemlich unreflektiert auf »Hörensagen« (« dit-on », II,6).
- (Rück)halt und Antworten auf ihre Fragen sucht sie auf metaphysischer Ebene (Schutzengel) und in schlichten (abergläubischen) Volkstraditionen (Abzupfen der Blütenblätter).
Die erste Strophe setzt mit großer emphatischer Geste ein (im ersten Vers: Anrufung des Schutzengels (« Bon ange »); dramatische Bitte um Rettung (« sauvez-moi ») vor einer Gefahr (« dangereuse »), an der sie selbst zumindest eine Mitschuld hat (« erreur »)). Der Zuhörer wird sofort vom Sujet ergriffen und emotional involviert. Außerdem ist die Tatsache, dass das Mädchen hier dem Schutzengel sein Herz ausschüttet, Garantie dafür, dass die Rede des Mädchens – die übrigens auch sprachlich sehr einfach und leicht verständlich ist – absolut aufrichtig und unverfälscht ist. Sie zeugt von der Unverderbtheit des Mädchens, wodurch diesem wiederum die unbedingte Sympathie des Zuhörers sicher ist. Die dramatische Sprechhaltung durchzieht die ganze erste Strophe.
In der zweiten Strophe weicht diese Dramatik der Erinnerung (« autrefois » – Geschenk der « tourterelle » – « l’autre jour ») und der Reflexion (« je m’interrogeai moi-même » – ›Befragen‹ der Blumen, denn die »sagen die Wahrheit über die Liebe«). In der dritten Strophe klopft die junge Frau ihre eigenen Vorlieben (« couleur [préférée] ») und ihr eigenes Verhalten (« chanson » – « mots ») auf Anzeichen für die Seelenverwandtschaft mit dem (verehrten) Verehrer ab. Die Reflexionen und Selbstvergewisserungen sind von großer Schlichtheit und Klischeehaftigkeit und zeichnen insgesamt das Bild eines hochemotionalen und naiven Mädchens, das – dies die Pointe des Gedichtes – sich vielleicht zu lange gegen seine eigenen Gefühle sträubte (« fleur […] fanée »), was die Geschichte für die Protagonistin vermutlich nicht gut ausgehen lässt.
Der Leser, der von Anfang an auf die Denk- und Gefühlsebene des Mädchens gebracht wird, wird emotional in dessen ›Geschichte‹ involviert und kann,wenn er dem Mädchen gegenüber einen Vorsprung an Lebenserfahrung hat und die Situation etwas zu abstrahieren vermag, in der Sprecherin das tragische Opfer ihrer eigenen Unschuld erkennen.
2.2. Musikalische Analyse von A mon ange gardien in Hinblick auf gattungsspezifische Merkmale der Romance
Das Stück A mon ange gardien ist eine Komposition für Gesang mit Klavierbegleitung. Die Melodie ist einfach und weist – wie bei der Romance üblich[8] – keine melodische Überfrachtung auf. Abgesehen von einer einzigen Stelle im vorletzten Takt (die eine Silbe « sur » verteilt sich auf drei Noten) gibt es in dem Stück keine Melismen und keine rhythmischen oder harmonischen Auffälligkeiten. Zwar unterstreicht ein durch Pausen etwas ›bewegterer‹ Rhythmus vor allem in der ersten Strophe den Text an der Stelle « Comment faire, mon ange, hélas, pour le haïr » und lässt sich eine harmonische Auffälligkeit bei dem Auflösungszeichen über dem Wort « Amour » (erste Strophe, zweites System im Manuskript) feststellen, doch tut dies insgesamt der rhythmischen und harmonischen Einfachheit der Komposition keinen Abbruch.
Mit dem Klavier wählt Pauline Duchambge ein für die Romance neben der Gitarre oder Harfe gängiges Begleitinstrument.[9] Obwohl die Begleitung anspruchsvoller als der Gesangspart ist, hält auch diese sich vom Schwierigkeitsgrad her in Grenzen. Es sind keinerlei Bestrebungen nach Unabhängigkeit der Begleitung festzustellen, vielmehr dient die Begleitung – gattungstypisch – dem Gesang.[10]
Auch auf musikalischer Ebene kommt die Strophenform der Verständlichkeit des Textes entgegen, schließlich lässt angesichts der Wiederholung ab der zweiten Strophe das Interesse an der musikalischen Ausformung bzw. der Melodie nach und der Rezipient lenkt seine Konzentration vornehmlich auf den Text.
Die nur einen Vers (acht Silben) umfassende Identität des jeweiligen Schlussverses der drei Strophen ist auch in musikalischer Hinsicht zu kurz, um von einem Refrain sprechen zu können. Doch setzt Duchambge trotz des Verzichtes auf einen Refrain im eigentlichen Sinne in ihrem Stück kunstvoll akustische Wiedererkennungseffekte ein. So ist die Melodie auf den ersten und letzten Alexandriner (also auf den jeweils ersten und siebten Vers einer jeden Strophe) identisch, wobei auf eine minimale rhythmische Differenz hingewiesen sei: punktierte Achtel plus Sechzehntel im ersten Alexandriner vs. zwei Achtel im zweiten Alexandriner. Allerdings ist dieser melodische Abschnitt immer mit einem anderen Text unterlegt.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass mit A mon ange gardien ein auf Emotionalität abzielendes Stück vorliegt, das sowohl auf der Textebene als auch in der musikalischen Bearbeitung dem Ideal der Einfachheit und Schlichtheit verpflichtet ist. Die Komposition ist intelligent, stellt aber weder an den Sänger noch an den Begleiter allzu hohe Ansprüche und ist somit relativ einfach auszuführen.
3. Die Romance im 18. Jahrhundert
Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei A mon ange gardien um eine Romance. Als musikalische Gattung beschäftigte diese bereits im 18. Jahrhundert die Theoretiker. Vor dem Hintergrund der im zweiten Abschnitt der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Analyse des Stückes von Pauline Duchambge seien hier als Folie die Definitionen der Romance in der Encyclopédie von Diderot und d’Alembert (1765) und aus dem Dictionnaire de musique von Rousseau (1768)angeführt:
Vieille historiette écrite en vers simples, faciles et naturels. La naïveté est le caractère principal de la romance […]. Ce poème se chante et la musique française, lourde et niaise, est, ce me semble, très propre à la romance.[11]
Alte Anekdote, geschrieben in schlichten, einfachen und natürlichen Versen. Die Unbefangenheit ist das Hauptmerkmal der Romance […]. Dieses Gedicht wird gesungen und die französische Musik, die plump und einfältig ist, scheint mir für die Romance sehr geeignet zu sein.
ROMANCE. Air sur lequel on chante un petit poème du même nom, divisé par couplets, duquel le sujet est pour l’ordinaire quelque histoire amoureuse et souvent tragique. Comme la romance doit être inscrite d’un style simple, touchant, et d’un goût un peu antique, l’air doit répondre au caractère des paroles; point d’ornements, rien de maniéré, une mélodie douce, naturelle, champêtre, et qui produise son effet par elle-même, indépendamment de la manière de la chanter […] quelquefois on se retrouve attendri jusqu’aux larmes sans pouvoir dire où est le charme qui a produit cet effet. […] Il ne faut, pour le chant de la romance, qu’ une voix juste, nette, qui prononce bien, et qui chante simplement.[12]
ROMANCE. Weise, nach der man ein kleines Gedicht mit derselben Bezeichnung singt, das in Couplets unterteilt ist und dessen Sujet gewöhnlich irgendeine Liebesgeschichte ist, die oft tragisch verläuft. Da die Romance in einem einfachen, anrührenden und etwas altertümlichen Stil verfasst sein soll, muss die Weise dem Charakter der Worte entsprechen; keine Verzierungen, nichts Manieriertes, eine sanfte, natürliche, ländliche Melodie, die ihre Wirkung aus sich selbst heraus erzielt, unabhängig von der Art, wie sie gesungen wird […] manchmal ist man am Schluss zu Tränen gerührt und vermag aber nicht einmal zu sagen, wo der Reiz zu suchen wäre, der diese Wirkung erzielte. […] Für das Singen einer Romance bedarf es lediglich einer natürlichen, klaren Stimme, die gut ausspricht und einfach nur singt.
Auch wenn diese beiden Definitionen noch aus der Zeit vor der »sentimentalen Salonromanze«[13] stammen, die 1783 mit Giovanni Paolo Martinis Plaisir d’Amour[14] begründet wird und der, wie bereits erwähnt, auch A mon ange gardien noch zuzurechnen ist, sind die wesentlichen Charakteristika der Romance bereits benannt. Rousseau – der übrigens auch selbst Romances komponierte[15] und so aktiv zur Herausbildung des Genres beitrug – hält klar fest, dass sich die Musik (und zwar sowohl die Vertonung als auch die Ausführung) nach dem Gedicht zu richten und sich also diesem unterzuordnen habe. Es geht vor allem darum, Emotionen und das Sujet zu befördern. Der Primat des Textes und des Sujets erklärt auch, warum Rousseau auf die deutliche Aussprache großen Wert legt. In dem eingangs angeführten Zitat aus Flauberts Roman tut dies übrigens auch der Apotheker Homais, der zufällig Zeuge von Léons Darbietung des Ange Gardien wurde, lobt er diesen doch vor allem dafür, dass er alles so deutlich wie ein Schauspieler ausgesprochen habe.
4. Die Romance in Flauberts Madame Bovary
Selbstverständlich ist es problematisch, Romanfiguren als verlässliche Garanten für die Rezeption der Romance heranzuziehen, insbesondere wenn sie, wie in diesem Falle der Apotheker Homais in Flauberts Roman, ironisch gebrochen sind. Ihr in der Immanenz des Romans geäußertes Urteil muss dem des Erzählers (und des Autors) sowie dem der Wissenschaft bzw. Musikwissenschaft gegenübergestellt werden und sich hinsichtlich objektiver Aussagen über die musikalische Gattung der Romance behaupten.
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine zweite Stelle aus Madame Bovary, an der von der Romance die Rede ist. Sie befindet sich im sechsten Kapitel des ersten Teils von Madame Bovary, das rückblickend von der Erziehung der Klosterschülerin Emma handelt. Diese verschlang in ihrer Jugend nicht nur begeistert romantische Lektüren (etwa aus der Feder von Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand oder Walter Scott, um nur einige zu nennen), auch der Musikunterricht bot ihr vielerlei Anregungen:
A la classe de musique, dans les romances qu’elle chantait, il n’était question que de petits anges aux ailes d’or, de madones, de lagunes, de gondoliers, pacifiques compositions qui lui laissaient entrevoir, à travers la niaiserie du style et les imprudences de la note, l’attirante fantasmagorie des réalités sentimentales.[16]
Im Musikunterricht war in den Romances, die sie sang, nur von kleinen Engeln mit goldenen Flügeln, von Madonnen, von Lagunen, von Gondolieri die Rede, friedselige Kompositionen, die sie durch die Albernheit des Stils und die Unzulänglichkeiten der Vertonung das verlockende Wahngebilde der Wirklichkeit der großen Gefühle erahnen ließ.
Während sich in dem zuerst angeführten Zitat aus dem Roman, dem Gespräch zwischen Madame Bovary, Léon und Homais, die Romanfiguren in direkter Rede quasi ›ungefiltert‹ äußerten, ergreift bei der Schilderung des Musikunterrichts Emmas, der späteren Madame Bovary, der Erzähler (der nicht mit dem Autor zu verwechseln ist!) das Wort. Angefangen von der Lexik – hier wird beispielsweise der Gattungsbegriff Romance verwendet und diese ziemlich ›komplex‹ beschrieben – bis hin zu der scharfsinnigen Analyse der Auswirkung des Musikunterrichts auf die Protagonistin entspricht dabei nichts dem Sprechen und Denken Emmas; das vernichtende Urteil des Erzählers über die »alberne« Romance richtet sich noch im selben Satz ironisch ebenso vernichtend gegen die Titelheldin.[17] Denn diese, nach Emotionen lechzend, nimmt unter anderem diese triviale Musikform mit ihren abgedroschenen, kitschigen und klischeehaften Themen (man beachte den Plural bei « anges » – « madones » – « lagunes » – « gondoliers ») zum Vorbild und erkennt darin die Ideale, an denen sie ihr späteres Leben ausrichten wird: ein Unterfangen, das, für den Erzähler wie für den Leser kaum verwunderlich, zwangsläufig zum Scheitern führen muss.
Somit bildet die Stelle über den Musikunterricht aus dem ersten Teil von Madame Bovary die Folie, vor der das Gespräch Emmas mit Léon über die Musik im zweiten Teil gelesen werden muss. Bei diesem Gespräch finden sich zwei Seelenverwandte – und tatsächlich wird diese Begegnung auch bestimmend für das weitere, verhängnisvoll verlaufende Romangeschehen.[18]
Die Tatsache, dass sowohl Emma als auch Léon in der Lage sind, eine Romance zu singen, sei es im privaten Kontext oder dem des Musikunterrichts, kann als Indiz dafür verstanden werden, dass die Romance auch für Laien ohne Schwierigkeiten nachzusingen ist. Tatsächlich stellte die Romance, wie bereits erwähnt, grundsätzlich keine allzu hohen Anforderung an den oder die ›Interpreten‹. Große Ansprüche an die ausführenden Künstler zu stellen, lag übrigens auch Pauline Duchambge fern. Der Komponistin, die selbst Gesangsunterricht gab,
ging es [nämlich] […] nicht darum, Sänger für die Bühne oder die großen Salons auszubilden, sondern die Kunst zu vermitteln, « à chanter simplement, pour le charme intime et pour le timide écho de la maison » [»schlicht zu singen, um den intimen Charme und das schüchterne Echo des Hauses einzufangen«].[19]
Die Bekanntheit der Romance auch in ländlichen Gegenden ist oft gerade Laiensängern zu verdanken, die die Stücke in der Provinz darboten. Und so ist es wenig erstaunlich, dass Léon in der nahe Rouen gelegenen kleinen – fiktiven – Ortschaft Yonville imstande ist, solch eine Romance nachzusingen, und der Apotheker diese auch sofort wiedererkennt. Dies spricht für den hohen Bekanntheitsgrad von A mon ange gardien im Speziellen und der Romance im Allgemeinen.
5. « La musique allemande » – das deutsche Lied
Im eingangs angeführten Zitat aus Madame Bovary kommt die Musik in der Unterhaltung zwischen Madame Bovary, Léon und Homais, wie bereits erwähnt, in mehreren Aspekten zur Sprache. Auf Emmas Frage hin erklärt Léon, ohne die Gattung zu bezeichnen, « la musique allemande, celle qui porte à rêver » – also »die deutsche Musik, die, die einen zum Träumen bringt« – zu seiner Lieblingsmusik.[20] Dass er die Gattung nicht benennen kann, entbehrt nicht der Ironie, wodurch die im Gespräch befindlichen Figuren bloßgestellt werden. Die zur Schau gestellte Kunst- bzw. Musikbeflissenheit Léons findet nämlich nicht eigentlich die ›richtigen‹ Worte, was ein Indiz dafür ist, dass die Begeisterung des jungen Mannes oberflächlich und letztlich dem Halbwissen verhaftet ist. Selbst der « musicien célèbre » bleibt in Léons Diskurs namenlos. Dessen Geste (Klavierspiel vor imposanter Landschaft) ist als eine Äußerung des ungebändigten romantischen Genies zu verstehen und sollte als solche die Einzigartigkeit und Individualität des berühmten Künstlers unterstreichen. Doch die Tatsache, dass dessen Identität nicht gelüftet wird (von Léon nicht gelüftet werden kann?), entlarvt diese ausholende Geste als ein klischeehaftes Versatzstück der (Selbst-?)Inszenierung eines Künstlers, den Léon vor Augen hat und den er womöglich überschätzt. – Léons Gesprächspartnerin Emma scheint nicht aufzufallen, dass die Äußerungen Léons unzulänglich, lückenhaft und somit fast nichtssagend sind. Sie nimmt daran keinen Anstoß, im Gegenteil signalisiert sie durch ihre Einwürfe, dass Léons Rede ihr Interesse geweckt hat. Allerdings sind ihre Nachfragen unqualifiziert und tragen nicht zur Vertiefung des Gegenstandes bei, vielmehr lösen sie – von Emma unbeabsichtigt – komische Effekte aus. So führt sie beispielsweise gerade durch ihre unvermittelte Frage nach Léons musikalischen Aktivitäten (« Vous faites de la musique ? ») einerseits die spektakuläre Geste des großen Künstlers (Pianist) und andererseits die Intimität, in der der Laie Léon sich – vermeintlich unbelauscht – künstlerisch äußert, auf engsten Raum zusammen, was den ohnehin schon vorhandenen komischen inhaltlichen Kontrast der beiden Szenerien noch weiter verschärft.
Gemeint ist mit jener « musique allemande » das deutsche Lied der Romantik, vor allem Franz Schuberts,[21] das seit 1833 in Frankreich zunehmend bekannt wurde. Allein zwischen 1840 und 1850 wurden über 300 deutsche Lieder in Frankreich veröffentlicht.[22] Mit der Verbreitung des deutschen Liedes ging in Frankreich die Erschütterung der Salonmusik einher, untergrub es doch mit seinen neuen Maßstäben die Grundfesten der Romance.[23] So kam der Dramatiker Ernest Legouvé in seinem 1837 in der Revue et Gazette musicale publizierten Artikel Mélodies de Schubert zu der Feststellung: “[Schubert] has killed the French romance”.[24] Allerdings hielten die Befürworter der Romance in der Zeitschrift La France musicale dagegen “that the mélodie[25] will not kill our romance because the French romance also has its value”.[26]
Wie ist diese dramatische Entwicklung zu erklären und welche Folgen zeitigte sie? Was das deutsche Lied gegenüber der in Frankreich so verbreiteten Romance auszeichnete, ist die Bedeutung, die es der Begleitung beimaß. Diese wurde von den Komponisten der Romance so gering geschätzt, dass es durchaus möglich war, darauf sogar völlig zu verzichten und nur die Solostimme einzusetzen. Während also bei der Romance der Text und damit auch der – deklamierende! – Gesang im Mittelpunkt des Interesses steht, geht der Gesang im deutschen Lied, vor allem bei Schubert, mit dem Klavier eine derart enge Symbiose ein, dass Sänger und Pianist fast zu ein und demselben Interpreten verschmelzen, um sinngemäß Schubert über seine Aufführungen mit Vogl zu zitieren,[27] ja die Aufwertung des Klavierparts kann sogar zur Priorität des Instruments gegenüber der Stimme führen.
Dem deutschen Lied wurde in ganz Frankreich – auch in der Provinz[28] – große Bewunderung entgegengebracht, doch übernahmen die Franzosen, so Marie-Claire Beltrando-Patier, diese seine Eigenheiten nicht. Tatsächlich sei nämlich die französische Vokalmusik seit jeher sehr auf das Wort bezogen gewesen, so dass jegliche musikalische Vorgehensweise wie beim deutschen Lied suspekt erscheinen musste. Das Lied, so Marie-Claire Beltrando-Patier weiter, sei in Frankreich also niemals nachgeahmt oder kopiert worden, vielmehr habe es den Wunsch nach etwas anderem ausgelöst, den dann die Mélodie erfüllen sollte.[29]
6. Die Anfänge der Mélodie
6.1. Hector Berlioz
Hector Berlioz war der erste, der eigene Kompositionen mit dem Gattungsbegriff mélodie bezeichnete.[30] Doch sehen moderne französische Musikhistoriker die Verwendung dieses Begriffes hinsichtlich der Kompositionen von Berlioz nicht immer eindeutig gerechtfertigt. So schreibt etwa Marie-Claire Beltrando-Patier:
[Les] caractères propres à la romance constituent […] le fondement du goût français en matière de musique vocale. Les grands mélodistes le savent et restent observateurs d’une intelligibilité parfaite. Pour cette raison, les débuts de la mélodie auront quelque chose de la romance, et il est difficile de dire […] que brusquement, Berlioz a abandonné la romance populaire pour […] la mélodie.[31]
[Die] Merkmale der Romance bilden […] die Grundlagen des französischen Geschmackes hinsichtlich der Vokalmusik. Die großen Komponisten der Mélodie wissen dies und achten auf eine perfekte Verständlichkeit. Aus diesem Grund haben die Anfänge der Mélodie etwas von der Romance an sich, und es lässt sich nicht einfach sagen, dass Berlioz plötzlich die populäre Romance […] zugunsten der Mélodie aufgegeben hat.
Auch Les Nuits d’été (1841) von Berlioz seien nicht eindeutig oder ausschließlich der Gattung der mélodie zuzuordnen, vielmehr bewege sich der Komponist hier zwischen einer legitimen Suche nach Neuem und der Natürlichkeit, die man von einer Romance erwarten könne.[32]
6.2. Louis Niedermeyer – Le Lac
Camille Saint-Saëns sieht in der Einleitung zu Vie d’un compositeur moderne (Paris 1893) Louis Niedermeyer als den ersten Komponisten von Mélodies:
[le premier, Niedermeyer a] brisé le moule de l’antique et fade romance française en s’inspirant de beaux poèmes de Lamartine et de Victor Hugo, et créé un genre nouveau d’un art supérieur, analogue au Lied allemand; le succès retentissant du Lac a frayé le chemin à M. Gounod et à tous ceux qui l’ont suivi dans cette voie.[33]
[Niedermeyer hat als erster] die Form der althergebrachten und faden französischen Romance zerbrochen, indem er sich an schönen Gedichten von Lamartine und Victor Hugo inspirierte, und hat so eine neue Gattung von höherer Kunst geschaffen, die dem deutschen Lied entspricht; der durchschlagende Erfolg von Le Lac hat Herrn Gounod den Weg geebnet, sowie auch all denen, die ihm auf diesem Pfad gefolgt sind.
Tatsächlich wird die Komposition Le Lac von Niedermeyer aus dem Jahr 1821 oder 1825[34] nach einem Text von Lamartine oftmals als der Beginn der mélodie in Frankreich bezeichnet. Doch stellt sich die Frage, ob tatsächlich die Vertonung einer qualitativ besseren Textvorlage (Lamartines Méditations von 1820, aus denen Le Lac stammt, gelten als der Prototyp der frühromantischen Dichtung in Frankreich, Victor Hugo, von dem im Zitat ebenfalls die Rede ist, als einer der größten romantischen Dichter Frankreichs) schon ausreicht, um von einer neuen Gattung der Vokalmusik sprechen zu können, wie es das Zitat von Saint-Saëns suggeriert. Und so spricht der Musikhistoriker Frits Noske Niedermeyer auch die Ehre ab, der Begründer der Mélodie zu sein:
Niedermeyer cannot accurately be called the creator of the mélodie. Basically his songs are still romances, even though distinguished form their dull contemporaries by the superior quality of the text, by structural changes, by a closer relationship between words and music, and by the relative importance of the accompaniment.[35]
Genau genommen kann Niedermeyer nicht als der Schöpfer der mélodie bezeichnet werden. Im Grunde sind seine Lieder noch Romances, auch wenn sie sich von den faden zeitgenössischen Kompositionen durch die höhere Textqualität, Veränderungen der Struktur, eine engere Beziehung zwischen Wort und Musik und durch die relative Bedeutung der Begleitung absetzen.[36]
6.3. Romance vs. mélodie (vs. Lied)
Wo sind also die Grenzen zu ziehen zwischen Romance, Mélodie (und Lied), wie ist deren Verhältnis zueinander? Hierzu ein Zitat von Marie-Claire Beltrando-Patier:
En fait, si romance et mélodie – et même lied, pourrait-on ajouter – répondent à la même définition de poème chanté pour voix soliste, il s’agit de catégories d’art différentes, sans hiérarchie dans les valeurs. La romance se présente comme un produit de grande consommation, répondant au goût bourgeois du début du XIXe siècle. […] [Elle] sera cultivée avec bonheur jusque vers 1870. On peut compter parmi ses chefs-d’œuvre quelques-unes des mélodies du 1er Recueil de Fauré, œuvres déjà très raffinées, voire « fauréennes », comme Mai (1862).
Vers 1870 se developpe la mélodie […]. A la base de ce changement se situe le renouveau poétique créé par les Parnassiens, […] hostile aux épanchements romantiques […].[37]
Obschon sich Romance und Mélodie – und selbst das Lied ließe sich hier einreihen – gleichermaßen als gesungenes Gedicht für Solostimme definieren lassen, handelt es sich dabei in Wirklichkeit doch um unterschiedliche Kunstkategorien (Gattungen), ohne dass diese Unterscheidung mit einer Wertehierarchie einherginge. Die Romance präsentiert sich als ein Produkt für den Massenkonsum, sie entspricht dem bürgerlichen Geschmack zu Beginn des 19. Jahrhunderts. […] [Sie] wird bis um 1870 gepflegt werden und sich großer Beliebtheit erfreuen. Zu ihren Meisterwerken können einige der Mélodies aus der Ersten Sammlung (1er Recueil) von Fauré gezählt werden, dabei sind diese Werke bereits sehr kunstvoll gestaltet, ja sogar Fauré-typisch, wie etwa Mai (1862).
Um 1870 entwickelt sich dann die Mélodie […]. Am Beginn dieser Veränderung steht die Erneuerung der Dichtung durch die Parnassiens, […] die den romantischen Gefühlsergüssen ablehnend gegenüber standen […].
Wo auch immer also die Kritik die Anfänge der mélodie verortet – ob schon bei Niedermeyer um 1820, bei Berlioz zwischen 1830 und 1841, oder erst um 1870, etwa vor dem Hintergrund des neuen Schaffensstils Faurés, wird doch ein Kriterium konstant als ausschlaggebend herangezogen: die Wechselwirkung der Entwicklung auf dem Gebiet der Musik mit der Literatur. Sei es, dass die Wahl des Komponisten auf ›bessere‹ Dichter fällt (beispielsweise bei Niedermeyer: Lamartine, bei Fauré die Abwendung von Hugo und Hinwendung zu Baudelaire), oder ein Neuanfang in der Literatur – nämlich die literarische Strömung der Parnassiens, die in ihrer Dichtung und ihren Theorien um die Jahrhundertmitte die romantische Poesie endgültig hinter sich lassen wollten[38] – letztlich die Komponisten zu musikalischem Experimentieren veranlasste und zur Herausbildung der mélodie führte: Die Entwicklung der Solo-Vokalmusik ist im Frankreich des 19. Jahrhunderts nicht ohne den Einfluss der Literatur zu denken. Der enge Bezug zwischen Entwicklungen in der Literatur und der Vokalmusik ist ein prägendes Phänomen, das sich in Frankreich auch im 20. Jahrhundert intensiv fortsetzen wird. Stellvertretend für viele sei hier Poulenc angeführt, der, neben anderen (auch älteren) Dichtern, vor allem Texte von Apollinaire und Eluard vertonte. Wie eng sich dieser Komponist des 20. Jahrhunderts den beiden mit ihm befreundeten Poeten in seinem Schaffen verbunden und verpflichtet weiß, geht aus seinem 1945 geäußerten Wunsch für die Aufschrift seines Grabsteins hervor:
Si l’on mettait sur ma tombe: « Ci-gît Francis Poulenc, le musicien d’Apollinaire et d’Eluard », il me semble que ce serait mon plus beau titre de gloire.[39]
Wenn auf meinem Grabstein stünde: »Hier ruht Francis Poulenc, der Musiker von Apollinaire und Eluard«, dann wäre dies, so scheint mir, mein schönster Ruhmestitel.
Exkurs:
Emma Bovary in der Oper
Die ausführlichste Thematisierung eines Musikerlebnisses in Madame Bovary stellt die Schilderung eines Opernabends dar, die das gesamte fünfzehnte Kapitel des zweiten Teils des Romans umfasst. Auf dem Programm steht die französische Adaption von Donizettis Lucia di Lammermoor, die Emma in Begleitung ihres Mannes im Theater von Rouen besucht. Wie auch an den anderen Stellen, in denen die Musik eine Rolle spielt, geht es Flaubert hier nicht etwa um eine Auseinandersetzung mit der Kunst eines Donizetti, vielmehr ist die Beschreibung des Opernabends funktional auf die Beobachtung des Verhaltens des Publikums und dabei insbesondere der Reaktionen der Titelheldin und ihres Gatten sowie auf die Ironisierung von Künstler und Kunstbetrieb ausgerichtet.
Die Opernaufführung wird ausschließlich entweder aus der Sicht eines x-beliebigen durchschnittlichen Theaterbesuchers oder aus dem Blickwinkel Emmas und ihres Mannes Charles beschrieben; dem der Oper Donizettis nicht kundigen Leser von Madame Bovary erschließt sich das Werk Donizettis aus der Romanlektüre kaum bis gar nicht. Sehr zum Ärgernis seiner Frau versteht Charles, der fast als eine Karikatur des bürgerlichen Opernpublikums angesehen werden kann, gar nichts von der Opernhandlung (die – nicht nur für ihn – sehr viel mehr im Zentrum des Interesses steht als die Musik), trotzdem findet er zunehmend Gefallen an der Aufführung und will im dritten Akt auf die Frage Léons hin die Vorstellung nicht vorzeitig verlassen:
Ah! pas encore! restons! dit Bovary. Elle a les cheveux dénoués: cela promet d’être tragique.[40]
Ach! noch nicht! Bleiben wir doch noch! sagte Bovary. Ihre Haare haben sich gelöst: sieht so aus, als könnte das noch tragisch werden.
Emma dagegen fühlt sich mit Beginn der Aufführung in die Welt ihrer Jugendlektüren versetzt:
Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott.[41]
Sie fühlte sich in ihre Jugendlektüren zurückversetzt, mitten in Walter Scott.
Da sie Walter Scotts Roman, der als Textvorlage für das Libretto diente, als junges Mädchen gelesen hatte, kann sie der Handlung im Gegensatz zu ihrem Mann mühelos folgen. Ab dem Auftritt des Tenors Lagardy in der Rolle des Edgar parallelisiert sie das Bühnengeschehen mit ihren eigenen Erfahrungen in der Liebe:
Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir.[42]
Sie erkannte ein jedes Gefühl der Trunkenheit und der Angst wieder, an denen sie fast gestorben wäre.
Letztendlich stellt sie die große Diskrepanz zwischen der übergroßen – idealen – Liebe der Opernfiguren und ihrem eigenen enttäuschenden Liebesleben fest:
Mais personne sur la terre ne l’avait aimée d’un pareil amour.[43]
Doch niemand auf der Welt hatte ihr je solch eine Liebe entgegengebracht.
Ohne den Sänger von seiner Rolle zu unterscheiden, phantasiert sie sich in der Folge in eine Liebesbeziehung mit dem Tenor, wobei sich dieses Traumbild für Emma auch schon in Wirklichkeit umzusetzen scheint:
[…] entraînée vers l’homme par l’illusion du personnage, elle tâcha de se figurer sa vie, cette vie retentissante, extraordinaire, splendide, et qu’elle aurait pu mener cependant, si le hasard l’avait voulu. Ils se seraient connus, ils se seraient aimés! Avec lui, par tous les royaumes de l’Europe, elle aurait voyagé de capitale en capitale […]; puis, chaque soir, au fond d’une loge, […] elle eût recueilli, béante, les expansions de cette âme qui n’aurait chanté que pour elle seule; de la scène, tout en jouant, il l’aurait regardée. Mais une folie la saisit: il la regardait, c’est sûr![44]
[…] durch die Illusion der Rolle fühlte sie sich zu diesem Manne hingezogen und versuchte, sich sein Leben vorzustellen, dieses aufsehenerregende, außergewöhnliche, glanzvolle Leben, das auch sie hätte führen können, wenn der Zufall es so gewollt hätte. Sie hätten sich kennengelernt, sie hätten sich geliebt! Mit ihm zusammen wäre sie durch alle Königreiche Europas von Hauptstadt zu Hauptstadt gereist […]; schließlich hätte sie jeden Abend ganz hinten in einer Loge […] mit weit aufgerissenem Mund die Ergüsse dieser Seele, die nur für sie ganz allein gesungen hätte, in sich aufgenommen; von der Bühne aus hätte er sie während des Spiels angeblickt. Doch ein Wahn ergriff sie: er blickte sie an, ja, ganz sicher!
Der von Emma bewunderte und angehimmelte Tenor scheint allerdings offensichtlich nicht nur von ihr überschätzt zu werden und in Wirklichkeit alles andere als ein überragender Künstler zu sein, der noch dazu einen Gutteil seiner künstlerischen Anerkennung beim Publikum seinen Liebesabenteuern verdankt. Dieser Umstand trägt zusätzliche zur Steigerung der Ironisierung der Figur der Emma bei und verleiht ihren Träumen schon fast tragische Züge. Nicht zuletzt wird dabei auch ein kritisch-ironisches Licht auf den Künstler und den Kunstbetrieb der Zeit geworfen:
[…] cette célébrité sentimentale ne laissait pas que de servir à sa réputation artistique. […] Un bel organe, un imperturbable aplomb, plus de tempérament que d’intelligence et plus d’emphase que de lyrisme, achevaient de rehausser cette admirable nature de charlatan, où il y avait du coiffeur et du toréador.[45]
[…] die Berühmtheit, zu der er aufgrund seiner Liebesabenteuer gelangt war, trug beständig zu seinem künstlerischen Ansehen bei. […] Ein schönes Organ, eine unerschütterliche Selbstsicherheit, mehr Temperament als Intelligenz und mehr Emphase als lyrischer Ausdruck rundeten diese bewundernswerte Natur von einem Scharlatan vollends ab, der auch etwas von einem Friseur und von einem Stierkämpfer an sich hatte.
So wie der allseits bewunderte Sänger hier entzaubert wird, klaffen auch Emmas Lebenswirklichkeit und ihre hochfliegenden Träumen auseinander. Anstatt mit dem Star von Hauptstadt und Hauptstadt zu eilen, sitzt sie in Gesellschaft der örtlichen Bourgeoisie im Theater der Provinzhauptstadt Rouen, anstatt mit dem großen Künstler ihrem öden Eheleben zu entfliehen, begegnet sie im Theater zufällig Léon wieder, der nunmehr in Rouen lebt und mit dem sie in der Folge eine Liebesbeziehung eingehen wird. Durch das Zusammentreffen mit Léon in der Pause zwischen dem zweiten und dritten Akt verliert sie auch vollständig das Interesse am Bühnengeschehen:
[…] elle n’écouta plus […] tout passa pour elle dans l’éloignement […][46]
[…] sie hörte nicht mehr hin […] alles war für sie mit einem Mal entrückt […]
Ihre Phantasien über ein Leben mit dem Tenor werden völlig verdrängt von der Erinnerung an ihre erste Liebe zu Léon, « tout ce pauvre amour si calme et si long, si discret, si tendre »[47] (»diese ganze arme Liebe, die so ruhig und so lang, so diskret, so zärtlich gewesen war«), so dass sie schließlich, dem Vorschlag Léons folgend, in dessen und ihres Mannes Begleitung die Aufführung, die sie gerade noch so hochfliegend hatte träumen lassen, vorzeitig – noch vor dem dramatischen und musikalischen Höhepunkt der Oper, der Wahnsinnsarie Lucias! – verlässt.
Nachweise und Anmerkungen
[1] Gustave Flaubert, Madame Bovary. Mœurs de Province, hrsg. von Claudine Gothot-Mersch, Paris: Garnier 1971, S. 84f.
[2] Graham Johnson und Richard Stokes, A French Song Companion, New York: Oxford University Press 2000, S. 134.
[3] Unabhängig davon, ob die Untersuchungen zur Romance das gesamte 18. Jahrhundert wesentlich einbeziehen, herrscht insgesamt in der Kritik Einhelligkeit darüber, dass Martinis Plaisir d’Amour (1783) einen Meilenstein in der Geschichte der Romance darstellt. Diese Komposition ist in den Worten Gstreins der Auftakt für das Genre der »sentimentalen Salonromanze, die in den folgenden Jahrzehnten das Bild des frz. Salonliedes prägen sollte.« (Rainer Gstrein, Die vokale « romance française » im 18. Jahrhundert, in: Zur Entwicklung, Verbreitung und Ausführung vokaler Kammermusik im 18. Jahrhundert: XXII. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 10. bis 12. Juni 1994, hrsg. von Bert Sigmund, Michaelstein: Stiftung Kloster Michaelstein 1997 (Michaelsteiner Konferenzberichte 51), S. 128). Erst ab 1833 geriet diese in Krise, als das deutsche Lied in Frankreich zunehmend bekannt wurde (Marie-Claire Beltrando-Patier, Romance, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 562; vgl. hierzu auch Abschnitt 5. dieser Untersuchung). Zur zeitlichen Eingrenzung der Romance siehe auch die Standardwerke Frits Noske, French Song from Berlioz to Duparc, übers. von Rita Benton, New York: Dover Publications 1970, Neuauflage 2012; Henri Gougelot, La Romance française sous la Révolution et l’Empire, Melun: Legrand et Fils 1937; Roger Hickman, Romance, in: Grove Music Online (www.oxfordmusiconline.com).
[4] Vgl. Herbert Schneider, Duchambge, in: MGG2P, Bd. 5, Sp. 1495. Der Text dieser Romance wird von der weiterführenden Literatur irrtümlicherweise immer wieder der mit Pauline Duchambge eng befreundeten und von ihr häufig vertonten Dichterin Marceline Desbordes-Valmore zugeschrieben(vgl. beispielsweise Christian Goubault, La musique et les lettres au XIXe siècle, in: Histoire de la France littéraire, Bd. 3, hrsg. von Patrick Berthier und Michel Jarrety, Paris: PUF 2006, 32009, S. 561). Diese hat auch tatsächlich ein Gedicht mit dem Titel L’ange gardien (!) verfasst, allerdings wurde dieses Gedicht nicht vertont. Bei der Vertonung des aus unbekannter Feder stammenden Textes wirkte aber eine Dichterin an der Seite Pauline Duchambges mit, nämlich Amable Tastu (vgl.Johnson/Stokes,S. 134f.). Hinter dem Pseudonym verbirgt sich Sabine Casimire Amable Voïart (1798–1885).
[5] Nach dem Digitalisat auf http://archive.org/details/monangegardien830duch.
[6] Claudia Schweitzer, Pauline Duchambge (http://mugi.hfmt-hamburg.de/A_lexartikel/lexartikel.php?id=duch1776).
[7] Zu weiteren typischen Sujets in der Romance siehe Gougelot, S. 24–88. Er unterscheidet folgende Romance-Typen nach inhaltlichen Aspekten: Romances historiques – pastorales – sentimentales (historische – pastorale – sentimentale Romances). Ferner differenziert er die Romances nach ihrer Darbietung in Romances narratives – dramatiques – lyriques (narrative – dramatische – lyrische Romances).
[8] Zu den Gattungsmerkmalen siehe z. B. Beltrando-Patier, Romance, S. 559.
[9] Vgl. Hickman.
[10] Beltrando-Patier, Romance, S. 559.
[11] Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d’Alembert: Romance, in: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (online über http://fr.wikisource.org).
[12] Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique (online über http://www.imslp.org).
[13] Gstrein, S. 128,vgl. auch Anm. 3.
[14] Text: Jean-Pierre Claris de Florian.
[15] Beispielsweise in Le devin du village (Intermède, 1752); hier wird der Begriff Romance (die Romance des Colin, achte Szene, Textanfang: « Dans ma cabane obscure ») erstmals als Liedtitel verwendet (vgl. Gstrein, S. 126). Rousseaus Komposition wurde richtungweisend für die Romance als charakteristischem Bestandteil der Opéra Comique.
[16] Flaubert, S. 39.
[17] Zu Ironiestrategien in der Literatur allgemein und bei Flaubert im Besonderen siehe die Forschungsarbeiten von Rainer Warning: Ironiesignale und ironische Solidarisierung, in: Das Komische, hrsg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning (Poetik und Hermeneutik, Bd. 7), München: Fink 1976, S. 416–423; Ders., Die Phantasie der Realisten, München, Fink 1999, S. 150–184.
[18] In diesem Kontext empfiehlt sich ein kurzer Exkurs zum Begriff Bovarysme, der auch hinsichtlich der Grobstruktur der Romanhandlung aufschlussreich ist. Beim Bovarysme handelt es sich um das nach Flauberts Titelheldin Madame Bovary benannte Motiv des Scheiterns im und Zerbrechens am realen Leben, zu dem es kommt, weil – wie prototypisch in Flauberts Roman dargestellt – Emma an das reale Leben die Maßstäbe anlegt, die sie durch eine überaktive träumerische Einbildungskraft anhand von (romantischen) Lektüre- und anderen ›Kunst‹-Erlebnissen ausgebildet hat. So sind ihre Anforderungen an das reale Leben, das sie mit ihrem unbedeutenden und langweiligen Mann in der Provinz führt, einfach zu hoch; aus Enttäuschung über ihr unausgefülltes Dasein unternimmt sie mehrere Ausbruchsversuche (unter anderem die Liebesaffaire mit Léon). Schließlich endet sie im Selbstmord. Der Begriff geht auf den französischen Philosophen Jules de Gaultier (1858–1942) zurück und findet zur Beschreibung des Handlungsmusters auch bei anderen literarischen Werken Verwendung.
[19] Le Ménestrel, 6. Juni 1858, S. 3, zitiert in Schneider, Sp. 1493.
[20] Kurz darauf kommen Emma und Léon noch auf ein weiteres musikalisches Interessensgebiet zu sprechen: mit der von Emma lapidar als « les Italiens » – »die Italiener« – bezeichneten Musik ist die Gattung der italienischen Oper gemeint. Im Gegensatz zu Romance und Mélodie kann man diese in der Abgeschiedenheit der Provinz (Yonville) unmöglich rezipieren, daher stellt sich hier auch zunächst eher die Frage des Kennens (« Connaissez-vous […] » – »Kennen Sie […]«) als die nach musikalischen Vorlieben. Nicht zuletzt zielt somit Emmas Frage indirekt auch auf die Mobilität und eventuelle soziale Kontakte Léons zur Großstadt ab, nach der sie selbst sich vom Land fortsehnt. – Die italienische Oper feierte im Paris der Zeit, in der Madame Bovary spielt, große Erfolge, einige Opern aus der Feder renommierter italienischer Komponisten (Rossini, Bellini, Donizetti) wurden dort sogar uraufgeführt. Die Opernstoffe entsprachen dem Geschmack Emmas, stammten sie doch beispielsweise von Walter Scott, dessen Werke sie neben anderen in ihrer Jugend verschlungen hatte. Zum Zeitpunkt dieses Gespräches mit Léon war sie selbst allerdings noch nicht in den Genuss eines Opernbesuches in Paris gekommen. Erst sehr viel später im Fortgang des Romans wird sie einer Aufführung der französischen Adaption von Donizettis Lucia di Lammermoor beiwohnen, allerdings nicht in Paris, sondern in der Provinzstadt Rouen (siehe den Exkurs am Ende des Textes).
[21] Auf der romaninternen, inhaltlichen Ebene trifft Léon mit der Präzisierung, »die einen zum Träumen bringt«, ganz den Geschmack der sich nach großen Gefühlen sehnenden Emma Bovary, und gibt sich nicht zuletzt mit diesem Ausdruck als ihr Seelenverwandter zu erkennen. – Darüber hinaus geht jenseits der Immanenz des Romans aus einem Eintrag Flauberts in sein Dictionnaire des Idées reçues hervor, dass er die Deutschen allgemein für »ein Volk von (alten) Träumern hält« (« Allemands : peuple de Rêveurs (vieux) », zitiert in Flaubert, Madame Bovary, S. 456, Anm. 46). Dieses Attribut zielt auf die Romantik deutscher Prägung, als eine deren künstlerischer Ausdrucksformen Schuberts Musik, vor allem sein Liedschaffen, gilt. – Flauberts Roman Madame Bovary ist als Abrechnung mit der Romantik zu lesen, dennoch hat der Autor in seiner Korrespondenz mit befreundeten Schriftstellern immer wieder (und dies durchaus auch selbstironisch) betont, dass er selbst sich der Romantik verpflichtet weiß. Flauberts Verhältnis zur Romantik bleibt also letztlich widersprüchlich.
[22] Vgl. Noske, S. 25ff., und Beltrando-Patier, Romance, S. 562f. Besondere Erwähnung verdient hier der Tenor Adolphe Nourrit, der mit seinen Liederabenden und Übersetzungen der Liedtexte Schuberts wesentlich dazu beitrug, Schubert in ganz Frankreich bekannt zu machen. – Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Entstehungszeit von Madame Bovary. Flaubert hat fünf Jahre, von 1851 bis 1856, intensiv an diesem Stoff gearbeitet, bevor er den Roman ein erstes Mal 1856 in der Zeitschrift Revue de Paris veröffentlichte. Der Text bedeutete einen Skandal, es kam zum Prozess. Aus diesem ging Flaubert als Sieger hervor, und so konnte der Roman 1857 unzensiert in vollem Umfang als Buch erscheinen.
[23] Noske, S. 34.
[24] Zitiert – in englischer Übersetzung – in Noske, S. 34. Vgl. auch Noske, S. 415, Anm. 91 und 85. Ernest Legouvé war mit Berlioz befreundet und arbeitete auch mit diesem zusammen (vgl. Gérard Condé, Hector Berlioz, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 45); so basiert beispielsweise die Komposition La Mort d’Ophélie auf einem Text von Legouvé nach William Shakespeare.
[25] Mit mélodie ist hier das Lied Schuberts gemeint, nicht die Gattung der französischen mélodie. Das Lied Schuberts und seiner Nachfolger bezeichnet man im Französischen heute mit dem deutschen Begriff le lied.
[26] Zitiert – in englischer Übersetzung – in Noske, S. 34.
[27] Zitiert in Beltrando-Patier, Romance, S. 562.
[28] Nourrit gab seine Konzerte auch in der Provinz und macht so das deutsche Lied über die Hauptstadt hinaus bekannt. Vgl. Noske, S. 27ff.
[29] « Le Français apprécie sans la faire sienne cette dernière proposition [de donner la priorité à l’instrument sur la voix]. Il y a en effet dans la musique vocale française une constante référence au verbal qui rend suspecte toute opération musicale de type lied. Le lied ne sera donc jamais imité ou copié, mais déclenchera un désir d’autre chose, que la mélodie viendra combler » (Beltrando-Patier, Romance, S. 563). – »Ohne es sich selbst anzueignen, schätzt der Franzose letzteres [einem Instrument gegenüber der Stimme den Vorzug zu geben]. Es gibt nämlich in der französischen Vokalmusik einen ständigen Bezug zum wortsprachlichen Ausdruck, was jegliche musikalische Operation wie beim Lied verdächtig erscheinen lässt. Das Lied wird also niemals imitiert oder nachgeahmt werden, vielmehr sollte es das Verlangen nach etwas anderem auslösen, das dann die Mélodie einlösen wird.«
[30] Neuf mélodies / imitées de l’anglais (Irish Melodies) / pour une ou deux voix, et chœur / avec acompagnement de piano lautete 1830 der ursprüngliche Titel, den Berlioz später (1849) zu Irlande mit dem Untertitel Neuf mélodies verkürzte (vgl. Condé, S. 47,und Pierre Bernac, The interpretation of French song, übers. von Winifred Radford, London: Kahn & Averill 1997, Nachdruck 2005, S. xiii).
[31] Beltrando-Patier, Romance, S. 560.
[32] Vgl. Condé, S. 45. Noske reiht Berlioz unter die mélodistes ein, allerdings unterteilt er kurioserweise das Mélodie-Œuvre Berlioz in folgende Kategorien: “1. The youthful romances and the Mélodies irlandaises […]. 2. The […] pieces written between 1830 and 1838, and the collection Les nuits d’été, composed about 1840. The evolution from romance to mélodie occurred during this time. 3. The last songs” (Noske, S. 93).
[33] Camille Saint-Saëns, Vie d’un compositeur moderne, Paris 1893, zitiert in Marie-Claire Beltrando-Patier, Louis Niedermeyer, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 476. Diese Stelle wird – gekürzt – auch in Goubault, S. 561, und – in voller Länge auf Englisch – in Noske, S. 12 angeführt.
[34] Die Angaben hinsichtlich des Entstehungsjahrs der Komposition sind widersprüchlich: So wird die Komposition in David Tunley, Romantic French Song 1830–1870, Bd. 1, hrsg. von David Tunley, New York, London: Garland 1994, S. xxviiauf das Jahr 1821datiert; bei Beltrando-Patierdagegen auf 1825 (Beltrando-Patier, Louis Niedermeyer, S. 476).
[35] Noske, S. 12.
[36] Übersetzung aus dem Englischen: Elisabeth Sasso-Fruth.
[37] Marie-Claire Beltrando-Patier, Gabriel Fauré, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 212f.
[38] Der romantischen Gefühlbetontheit (« émotions ») stellten die Parnassiens ihr Ideal der « impassibilité » (Ungerührtheit) gegenüber.
[39] Claire Delamarche, Francis Poulenc, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 488.
[40] Flaubert, S. 233.
[41] Ebd., S. 228.
[42] Ebd., S. 229.
[43] Ebd.
[44] Ebd., S. 231f.
[45] Ebd., S. 229.
[46] Ebd., S. 233.
[47] Ebd.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Beltrando-Patier, Marie-Claire: Romance, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 558–565.
Dies.: Louis Niedermeyer, in: ebd., S. 476–477.
Dies.: Gabriel Fauré, in: ebd., S. 211–230.
Bernac, Pierre: The interpretation of French song, übers. von Winifred Radford, London: Kahn & Averill 1997, Nachdruck 2005.
Condé, Gérard: Hector Berlioz, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 44–53.
Delamarche, Claire: Francis Poulenc, in: ebd., S. 488–503.
Diderot, Denis, und Jean Baptiste le Rond d’Alembert: Romance, in: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Bd. 14, Paris 1751: http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/Volume_14# ROMANCE.
Duchambge, Pauline: A mon ange gardien: http://archive.org/details/monangegardien830duch.
Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Mœurs de Province, hrsg. von Claudine Gothot-Mersch, Paris: Garnier 1971.
Goubault, Christian: La musique et les lettres au XIXe siècle, in: Histoire de la France littéraire, Bd. III, hrsg. von Patrick Berthier und Michel Jarrety, Paris: PUF 2006, 32009, S. 555–569.
Gougelot, Henri: La Romance française sous la Révolution et l’Empire, Melun: Legrand et Fils 1937.
Gstrein, Rainer: Die vokale « romance française » im 18. Jahrhundert, in: Zur Entwicklung, Verbreitung und Ausführung vokaler Kammermusik im 18. Jahrhundert: XXII. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 10. bis 12. Juni 1994, hrsg. von Bert Sigmund, Michaelstein: Stiftung Kloster Michaelstein 1997 (Michaelsteiner Konferenzberichte 51), S. 125–129.
Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994.
Hickman, Roger: Romance, in: Grove Music Online: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/23725?q=Romance&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit.
Johnson, Graham, und Richard Stokes: A French Song Companion, New York: Oxford University Press 2000, S. 134f.
Noske, Frits: French Song from Berlioz to Duparc, übers. von Rita Benton, New York: Dover Publications 1970, Neuauflage 2012.
Perrin, Jean-François: Cordes sensibles: la mélodie du penseur, in: Le Magazine Littéraire (Nr. 514), Dezember 2011, S. 64f.
Rousseau, Jean-Jacques: Dictionnaire de musique, Paris: Duchesne 1768: http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP72006-PMLP144356-Dictionnaire_de_musique__1768_.pdf.
Schneider, Herbert: Duchambge, in: MGG2P, Bd. 5, Sp. 1492–1495.
Schweitzer, Claudia: Pauline Duchambge: http://mugi.hfmt-hamburg.de/A_lexartikel/lexartikel.php?id=duch1776.
Starobinski, Jean: Rousseau – Eine Welt von Widerständen, übers. von Ulrich Raulff, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 133–137.
Tunley, David: Romantic French Song 1830–1870, Bd. 1, hrsg. von David Tunley, New York, London: Garland 1994.
Warning, Rainer: Ironiesignale und ironische Solidarisierung, in: Das Komische, hrsg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning, München: Fink 1976 (Poetik und Hermeneutik 7), S. 416–423.
Ders.: Die Phantasie der Realisten, München, Fink 1999.