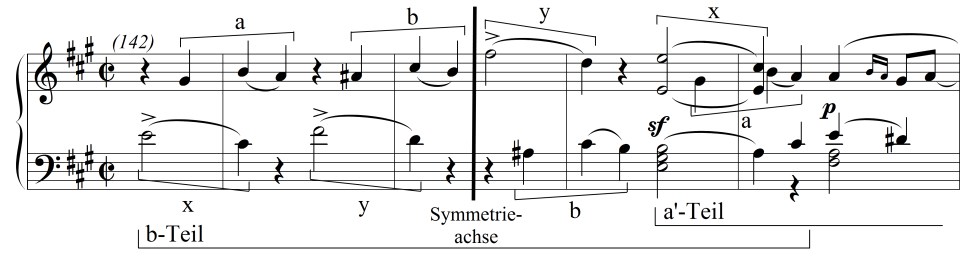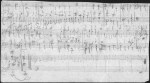Startseite » 19. Jh.
Archiv der Kategorie: 19. Jh.
Joachim Raff in der Neuen Zeitschrift für Musik
Hier eine aus einem älteren Projekt »übriggebliebene« Liste von Raffiana in der NZfM zwischen 1852 und 1879, zusammengestellt von Clarissa Renner:
- 37 (1852), Nr. 12: Anzeige der Drei Lieder von J. G. Fleischer und der Zwei italienischen Lieder op. 50 – 37-12
- 38 (1853), Nr. 07: Joachim Raff, An die Redaction der Neuen Zeitschrift für Musik – 38-07
- 38 (1853), Nr. 11: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil I – 38-11
- 38 (1853), Nr. 13: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil II – 38-13
- 38 (1853), Nr. 14: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil III – 38-14
- 38 (1853), Nr. 15: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil IV – 38-15
- 38 (1853), Nr. 16: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil V – 38-16
- 38 (1853), Nr. 17: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil VI – 38-17
- 38 (1853), Nr. 18: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil VII – 38-18
- 38 (1853), Nr. 20: Rezension der Drei Lieder op. 52 – 38-20
- 38 (1853), Nr. 23: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil VIII – 38-23
- 39 (1853), Nr. 22: Joachim Raff, An die Redaction der Neuen Zeitschrift für Musik – 39-22
- 40 (1854), Nr. 05: Rezension der Frühlingsboten op. 55 – 40-05
- 41 (1854), Nr. 09: Rezension der Drei Salonstücke op. 56 – 41-09
- 41 (1854), Nr. 10: Rezension von Aus der Schweiz op. 57 – 41-10
- 42 (1855), Nr. 01: Rezension der Deux Nocturnes op. 58 – 42-01
- 42 (1855), Nr. 04: Emanuel Klitzsch, Joachim Raff’s Compositionen für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte – 42-04
- 44 (1856), Nr. 16: Rezension der Schweizerweisen op. 60 – 44-16
- 44 (1856), Nr. 19: Rezension der Wagner-Transkriptionen op. 62 – 44-19
- 47 (1857), Nr. 14: Rezension des Capriccio op. 64 – 47-14
- 49 (1858), Nr. 05: Rezension der Suiten op. 71 und op. 72 – 49-05
- 53 (1860), Nr. 26: Rezension des Streichquartetts op. 77 – 53-26
- 55 (1861), Nr. 01: Rezension der Violinsonate op. 78 – 55-01
- 56 (1862), Nr. 07: Rezension der Chachoucha-Caprice op. 79 – 56-07
- 59 (1863), Nr. 08: Rezension des Streichquartetts op. 90 – 59-08
- 60 (1864), Nr. 18: Rezension von Deutschlands Auferstehung op. 100 – 60-18
- 60 (1864), Nr. 50: Rezension von Le Galop, Caprice brillant – 60-50
- 61 (1865), Nr. 10: Rezension der Jubelouvertüre op. 103 – 61-10
- 61 (1865), Nr. 28: Rezension der Zwölf zweistimmigen Gesänge op. 114 – 61-28
- 61 (1865), Nr. 37: Rezension der Ungarischen Rhapsodie op. 113, der Valse Caprice op. 116 und der Deux morceaux lyriques op. 115 – 61-37
- 61 (1865), Nr. 43: Rezension der Phantasie-Polonaise op. 6 – 61-43
- 62 (1866), Nr. 04: Rezension von An das Vaterland op. 96 – 62-04
- 62 (1866), Nr. 27: Rezension der Fest-Ouverture op. 124 – 62-27
- 62 (1866), Nr. 46: Rezension der Drei Clavierstücke o. Op. – 62-46
- 62 (1866), Nr. 47: Louis Köhler, Clavierhistorische Betrachtungen: Joachim Raff – 62-47
- 63 (1867), Nr. 49: Rezension von Blätter und Blüthen op. 135 – 63-49
- 64 (1868), Nr. 05: Rezension der Zehn Gesänge für Männerchor op. 122 – 64-05
- 67 (1871), Nr. 02: Rezension der Suite op. 72 – 67-02
- 68 (1872), Nr. 34: Rezension des Klaviertrios op. 115 – 68-34
- 68 (1872), Nr. 49: Rezension des Klaviertrios op. 158 – 68-49
- 69 (1873), Nr. 20: Rezension des Oktetts op. 176 – 69-20
- 69 (1873), Nr. 35: Rezension der Klavierstücke op. 164 – 69-35
- 70 (1874), Nr. 03: Rezension von Orientales: Huit morceaux pour le piano op. 175 – 70-03
- 70 (1874), Nr. 20: Rezension der Deux morceaux lyriques op. 115 – 70-20
- 71 (1875), Nr. 07: Gotthold Kunkel, Die Programmmusik und Raff’s Leonorensymphonie – 71-07
- 71 (1875), Nr. 15: Personalnachricht zur Aufführung von Raffs Konzert in c-Moll – 71-15
- 72 (1876), Nr. 29: Rezension der Streichquartette op. 192 – 72-29
- 72 (1876), Nr. 51: Personalnachricht zur Ernennung als Ehrenmitglied der Società de Quartetto in Mailand – 72-51
- 73 (1877), Nr. 04: Rezension der Humoreske in Walzerform op. 159 – 73-04
- 73 (1877), Nr. 42: Personalnachricht zur Übernahme des Leitung des Dr. Hoch’schen Conservatoriums in Frankfurt am Main – 73-42
- 74 (1878), Nr. 43: Personalnachricht zur Leitung des Musikfestes in Leeds 1880 – 74-43
- 75 (1879), Nr. 33: Nachricht zum Abschluss einer neuen Symphonie – 75-33
Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch
Paula Jehnichen
Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch
Im Jahre 1820 veröffentlicht Johann Wolfgang von Goethe in seinen Schriften Zur Morphologie das Gedicht Urworte. Orphisch (hier in der Vertonung durch Hans Pfitzner),[1] dessen fünf Strophen er noch im selben Jahr in einer weiteren Veröffentlichung einige Erläuterungen beifügte. Goethe war zu dieser Zeit bereits 61 Jahre alt, das Gedicht ist also seinem Spätwerk zuzuordnen. Aus ihm spricht, so Jochen Schmidt, der »Ton einer erfahrungsgesättigten Welt-Weisheit«.[2]

Wie ist der Titel des Gedichts zu verstehen? Als »Orphisch« werden die der Überschrift folgenden Zeilen bezeichnet und verweisen wohl auf die orphische Dichtung, eine Gruppe antiker Texte. Diese, ebenso wie Goethes Gedicht in Hexametern verfasst, behandelt Themen wie die Entstehung der Welt und der Götter. Schon in der Antike wurden sie dem mythischen Sänger Orpheus zugeschrieben. In Kombination mit dem Begriff »Urworte« lässt Goethes Titel universelle Weisheiten über das Leben erwarten.
Das Gedicht besteht aus fünf Strophen, die der Form der Stanze (acht Elfsilbler mit dem Reimschema abababcc) entsprechen, jeweils mit einer eigenen, altgriechischen und ins Deutsche übersetzten Überschrift. Es handelt sich um die Namen von fünf verschiedenen Kräften, fünf Grundmächten, die das menschliche Leben bestimmen: ΔΑΙΜΩΝ (Daimon, Dämon), ΤΥΧΗ (Tyche, das Zufällige), ΕΡΩΣ (Eros, Liebe), ΑΝΑΓΚΗ (Ananke, Nötigung) und ΕΛΠΙΣ (Elpis, Hoffnung).
Diese Begriffe gelangten auf verschlungenem Wege zu Goethe: Als Namen von ägyptischen Gottheiten tauchen vier der Begriffe in einem Text des dänischen Archäologen Georg Zoëga (1755–1809)[3] auf, der wiederum aus den Saturnalia des spätantiken Autors Macrobius zitierte. Auch der fünfte Begriff, Elpis, fällt in Zoëgas Text. Eine deutsche Ausgabe seiner Abhandlung erschien 1820 und inspirierte Goethe zu dessen eigenem ›orphischen‹ Gedicht.[4]
Die Fülle an bedeutungsschweren und geschichtsträchtigen Begriffen schon in den Überschriften lässt erwarten, dass auch der Inhalt über eine hohe Dichte verfügt. Obwohl durchaus ein chronologischer Zusammenhang zwischen den Strophen besteht – sie behandeln nacheinander verschiedene Phasen des menschlichen Lebens, worauf schon die Beschreibung einer Geburt in den ersten Versen hindeutet –, ist es doch hinfällig, nach einer fortschreitenden Handlung zu suchen. Vielmehr werden fünf Mächte oder Kräfte beschrieben, die einerseits nacheinander auftreten und Phasen des menschlichen Lebens bestimmen, andererseits aber auch im ständigen Widerspruch stehen und gemeinsam auf das ganze Leben wirken.
Als Dämon wird die erste Kraft, die auf den Menschen wirkt, bezeichnet. Der Begriff ist mit verschiedenen Bedeutungen besetzt – hier liegt die des angeborenen Wesensgesetzes nahe, die gleichzeitig die Stärke der Individualität hervorhebt.[5] Angesprochen wird ein Individuum, das sich seit seiner Geburt weiterentwickelt und dessen Entwicklung aber doch ein »Gesetz« (Vers 4) zugrunde liegt, dem nicht entflohen werden kann. Goethe selbst erklärt den Dämon zur »unmittelbar ausgesprochene[n], begränzte[n] Individualität der Person«, zu dem also, was die Menschen voneinander unterscheidet und das nicht zerteilt werden kann.[6]
Im Anschluss daran wirkt die zweite Kraft, Tyche, das Zufällige: »ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt« (Vers 10). Es wird deutlich, dass der Mensch nicht allein ist, sondern ein geselliges Wesen, das von seiner Umwelt spielerisch hin- und hergeworfen wird. »Besonders auf die Jugend«[7] wirke die Kraft des Zufalls, schreibt Goethe: Damit wird die Begrenzung durch den Dämon ein wenig relativiert. Gleichzeitig entsteht eine Sehnsucht nach etwas Neuem, ein Warten auf eine »Flamme« (Vers 16) – die dann plötzlich erscheint:
Eros, die Liebe, »stürzt vom Himmel nieder« (Vers 17) und ist die dritte und zentrale Kraft des Gedichts. Hier treffen die beiden bisher dargestellten Gegensätze aufeinander. Einerseits wirkt sehr stark das eigene Wollen, die egoistische Kraft des Dämon, andererseits gibt es ablenkend Fremdartiges. Ebenso wie Tyche ist die Liebe etwas, das von außen auf den Menschen trifft (sogar »stürzt«) und sprunghaft und unverständlich ist (»scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder«, Vers 7). Wie in den beiden Schlussversen zu lesen ist, gibt es aber eine Lösung dieser Orientierungslosigkeit, einen Gegenvorschlag zum »Verschweben im Allgemeinen«: »Doch widmet sich das Edelste dem Einen« (Vers 24). Die Verbindung mit einer anderen Person ist es schließlich, die auch die Verbindung der beiden gegensätzlichen Kräfte Dämon und Tyche möglich macht. So »bringt die Eros-Strophe den Antagonismus von Begrenztheit und Grenzüberschreitung, der die Konstellation der beiden ersten und der beiden letzten Strophen bestimmt, zum Ausgleich. Allein in der Liebe […] gelingt die harmonische Vereinigung der gegenläufigen Tendenzen.«[8] Diese Strophe steht also in mehrfacher Hinsicht im Zentrum des Gedichts, bildet sie doch gleichzeitig dessen Mitte und fungiert außerdem als Vermittlerin zwischen den verschiedenen gegensätzlichen Kräften.
Dass diese Verbindung jedoch nicht endgültig ist, zeigt die folgende Kraft, Ananke, die Nötigung. »Wieder« (Vers 25) wirken begrenzende Zwänge (»Bedingung und Gesetz«, Vers 26) auf den Menschen. Damit beginnt eine Analogie der beiden letzten Strophen zu den ersten beiden des Gedichts: Tendenzen und Motive werden aufgegriffen und weitergeführt. Nachdem die Kräfte Dämon und Tyche einen Widerspruch zwischen Begrenzung und Freiheit eröffnet haben, der dann durch die Liebe aufgelöst wurde, wird dieser Widerspruch zwischen Nötigung und Hoffnung erneut gebildet und verstärkt. Im Gegensatz zu der schon vor der Geburt angelegten Form der Individualität, die sich durch den Dämon ausdrückt, ist die Nötigung eine von außen auf den Menschen einwirkende Kraft: ein Wille, zu dem man gewissermaßen gezwungen wird, ein »hartes Muß« (Vers 30), dem man sich unterordnet. Goethe selbst erläutert diese Strophe nur kurz, jeder kenne diese Zwänge und das Gefühl, der Gegenwart ausgeliefert zu sein.[9]
Um einiges optimistischer mutet die letzte Strophe an. Sie gilt der Hoffnung, einer auf die vorherige Eingrenzung reagierende Kraft, die »entriegelt« (Vers 34), statt zu verschließen, und »beflügelt« (Vers 38), statt einzuengen. Zuletzt steht eine Befreiung aus allen Zwängen, sowohl den räumlichen (»sie schwärmt durch alle Zonen«, Vers 39) als auch den zeitlichen (»und hinter uns Äonen!«, Vers 40). Auf die strenge Stimmung der Ananke-Strophe folgt ein euphorisches Durchbrechen aller Grenzen, das in seiner Absolutheit vielleicht schon illusionär ist.[10]
Nachdem der Betrachtung der einzelnen Strophen sollen nun noch ihre chronologischen und konzeptionellen Zusammenhänge in den Fokus rücken. Einerseits wird ein zeitlicher Verlauf dargestellt, andererseits existiert auch eine zyklische Struktur, die sich durch die Anordnung der vier äußeren Strophen um die mittlere Elpis-Strophe ausdrückt. Das menschliche Leben als Zusammenwirken verschiedener Kräfte wird mithilfe zweier zeitlicher Ordnungen beschrieben: Zum einen durchläuft man fünf aufeinander folgende Phasen, gleichzeitig aber wird der ständig wirkende Widerspruch zwischen Begrenzung und Freiheit dargestellt.
Eine Chronologie der Strophen besteht insofern, als dass jede Strophe eine Lebensphase repräsentiert und insgesamt eine ›prototypische‹ Lebensgeschichte abgebildet wird. Dies wird einerseits im Gedicht selbst deutlich (durch direkte Bezüge zu Lebensstationen wie der Geburt, Vers 1, und auch durch Verweise auf einen zeitlichen Verlauf, Verse 25 und 31). Außerdem zieht Goethe in seinem Kommentar eine Verbindung der einzelnen Strophen zu verschiedenen Lebensphasen.[11] Diese Zuordnung ist folgendermaßen: Dämon steht die Geburt und die Weiterentwicklung angeborener Eigenschaften, Tyche für die unbeständige Jugend, Eros für die Lebenswende, Ananke für die sich den Anforderungen der Gesellschaft stellende Arbeit und Elpis für das Alter.[12]
Gleichzeitig ist eine simultane Dialektik am Werk: Beschrieben wird eher ein Zustand, als dass ein Geschehen erzählt wird. Die Kräfte hängen zusammen und wirken im Zusammenspiel – dies wird vor allem durch ihre zyklische Anordnung klar. Es gibt begrenzende Kräfte (Dämon, Ananke), denen befreiende (Tyche, Elpis) gegenübergestellt werden. Im Zentrum steht Eros, die Liebe, die die gegensätzlichen Tendenzen zu verbinden versucht. Im zweiten Teil des Gedichts wiederholen sich die Motive; die Widersprüche werden nicht endgültig vereinigt oder aufgehoben, sondern sind ständig wirksam. Dieses Zusammenspiel bestimmt das Gedicht[13] und wird darüber hinaus auch als Grundthema von Goethes Werk gesehen.[14]
Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage, ob es sich hier überhaupt um ein einzelnes Gedicht und nicht viel mehr einen Gedichtzyklus handelt, zu betrachten. Die einzelnen Strophen haben spezielle Überschriften und sehr verschiedene Charaktere; somit könnten also die Urworte als Zyklus bezeichnet werden. Doch die Strophen hängen inhaltlich zusammen, ihre Anordnung hat eine ganz besondere Wirkung – gerade die oben genannte zyklische Komposition kommt nur unter Betrachtung aller Strophen zum Ausdruck. Darin unterscheidet sich das Werk auch von Zyklen wie den Römischen Elegien oder dem West-östlichen Diwan, die ungefähr zeitgleich mit den Urworten entstanden sind. Somit ist es wohl treffend, die Urworte. Orphisch als ein einzelnes Gedicht zu bezeichnen.
Was das Orpheus-Motiv betrifft, bedient Goethe sich offensichtlich nicht des Mythos von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt. Orpheus tritt weder auf noch wird seine Geschichte erzählt. Vielmehr wird eine Eigenschaft der mythischen Figur aufgegriffen, die in musikalischen Orpheus-Bearbeitungen nur selten zum Tragen kommt: nämlich die des mythischen Autors, des großen Philosophen, der tief bedeutsame Gedichte verfasst. Orpheus ist nicht nur ein sagenumwobener Sänger, sondern steht seit der Antike auch für »die Einheit von religiöser und poetischer Inspiriertheit, die Erschaffung der Welt durch den Eros und ihre Verzauberung durch Musik und Poesie«.[15] Das Orphische ist also weniger an eine Figur als an eine Art Gattungsbezeichnung gebunden – in ihrem Ton, ihrer Form und in ihrem Thema sind Goethes Worte »orphisch«.[16]
Goethe schrieb einleitend über sein Gedicht:
»Was nun von den älteren und neueren orphischen Lehren überliefert worden, hat man hier zusammendrängen, poetisch […] vorzutragen gesucht.«[17]
Verschiedene antike, mythische Motive aufgreifend, formuliert er eine Weisheitslehre, die das menschliche Leben im Spannungsfeld gegensätzlicher Kräfte beschreibt und sich so einen ganz eigenen Platz in der Reihe der Orpheus-Bearbeitungen in den verschiedenen Künsten verschafft.
Johann Wolfgang von Goethe: »Urworte. Orphisch« (1817)[18]
ΔΑΙΜΩΝ, Dämon
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.ΤΥΧΗ, Das Zufällige
Die strenge Grenze doch umgeht gefällig
Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt;
Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig,
Und handelst wohl so, wie ein andrer handelt:
Im Leben ist’s bald hin-, bald wiederfällig,
Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt.
Schon hat sich still der Jahre Kreis gezündet,
Die Lampe harrt der Flamme, die entzündet.ΕΡΩΣ, Liebe
Die bleibt nicht aus! – Er stürzt vom Himmel nieder,
Wohin er sich aus alter Öde schwang,
Er schwebt heran auf luftigem Gefieder
Und Stirn und Brust den Frühlingstag entlang,
Scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder,
Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang.
Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen,
Doch widmet sich das edelste dem EinenΑΝΑΓΚΗ, Nötigung
Da ist’s denn wieder wie die Sterne wollten:
Bedingung und Gesetz und aller Wille
Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,
Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille;
Das Liebste wird vom Herzen weggescholten,
Dem harten Muß bequemt sich Will’ und Grille.
So sind wir scheinfrei denn nach manchen Jahren
Nur enger dran als wir am Anfang waren.ΕΛΠΙΣ, Hoffnung
Doch solcher Grenze, solcher ehrnen Mauer
Höchst widerwärt’ge Pforte wird entriegelt,
Sie stehe nur mit alter Felsendauer!
Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt:
Aus Wolkendecke, Nebel, Regenschauer
Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie beflügelt,
Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen;
Ein Flügelschlag – und hinter uns Äonen!
Quellen und Literatur
Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, Bd. 2: Gedichte 1800–1832, hrsg. von Karl Eibl, Frankfurt am Main 1988.
Ders.: Ueber Kunst und Alterthum, Bd. 2/3, Stuttgart 1820, S. 66–78.
Cornelius Ludwig, Orphische Dichtung, in: Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen, hrsg. von Dieter Burdorf u. a., 3. Aufl., Stuttgart 2007, S. 599.
Gerhart Schmidt, Goethes »Urworte. Orphisch«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 11/1, 1957, S. 37–53.
Jochen Schmidt, Goethes Altersgedicht »Urworte. Orphisch«. Grenzerfahrung und Entgrenzung, Vortrag vom 26. November 2005, Heidelberg 2006.
Inge Wild, Urworte. Orphisch, in: Metzler Goethe Lexikon, hrsg. von Benedikt Jeßing, Bernd Lutz und Inge Wild, Stuttgart 1999, S. 506.
Anmerkungen
[1] Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 501f.
[2] Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 5.
[3] Georg Zoëgas Abhandlungen, hrsg. von Friedrich Gottlieb Welcker, erschienen 1817 in Göttingen; vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 8.
[4] Vgl. ebd., S. 9.
[5] Vgl. ebd., S. 17.
[6] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum; zit. nach Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 36.
[7] Ebd. S. 37.
[8] Ebd., S. 22.
[9] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 39.
[10] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 26.
[11] Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 37.
[12] Vgl. Karl Otto Conrady, Gott und Natur. Weltanschauliche Gedichte, in: Goethe, Leben und Werk, Düsseldorf 2006, S. 915.
[13] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 15.
[14] Inge Wild, Urworte. Orphisch, S. 506.
[15] Ebd.
[16] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 9.
[17] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 35.
[18] Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 501f.
Jacques Offenbach: Orphée aux Enfers
Caroline Sanden
Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers (1858) – zwischen Mythentravestie und Gesellschaftskritik
»Orpheus, Direktor der Musikschule von Theben; Musikstunden pro Monat oder stundenweise.«
Diese Türinschrift ist das Erste, was dem Zuschauer ins Auge fällt, nachdem sich der Vorhang zu Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers (Orpheus in der Unterwelt) gehoben hat. Orpheus, dessen Musik der Sage nach selbst Götter und Steine erweichen kann, ist in Offenbachs Werk ein Musiklehrer, der mit seinem Geigenspiel seine Ehefrau zur Weißglut bringt. Seine Frau Eurydike fühlt sich durch seine Musik zugleich belästigt und vernachlässig, Orpheus dagegen findet, sie wisse sein Genie so gar nicht zu schätzen.
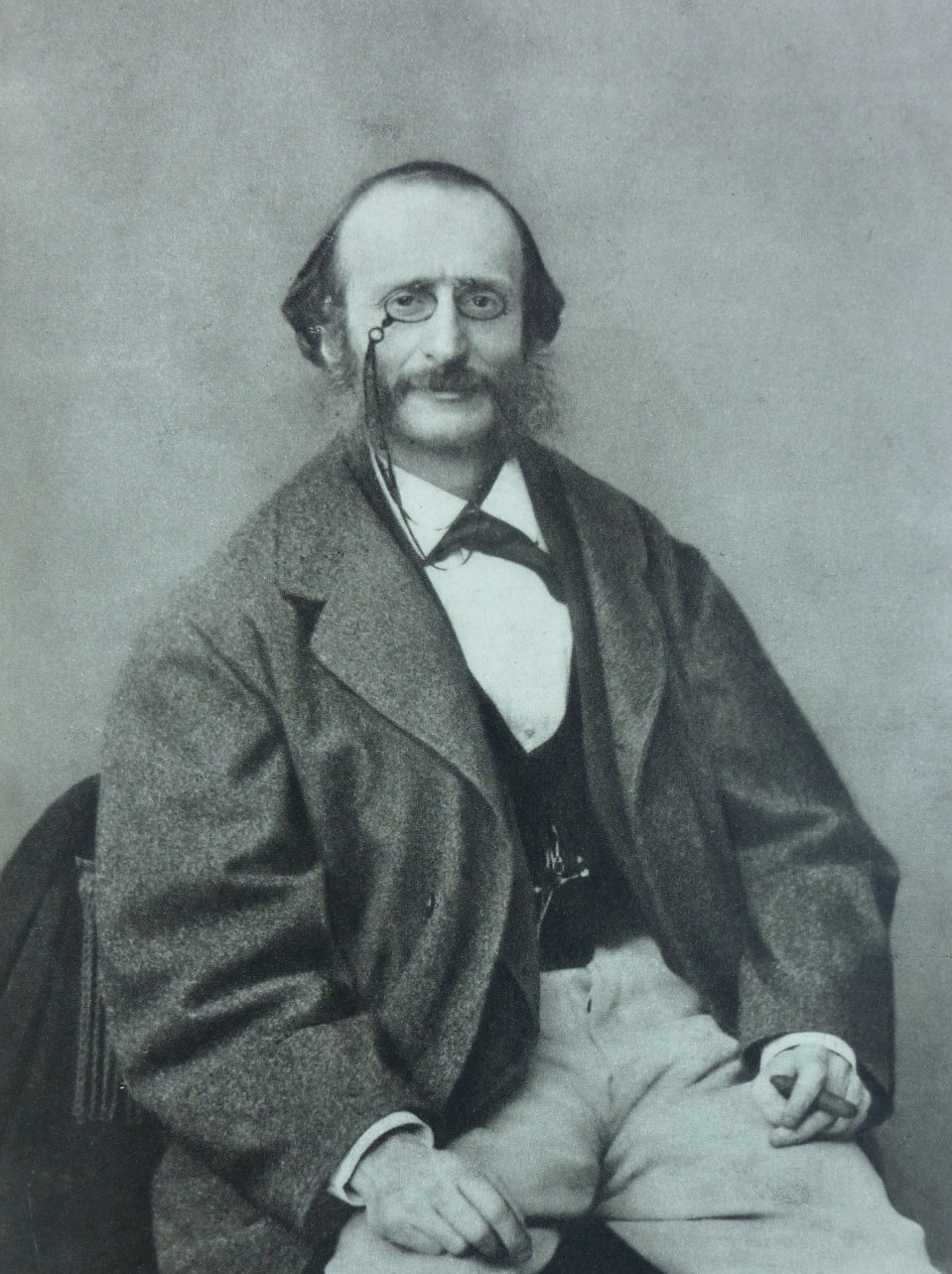
Die Idee zu dieser Parodie auf den bekannten antiken Mythos stellten Offenbachs Librettisten Hector Crémieux und Ludovic Halévy ihm schon im Jahre 1856 vor.[1] Zwei Jahre und eine Aufstockung des Personalbestandes von Offenbachs Theater später konnte Orphée aux Enfers in Paris schließlich uraufgeführt werden. Der Komponist wählte für sein Werk zwar vorerst die Bezeichnung »opéra-bouffon«, inzwischen wird es jedoch als »Operette« geführt – und Offenbach bezeichnete sein Werk später auch selbst so:[2] Während also Gluck 1762 mit seiner Oper über den Orpheus-Stoff eine Reform der Oper in Paris vorangetrieben hatte, begründete Offenbach mit Orpheé aux Enfers an gleicher Stelle die Gattung der Operette.[3]
Orpheus in der Unterwelt bescherte Offenbach finanziellen Erfolg und internationale Bekanntheit. Seine Mythenparodie erfuhr Nachahmungen in aller Welt; das Schlussstück, der Galop infernal, mit dem Offenbach den aus Algerien stammenden Cancan auf die Bühne brachte, ist eines seiner bekanntesten Stücke und erfreut sich bis heute großer Bekanntheit. Der Zusammenbruch des Kaiserreichs, dem Offenbach einen Teil seines Erfolges zu verdanken hatte, beendeten seine größten Triumphe allerdings. Er komponierte zwar unverdrossen weiter, erlebte den weltweiten Erfolg von Hoffmanns Erzählungen (1881) allerdings schon nicht mehr.[4]
Offenbachs Verarbeitung des Orpheus-Mythos bewegt sich zwischen Mythentravestie und Gesellschaftskritik. Travestie bezeichnet dabei mit Volker Klotz eine »verblüffende, heiter-bedenkliche Verkleidung«:[5] Man erlebt einen antiken Mythos also in völlig neuem Gewand. Vieles wird zwar verändert, um den Mythos in anderem Licht darstellen zu können, aber trotzdem bleiben grundsätzliche Entsprechungen: Götter wie Jupiter und Pluto, die Herrscher über Olymp und Unterwelt, und natürlich Orpheus und Eurydike. Die ›Verkleidung‹ beginnt allerdings mit der Einführung einer völlig neuen Figur, und zwar der »Öffentlichen Meinung«.
Orte des Geschehens sind die Gegend von Theben, der Olymp und die Unterwelt. Das Handlungsmuster des Mythos – Eurydikes Tod, Orpheus’ Rettungsversuch und sein Scheitern – bleibt erkennbar, wird allerdings stark verändert, vor allem ausgelöst durch die vollkommen anderen Charaktereigenschaften der Figuren. So ist Orpheus keinesfalls traurig über den Verlust seiner Frau. Im Gegenteil, er ist sogar außerordentlich froh darüber, denn das Ehepaar hat sich schon lange auseinandergelebt, und mittlerweile zeigen beide unverhohlenes Interesse an anderen Personen: Orpheus an einer schönen Nymphe, Eurydike an dem – aus Vergils Georgica entlehnten – Schäfer Aristeus. Doch hinter dem Schäfer verbirgt sich bei Offenbach und seinen Librettisten in Wahrheit Pluto, der Gott der Unterwelt, der Eurydike mit in den Hades nimmt. Orpheus hinterlässt sie immerhin eine Nachricht:
»Verlassen muß ich diese Schwelle,
denn ich bin tot ohn’ allen Zweifel,
Aristeus war der Gott der Hölle,
und jetzt holt mich der Teufel.«
Doch Orpheus’ Frohlocken über den Tod seiner Frau wird unterbrochen: Die Öffentliche Meinung fordert ihn auf, seine Gattin aus der Unterwelt zurückzufordern. Orpheus muss ihr gehorchen; schließlich hängen sein Ansehen und sein guter Ruf als Musiklehrer von der Öffentlichen Meinung ab. Im Olymp langweilen sich derweil die Götter und rebellieren gegen Jupiters Herrschaft. Sie werfen ihm vor, sie mit fadem Nektar und Ambrosia ruhigzustellen. Orpheus und die Öffentliche Meinung erscheinen, auf Geheiß der Öffentlichen Meinung bezichtigt Orpheus Pluto der Entführung. Um die Wahrheit herauszufinden, beschließt Jupiter in die Unterwelt zu reisen – die anderen Götter alle im Schlepptau.
Eurydike langweilt sich in der Unterwelt währenddessen ebenfalls. Pluto konnte seine erotischen Versprechen nicht einhalten. Auch sein stets betrunkener Diener Hans Styx hat mit seinem Werben um Eurydike keinen Erfolg. Dann jedoch taucht Jupiter in der Gestalt einer Fliege auf und kann Eurydike betören. Er verspricht ihr eine heimliche Entführung. Das finale Bild beginnt mit einem Höllenfest für die olympischen Gäste. Jupiter stellt die Bedingung, dass Orpheus Eurydike dann mitnehmen darf, wenn er sich nicht nach ihr umdreht: Da Orpheus Eurydike ja gar nicht mehr liebt, ist das eigentlich auch nicht zu erwarten. Dann aber schleudert Jupiter einen Blitz, Orpheus erschrickt und dreht sich um. Zu beiderseitiger Erleichterung erhält er Eurydike also doch nicht zurück. Um sein Ansehen zu wahren, darf Jupiter Eurydike jetzt natürlich weder sich noch Pluto zusprechen. Also bestimmt er, dass sie sich als Bacchantin dem Gefolge des Gottes des Weins anschließen soll. Von ihrer Freiheit beflügelt, stimmt Eurydike den Cancan an und die Operette endet mit einem wilden Tanz.
In antiken Heldensagen spielt das heroische Handeln die zentrale Rolle. Orpheus handelt im ursprünglichen Mythos wie ein Held: mutig und aus Liebe. Er ist bereit, alles für Eurydike zu tun. Doch in Offenbachs Operette bestimmen andere Muster das Geschehen. Das Werk stellt vor allem einen Konkurrenzkampf dar, der die Motive und Handlungsweisen der Protagonisten bestimmt. Dabei geht es sowohl um den Kampf ums Prestige als auch um den Kampf um Eurydike, zugleich um einen Kampf zwischen Olymp und Unterwelt. Nur Orpheus spielt in diesem Kampf überhaupt keine Rolle. Das Werk vollführt also im Prinzip eine »Verkehrung von antik heroischem in bourgeoises Handeln. Dem aber […] können auf der Bühne nur unberechenbar widerbürgerliche Ausbrüche in die Quere schießen: Lust auf unbegrenzte, unnütze, unvernutzbare Energieentladungen im Lieben, Trinken, Tanzen.«[6] Am Ende aber erreicht keiner der Götter das Ziel: Niemand ›besitzt‹ Eurydike am Schluss. Und sie selbst wetteifert ausschließlich mit ihren eigenen sehnsüchtigen Leidenschaften, denen kein Mann und kein Gott gewachsen ist – auch nicht in veränderter Gestalt, was sie immer nur vorübergehend beeindruckt.[7]
Die drei Duette der Operette – Orpheus und Eurydike, Öffentliche Meinung und Orpheus, Jupiter und Eurydike – zeigen diesen Kampf um Eurydike und heben sich auch musikalisch von den restlichen Stücken ab. Das erste Duett stellt die Beziehungsprobleme von Orpheus und Eurydike dar; es geht um das Verhältnis von Mann, Frau und Violine. Mit großer Geste versucht Orpheus zwar, Eurydike mit seiner Musik zu beeindrucken: Sie hingegen ist zutiefst genervt von seinem Geigenspiel. Dabei untermalt die Musik ihr Beziehungsproblem: Orpheus ist in seine Musik so versunken, dass er nicht einmal merkt, dass er Eurydike (statt seines Instruments) in ihrer Empörung dabei viel faszinierende Klänge entlockt als zuvor.[8]
Insofern lässt sich argumentieren, dass in dieser Operette eigentlich Eurydike als Hauptfigur bezeichnet werden sollte. Sie eröffnet das Werk, ist an zwei wichtigen Duetten beteiligt, der Konkurrenzkampf der Männer dreht sich einzig um sie, die Geschichte geht für sie am besten aus, sie stimmt den finalen und ausufernden Schlusstanz an und hat damit auch ›das letzte Wort‹. Das Ende erhöht sie zur Priesterin des Bacchus und gibt ihr erstmals einen eigenen Raum abseits ihrer Liebhaber.[9] Diese Schlusswendung richtet sich satirisch gegen die besitzgierigen Göttermänner Pluto und Jupiter und parodiert mit dem Cancan die typischen Finalensembles der großen Oper. Offenbach möchte aber nicht nur die Gattung Oper im Allgemeinen parodieren, er baut auch eine ganz konkrete Anspielung auf Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice ein. Die Öffentliche Meinung fordert Orpheus auf, nun um Eurydike zu bitten, woraufhin dieser Glucks Arie Ach ich habe sie verloren (Che farò senza Euridice / J’ai perdu mon Eurydice) anstimmt. Aber die Götter sind der allseits bekannten Arie längst überdrüssig: Im Gegensatz zum antiken Mythos kann Orpheus mit seiner Musik also weder Eurydike noch die Götter beeindrucken.
Orphée aux Enfers bringt nicht nur musikalische Parodien, sondern auch gesellschaftskritische Elemente. Das betrifft vor allem die Darstellung Jupiters, seines Regiments und der Langeweile bzw. des ennui der Götter. Jupiter setzt augenscheinlich »mehr auf Schein als auf Sein«:[10] »Alles für die Etikette und durch die Etikette!«, heißt es im zweiten Bild. Wenn Offenbach und seine Librettisten damit vermutlich Napoleon III. treffen wollten, reagierte dieser beim Besuch einer Vorstellung jedoch souverän und zeigte sich außerordentlich begeistert.[11] Trotzdem waren die Reaktion nicht nur positiv. Jules Janin verurteilte kurz nach der Uraufführung, was er als Missbrauch des Mythos auffasste: »Welch Profanation des glorreichen Altertums dieser Orpheus ist!«[12] Damit weckte er jedoch erst das Interesse: Die Vorstellungen der nächsten Wochen waren ausverkauft; die Librettisten kolportierten, dass die komischsten Partien eigentlich nur wörtliche Zitate von Janin seien.[13] Zutiefst amüsiert zog es das Publikum noch monatelang in die Vorstellungen, um Offenbachs Parodie des Mythos von Orpheus und Eurydike mit eigenen Augen zu sehen.
Literatur
Crémieux, Hector, und Ludovic Halévy: Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt. Opéra bouffon in zwei Akten und vier Bildern, hrsg. von Henning Mehnert, Stuttgart: Reclam 2001.
Grun, Bernhard: Kulturgeschichte der Operette, Berlin: Lied der Zeit Musikverlag 1967.
Klotz, Volker: Operette. Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst, München: Piper 1991.
Klügl, Michael: Erfolgsnummern. Modelle einer Dramaturgie der Operette, Laaber: Laaber 1992.
Kracauer, Siegfried: Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit, hrsg. von Karsten Witte, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976.
Anmerkungen
[1] Henning Mehnert, Nachwort zu Hector Crémieux’ und Ludovic Halévys Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, S. 118.
[2] Ebd., S. 116.
[3] Ebd., S. 113.
[4] Volker Klotz, Operette, S. 510.
[5] Ebd., S. 512.
[6] Ebd., S. 512.
[7] Ebd., S. 513.
[8] Ebd., S. 515.
[9] Michael Klügl, Erfolgsnummern, S. 100.
[10] Henning Mehnert, Nachwort zu Hector Crémieux’ und Ludovic Halévys Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, S. 114.
[11] Ebd.
[12] Bernhard Grun, Kulturgeschichte der Operette, S. 126.
[13] Ebd., S. 127.
Franz Liszt: Orpheus
Magdalena Engels
Die Symphonische Dichtung Orpheus (1853/54) von Franz Liszt
Als Weimarer Kapellmeister führte Franz Liszt ab 1848 nicht nur die dortige Hofkapelle aus 38 fest angestellten Musikern zu neuen Höchstleistungen:[1] Mit seinen einsätzigen »Symphonischen Dichtungen« wollte er zudem auf eine neue Weise die Dichtkunst (teils auch die Bildende Kunst) mit der Tonkunst verbinden. Diesen Kompositionen stellte er stets ein »der rein instrumentalen Musik in verständlicher Sprache beigefügtes Vorwort« voran, »mit welchem der Komponist bezweckt, die Zuhörer gegenüber seinem Werke von der Willkür poetischer Auslegung zu bewahren und die Aufmerksamkeit im voraus auf die poetische Idee des Ganzen […] hinzuweisen«.[2]
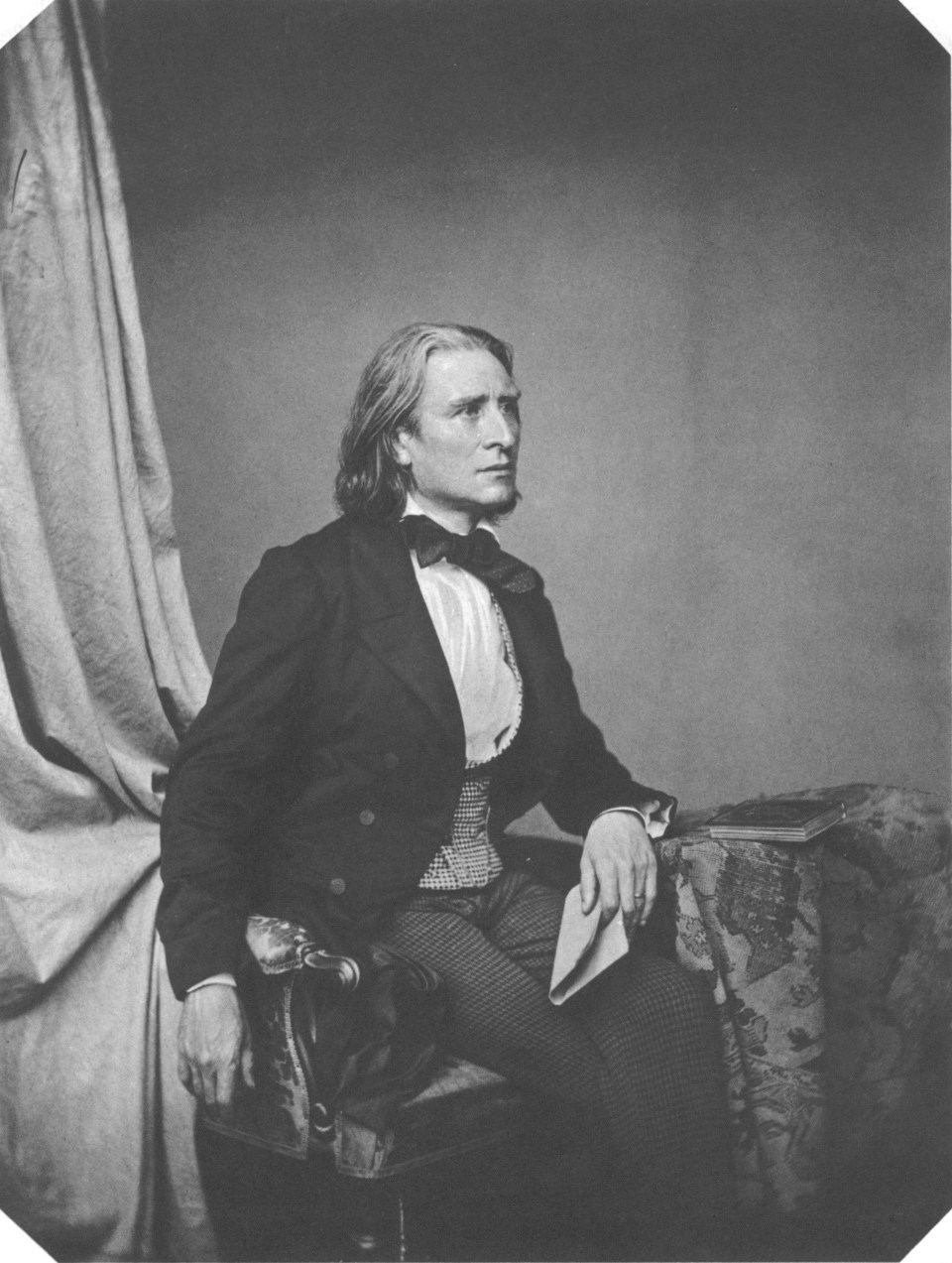
Die Aufführung von Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice unter der Leitung Liszts hatte ihn Mitte der 1850er Jahre zur Komposition seiner vierten Symphonischen Dichtung bewegt, die zugleich als Introduktion zu Glucks Oper dienen sollte. Während Gluck Orpheus nicht primär als übermenschlichen Halbgott, sondern als trauernden Gatten darstellte,[3] wollte sich Liszt von dieser Deutung wiederum distanzieren und verstand den Orpheus-Stoff stattdessen symbolisch und als Imagination des griechischen Mythos.[4]
Die Symphonische Dichtung Orpheus lässt sich im Rahmen ihrer einsätzigen Form in drei Teile untergliedern. Indem Liszt nicht nur eine, sondern sogar zwei Harfen einsetzt, verweist er schon klanglich auf Orpheus als mythischen Harfen- oder Leierspieler. Aus dem Liegeton der Hörner wird dabei in der Einleitung in C-Dur in den Violoncelli ein erstes Thema entwickelt, das mit Bezug auf Liszts Vorwort mitunter als Zeichen für den Gesang des Orpheus beschrieben worden ist:

Der Mittelteil im terzverwandten E-Dur nimmt dieses Thema dann auf und verarbeitet es im Sinne der »Themenmetamorphose« oder »Motivtransformation«. Aus dem initialen Thema entsteht durch ständige Entwicklung eine Vielzahl unterschiedlicher Gestalten. Ein zweites Motiv tritt hinzu, das sich – musikalisch mit einer über den Hörnern und über Dreiklangsbrechungen der Harfen gleichsam schwebenden Linie der Solovioline – mit der Nennung der »elysischen Lüfte« und »Weihrauchwolken« in Liszts Vorwort (siehe unten) assoziieren lässt:

Arnfried Edler beschrieb diesen Mittelteil auf Grundlage dieser Transformationen generell als ein »Bild des ständigen Umherirrens, der Verheißungen und Enttäuschungen«.[5] – Der Schlussteil, der wiederum in C-Dur steht, ist klanglich von Streichertremoli und Harfenarpeggien geprägt. Spiegelbildlich zum Beginn lösen sich die thematischen Gestalten an dieser Stelle wieder auf: Nach einem anfänglich aufbrausenden und sich allmählich beruhigenden Abschnitt sinkt, nochmals mit Edler gesprochen, Orpheus’ »Klage in […] Gestaltlosigkeit reiner Harmonien«. Die den Tonraum umgreifenden Harmonien lösen sich im Schlussklang, in der »Naturharmonie«, auf.[6] Orpheus, in Liszts Vorwort als Symbol der Kunst apostrophiert, schwebt gleichsam dahin.

Liszt legt mit dieser Symphonischen Dichtung einen Kontrast zur Gluck’schen Auffassung des Mythos vor. Orpheus und Eurydice versteht er als Symbole: Das Ideal, Eurydice, wird von Übel und Schmerz verschlungen, was der Mythos im Tod der Eurydice ausdrückt. Die (ethisch und metaphysisch wirkende) Kunst, durch Orpheus symbolisiert, bringt es zwar fertig, das Ideal aus der Finsternis der Unterwelt herauszuführen: Es gelingt ihr jedoch nicht, das Ideal auch auf Erden zu halten – die beiden Liebenden Orpheus und Eurydice werden voneinander getrennt. Liszt selbst beschrieb dies in seinem Vorwort wie folgt:
»Heute wie ehemals und immer ist es Orpheus, ist es die Kunst, welche ihre melodischen Wogen, ihre gewaltigen Akkorde wie ein mildes, unwiderstehliches Licht über die widerstrebenden Elemente ergiesst, die sich in der Seele jedes Menschen, und im Innersten jeder Gesellschaft im blutigen Kampf befehden. Orpheus beweint Eurydice, das Symbol des im Uebel und im Schmerz untergegangenen Ideals. Es ist ihm vergönnt, sie den Dämonen des Erebus zu entreissen, sie heraufzubeschwören aus den Finsternissen der Unterwelt, nicht aber sie im Leben zu erhalten«.
So tritt in Liszts Symphonischer Dichtung im 19. Jahrhunderts auch die Instrumentalmusik in die Diskussion über die Kunst und das Ideale ein: Sie stellt die Macht der Tonkunst als Gegenpol zur Barbarei dar – und fügt damit der Interpretationsgeschichte des antiken Orpheus-Mythos eine weitere Facette hinzu.
Liszts Vorwort in der Übersetzung von Peter Cornelius:
Als wir vor einigen Jahren den Orpheus von Gluck einstudirten, konnten wir während der Proben unsre Fantasie nicht verhindern, von dem in seiner Einfachheit ergreifenden Standpunkt des grossen Meisters zu abstrahiren, und sich jenem Orpheus zuzuwenden, dessen Name so majestätisch und voll Harmonie über den poetischen Mythen der Griechen schwebt. Es war dabei das Andenken an eine etrurische Vase in der Sammlung des Louvre in uns wieder lebendig, auf welcher jener erste Dichter-Musiker dargestellt ist, mit dem mystischen königlichen Reif um die Schläfe, von einem sternbesäeten Mantel umwallt, die Lippen zu göttlichen Worten und Gesängen geöffnet, und mit mächtigem Griff der feingeformten schlanken Finger die Saiten der Lyra schlagend. Da scheinen die Steine gerührt zu lauschen und aus versteinten Herzen lösen sich karge, brennende Thränen. Entzückt aufhorchend stehen die Thiere des Waldes, besiegt verstummen die rohen Triebe der Menschen. Es schweigt der Vögel Gesang, der Bach hält ein mit seinem melodischen Rauschen, das laute Lachen der Lust weicht einem zuckenden Schauer vor diesen Klängen, welche der Menschheit die milde Gewalt der Kunst, den Glanz ihrer Glorie, ihre völkererziehende Harmonie offenbaren.
Heute noch sprosst aus dem Herzen der Menschheit, wie auch die lauterste Moral ihr verkündigt ward, wie sie belehrt ist durch die erhabensten Dogmen, erhellt von Leuchten der Wissenschaft, aufgeklärt durch die philosophischen Forschungen des Geistes und umgeben von der verfeinertsten Civilisation, heute noch wie ehemals und immer sprosst aus ihrem Herzen der Trieb zur Wildheit, Begier, Sinnlichkeit, und es ist die Mission der Kunst, diesen Trieb zu besänftigen, zu veredeln. Heute wie ehemals und immer ist es Orpheus, ist es die Kunst, welche ihre melodischen Wogen, ihre gewaltigen Akkorde wie ein mildes, unwiderstehliches Licht über die widerstrebenden Elemente ergiesst, die sich in der Seele jedes Menschen, und im Innersten jeder Gesellschaft in blutigem Kampf befehden. Orpheus beweint Eurydice, das Symbol des im Uebel und im Schmerz untergegangnen Idelas. Es ist ihm vergönnt, sie den Dämonen des Erebus zu entreissen, sie heraufzubeschwören aus den Finsternissen der Unterwelt, nicht aber sie ihm Leben zu erhalten. Möchten mindestens nie jene Zeiten der Barbarei wiederkehren, wo, wie trunkne, zügellose Mänaden, wilde Leidenschaften die Kunst erliegen machen unter mörderischen Thyrusstäben, indem sie in fiebertollem Wahn sich rächen für die Verachtung, mit welcher jene auf ihre rohen Gelüste herabsieht.
Wäre es uns gelungen, unsern Gedanken vollständig zu verkörpern, so hätten wir gewünscht, den verklärten ethischen Character der Harmonien, welche von jedem Kunstwerk ausstrahlen, zu vergegenwärtigen, die Zauber und die Fülle zu schildern, womit sie die Seele überwältigen, wie sie wogen gleich elysischen Lüften, Weihrauchwolken ähnlich mälig sich verbreiten; den lichtblauen Aether, womit sie die Erde und das ganze Weltall wie mit einer Atmosphäre, wie mit einem durchsichtigen Gewand unsäglichen mysteriösen Wohllauts umgeben.
Literatur
Edler, Arnfried: Studien zur Auffassung antiker Musikmythen im 19. Jahrhundert, Kassel u. a.: Bärenreiter 1970.
Stegemann, Michael: Franz Liszt. Genie im Abseits, München: Piper 2011.
Anmerkungen
[1] Michael Stegemann, Franz Liszt, S. 170.
[2] Zitiert nach Arnfried Edler, Studien zur Auffassung antiker Musikmythen im 19. Jahrhundert, S. 160.
[3] Ebd., S. 148.
[4] Ebd., S. 149.
[5] Ebd., S. 143.
[6] Ebd., S. 146.
Daniel Ernst: Fantasie oder Sonate?
Daniel Ernst
Fantasie oder Sonate?
Analytische Betrachtungen zu
Felix Mendelssohn Bartholdys Fantasie op. 28
Einleitung
Eine gewisse ›Krise der Klaviersonate‹ im 19. Jahrhundert äußert sich unter anderem in der geringen Zahl der Gattungsbeiträge beispielsweise bei den Komponisten im Umkreis von Robert Schumann. Schumann selbst wandte sich nach drei Beiträgen (opp. 11, 14 und 22) von der Gattung ab, Johannes Brahms stellte die Sonatenproduktion ebenfalls nach drei Versuchen ein (opp. 1, 2 und 5), und auch Felix Mendelssohn Bartholdy beließ es bei seinen drei Jugendwerken (opp. 6, 105 und 106[1]). Jedoch stellt Mendelssohns Fantasie op. 28 eine weitere Auseinandersetzung mit der Sonate dar, die den Frühwerken folgte.[2]
In der vorliegenden Studie stehen zwei Fragen im Mittelpunkt: Gibt es in Mendelssohns op. 28 ein zyklisches Prinzip, das die attacca ineinander übergehenden Sätze[3] durch motivische Verknüpfung verbindet? Inwieweit ist unter Einbezug der motivischen Analyse sowie einem Vergleich von erstem und drittem Satz eine Sonatensatzform im Kopfsatz festzustellen? Dabei liegt der Fokus auf dem ersten Satz, da dort die Sonatensatzform eine besondere Rolle spielt. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen, was Mendelssohn zur Änderung des Titels von »Sonate écossaise« zu »Phantasie« bewogen haben könnte.[4] Außerdem stellt sich die Frage, inwieweit Mendelssohns kleiner dimensionierte Klavierwerke, speziell die Lieder ohne Worte, in die Fantasie hineingewirkt haben.
Um die Orientierung zu erleichtern, nehme ich eine dreisätzige Anlage an, deren Kopfsatz von T. 1 bis T. 135 (Con moto agitato ‒ Andante) reicht. Der zweite Satz (Allegro con moto) umfasst die Takte 136 mit Auftakt bis 231, der dritte (Presto) die Takte 232 mit Auftakt bis 468. Außerdem bedeutet die Schreibweise von beispielsweise »T. 35/2«: T. 35, Schlag 2; Taktzahlen in Klammern zeigen einen unvollständigen Takt an. Kleine Noten in den Notenbeispielen kennzeichnen strukturell weniger wichtige Töne, beispielsweise eine Dreiklangsbrechung auf leichter Zählzeit, einen Durchgang, Vorhalt und dergleichen. Auch wenn die Notenausgabe[5] den Titel »Phantasie« nennt, wird im Folgenden die Schreibweise Fantasie verwendet.
Forschungsstand
Mendelssohns Fantasie op. 28 spielte in der Literatur unter einem analytischen Gesichtspunkt bislang kaum eine Rolle. Sie steht im Schatten der 1839 veröffentlichten Fantasie op. 17 von Robert Schumann sowie anderer, größer angelegter Stücke gleichen Titels. Entsprechend dürftig nimmt sich die Zahl der Veröffentlichungen dazu aus, obwohl sie innerhalb von Publikationen zu Klavierfantasien durchaus Erwähnung findet. So führt Arnfried Edler sie im letzten Teil seines Überblickswerks Gattungen der Musik für Tasteninstrumente an, nicht ohne zu erwähnen, dass sie »eher am Rand von Mendelssohns Œuvre«[6] stehe. Dagmar Teepe erwähnt sie im Artikel Fantasie in MGG2S,[7] und Dietrich Kämper bespricht sie im Lichte von Mendelssohns Sonatenschaffen.[8] Dennoch kann von einer umfangreichen und detaillierten Darstellung keine Rede sein. Und wie sehr Mendelssohns Fantasie oft vernachlässigt wird, zeigt die Dissertation von Gudrun Fydrich,[9] die sich mit der Fantasiekomposition im 19. Jahrhundert beschäftigt: Hier werden ausschließlich Werke von Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin und Liszt berücksichtigt. So stellt Ullrich Scheidelers im Druck befindlicher Aufsatz[10] zur Fantasie op. 28 die bislang intensivste Auseinandersetzung mit diesem Werk dar.
Klaviersonate, Klavierfantasie und
Lied ohne Worte um 1830
Eine Annäherung von Sonate und Freier Fantasie fand bereits im 18. Jahrhundert statt,[11] namentlich bei Carl Philipp Emanuel Bach, der über die Freie Fantasie schrieb:
Eine Fantasie nennet man frey, wenn sie keine abgemessene Tacteintheilung enthält, und in mehrere Tonarten ausweichet, als bey andern Stücken zu geschehen pfleget, welche nach einer Tacteintheilung gesetzet sind, oder aus dem Stegreif erfunden werden.[12]
Bei Mozart findet sich die Verbindung seiner Sonate in c-Moll KV 457 mit der Fantasie in c-Moll KV 475, die andeutet, was sich weiterhin fortsetzen sollte:
Das Werk aktualisiert rückblickend die Freie Fantasie mit allen ihren Errungenschaften für die Musiksprache und für das musikalische Denken des 18. Jahrhunderts, und es deutet zugleich eine zentrale Richtung an, welche die Fantasie im 19. Jahrhundert einschlagen und die sie mit der Sonate zusammenführen wird.[13]
In der Folge wurden im ›mitteldeutschen‹ Raum wie auch in Österreich Fantasien und Capricci[14] komponiert, »in denen einzelne Abschnitte als Sonatenexpositionen, ganze Sonatenhauptsätze, Rondi, Menuette, ariose Mittelsätze, verbunden durch figurative und arpeggiert-modulierende Partien, gestaltet waren«.[15] In Werken nach 1800 erscheinen die gegenseitigen Einflüsse von Sonate und Fantasie je verschieden gewichtet: In Beethovens op. 27,1 und 2 dringen, folgt man dem Titel Sonata quasi una fantasia,[16] in die Sonate fantasieartige Elemente ein, während Schuberts sogenannte Wanderer-Fantasie in C-Dur (D 760) von 1822 Sonatenelemente aufweist, indem vier klar abgrenzbare Sätze feststellbar sind, die durch das Anfangsmotiv eine zyklische Verbindung aufweisen.[17]
Ferdinand Gotthelf Hand äußerte sich in seiner Aesthetik der Tonkunst[18] sowohl zur Fantasie als auch zur Sonate. Zum Kopfsatz einer Sonate führte er bezüglich der »Gemüthsstimmung« aus:
Das erste Allegro macht die Grundlage des Ganzen aus. Sein Inhalt läßt keine theoretische Voraussetzung zu; er selbst ist Product origineller Erfindung.[19]
Ist der ästhetische Gehalt des ersten Satzes demnach der Intuition des Komponisten überlassen, so folgt Hand in der formalen Gestaltung dem Prinzip der Dreiteiligkeit, das wohl Heinrich Birnbach mit seiner Aufsatzserie in der Berliner AmZ konstituierte, nachdem bereits im 18. Jahrhundert beispielsweise Johann Friedrich Anton Fleischmann[20] eine dreiteilige Satzanlage entworfen hatte.[21] Im ersten Teil ist der Ablauf von Erstem Thema, Modulation, Zweitem Thema und Koda[22] vorgesehen, wobei das Zweite Thema in Dursonaten auf der Dominante stehe und ihm eine »Passage« folgen könne. In Moll-Stücken sei innerhalb der Exposition die Modulation in die parallele Durtonart üblich.[23]
Zur Fantasie äußerte sich Hand ebenso sowohl zu ästhetischen Belangen, die unter anderem die »unmittelbarste Darstellung eines individuellen Seelenlebens« im »Scheine der Zufälligkeit«[24] fordern, als auch zu formalen Gesichtspunkten, für die er als gängige Gestaltung alternierende Allegro- und Adagio-Passagen sah.[25] In der Nähe der Fantasie zur Sonate macht Hand einen Widerspruch aus, da das Ungeplante und Skizzenhafte der Fantasie dem planvollen Ablauf einer Sonate entgegenstehe, und wirft solchen Fantasie-Kompositionen vor, sie seien »oft nur eine freiere Behandlung der Sonate«.[26]
Ein Grund für die zunehmende Dominanz der Fantasie liegt möglicherweise im sukzessiv abnehmenden Interesse an der Gattung Klaviersonate ab 1810, das sich bis 1830 noch verstärkte.[27] So konstatierte Robert Schumann:
Einzelne schöne Erscheinungen dieser Gattung [der Sonate für Klavier] werden sicherlich hier und da zum Vorschein kommen und sind es schon; im Übrigen aber, scheint es, hat die Form ihren Lebenskreis durchlaufen, und dies ist ja in der Ordnung der Dinge, und wir sollten nicht jahrhundertelang dasselbe wiederholen und auch auf Neues bedacht sein. Also schreibe man Sonaten oder Phantasien (was liegt am Namen!), nur vergesse man dabei die Musik nicht, und das andere erfleht von eurem guten Genius.[28]
Einerseits wird hier der Unterschied zwischen Sonate und Fantasie gleichsam aufgehoben, andererseits deutet sich an, wie paralysiert die Sonatenproduktion dem beethovenschen Erbe gegenüber stand. So überrascht es nicht, dass Schumann an den Sonaten der Zeit kurz vor 1840 kritisierte, sie seien »nur als eine Art Specimina, als Formstudien zu betrachten; aus innerem starken Drang werden sie schwerlich geboren.«[29] An anderer Stelle ergänzte er:
Und hätte denn Beethoven umsonst gelebt? Wer lesen kann, der hält sich nicht mehr bei dem Buchstabiren auf; wer Shakespeare versteht, ist über den Robinson hinüber; kurz der Sonatenstyl von 1790 ist nicht mehr der von 1840: Die Ansprüche an Form und Inhalt sind überall gestiegen.[30]
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewann das Lyrische Klavierstück[31] an Bedeutung und trat in der Folge in Konkurrenz zur in die Krise geratenen Klaviersonate.[32] In Mendelssohns Klavierschaffen spielen insbesondere die Lieder ohne Worte eine große Rolle. Im August 1832 erschien als Opus 19b ein erster Band unter dem Titel Original Melodies for the Pianoforte bei Novello in London, für die Mendelssohn vom deutschen Verleger Simrock den Titel Sechs Lieder ohne Worte für Pianoforte allein[33] wünschte. Schon bald fand diese Art von Klavierminiaturen zahlreiche Nachahmer.[34] Die später im Zusammenhang mit der Fantasie thematisierten opp. 19,4, 30,3 und 38,4 spielen in ihren akkordischen Sätzen laut Christa Jost auf einen Chorsatz an, zudem handelt es sich bei op. 19,4 um das erste Lied ohne Worte überhaupt.[35] Diese drei Stücke weisen einen Rahmen aus Arpeggien in ‒ im Vergleich zum choralhaften Satz ‒ kleineren Notenwerten auf, und ihnen allen ist »Symmetrie und Geschlossenheit der Melodik, akkordisch-homophoner Satz und Klarheit im Aufbau«[36] gemein. Die Liedsätze tragen die Tempobezeichnungen Moderato, Adagio non troppo und Andante. In der Fantasie ist der denkbar schlicht gehaltene ›Chorsatz‹ im Andante dagegen von den Akkordbrechungen durch das bewegtere Con moto agitato abgesetzt. Die Eröffnungsgeste der Lieder ohne Worte bringt Jost mit einer Musizierpraxis im 19. Jahrhundert in Verbindung, »beim Konzertvortrag einzelne Klavierstücke […] improvisierend einzuleiten und durch freie Zwischenspiele möglichst ungezwungen miteinander zu verbinden«.[37] Die Arpeggien, mit denen die Fantasie op. 28 beginnt und schließt, resultieren womöglich aus derselben improvisatorischen Tradition und nehmen zugleich ein Charakteristikum der Fantasie auf.
Entstehung und Einordnung
Bereits in den Jahren 1829 und 1830 begegnet in Mendelssohns Korrespondenz der Ausdruck »Schottische Sonate«[38]. Ob es dabei schon um die erstmals 1834 bei Simrock und Mori & Lavenu gedruckte Fantasie op. 28 geht, muss allerdings offen bleiben. Jedenfalls trägt das mit »Berlin d. 29. Januar | 1833« datierte Autograph die Überschrift »Sonate écossaise«[39] und weist somit gleichfalls einen verbalen Bezug zu Schottland auf. Von Mai 1830 bis Juni 1832 befand sich Mendelssohn auf einer Bildungsreise, auf der er unter anderem London besuchte; 1833 kehrte er noch zweimal auf die Insel zurück.[40] Schon zuvor hatte sich Mendelssohn mit der Gattung Klaviersonate beschäftigt, entsprechende Jugendwerke entstanden zwischen 1821 und 1827.[41] Spätestens die Fantasie setzte den endgültigen Schlusspunkt unter seine Auseinandersetzung mit dieser Gattung.
Für die Stichvorlage änderte Mendelssohn den Titel von »Sonate« zu »Phantasie« und versah dieses undatierte Autograph zusätzlich mit einer Widmung an Ignaz Moscheles.[42] Was Mendelssohn zur Änderung des Titels bewog, ist schwer nachzuvollziehen, jedoch finden sich Hinweise, dass er mit dem Titel zum Jahresende 1833 noch unsicher war: »Die fismoll Sonate oder Phantasie ist nun in Ordnung gebracht, und erscheint hier bei Simrock«.[43] Möglicherweise fiel auch die Revision und damit die Titeländerung in den Dezember 1833.[44] Gegenüber Simrock äußerte er sich am 7. Dezember 1833, indem er »eine größere Phantasie für Pianoforte allein«[45] zum Druck anbot. Am 11. Mai 1834 nannte Mendelssohns Schwester Fanny jedoch nochmals die andere Gattungsbezeichnung: »Deine Sonate aus Fis gefällt mir sehr, u. ich spiele sie fleißig, denn sie ist à la Felix sehr schwer.«[46]
Analyse
Der Kopfsatz von Mendelssohns Opus 28 scheint zunächst sehr disparate Teile zu vereinigen; seine Form wirkt ungewöhnlich. Für die folgende Analyse spielen zunächst die motivischen Bausteine aller Sätze eine Rolle, um sie anschließend in der Betrachtung der formalen Gestaltung des ersten Satzes zu integrieren.
Motivik
Während Ullrich Scheideler keine gemeinsamen Motive oder Themen in den einzelnen Sätzen sieht,[47] verhält sich dies für Dagmar Teepe anders: »Mendelssohn Bartholdys Fantasie in fis-Moll op. 28 […] stellt einen Einzelsatz mit lockerer Folge unterschiedlicher Teile dar, die durch motivische Bezüge zusammengehalten werden.«[48] Ähnlich sieht es Dietrich Kämper:
Es besteht Grund zu der Annahme, dass der Verzicht auf den Namen »Sonate« zugunsten der Bezeichnung »Phantasie« mehr bedeutet als eine bloße Zurücknahme des gattungsmäßigen Anspruchs. Auch hier, wie schon in Schuberts Wandererfantasie, verbindet sich der Terminus »Fantasie« offenbar mit Experimenten der Monothematik und der zyklischen Satzverbindung.[49]
Dagegen erwähnt Arnfried Edler motivische Beziehungen zwischen den Außensätzen: »Das in lockerer Sonatenhauptsatzform gehaltene Presto-Finale verweist mit versteckten motivischen Anspielungen auf den Kopfsatz zurück.«[50] Bleibt bei Kämper offen, ob sich die erwähnte Monothematik ausschließlich auf den ersten Satz oder auf das gesamte Werk bezieht und welches Motiv bzw. welches Thema beherrschend ist, so drücken sich auch die anderen Autoren kaum spezifischer aus. Dennoch ist der Widerspruch offensichtlich, entsprechend scheint eine genauere Analyse angemessen. Sie nimmt relevante Motive des ersten Satzes sowie Ableitungen in den Fokus und zeigt, wie engmaschig das motivische Netz geknüpft ist. Dabei müssen harmonische Aspekte zunächst zurücktreten.
Erster Satz
Der erste Satz wird durch athematisches Material in Form von Akkordbrechungen in Zweiunddreißigstel-Noten über einem Orgelpunkt eröffnet (T. 1‒8, Abb. 1a). Harmonisch ergibt sich die Folge T – DD – D – T, wobei es sich bei DD und D jeweils um Septnonenakkorde ohne Grundton handelt (Abb. 1b). Diese ›rauschende‹ Gestaltung der rechten Hand erscheint an verschiedenen Positionen des ersten Satzes; ihre formale Funktion wird im folgenden Kapitel genauer untersucht. Neben dem improvisatorischen Charakter lässt sich das Taktmaß und das Metrum in den ersten acht Takten hörend kaum deutlich bestimmen.
Abb. 1: a) Mendelssohn, Fantasie op. 28, T. 1–4, Ausschnitte rechte Hand
b) Schematische Darstellung der Harmonik T. 1–9
Abbildung 2 zeigt weiteres motivisches Material des ersten Satzes. In 1a–c sind die Motive in ihrer vordergründigen Erscheinung gezeigt, während 2a–c die jeweils zugrunde liegende intervallische Struktur ersichtlich macht. Den acht Eröffnungstakten folgt eine regelmäßig gebaute sechzehntaktige Periode, die in Phrase und Gegenphrase zwei unterschiedliche melodische Bausteine ausprägt (Abb. 2, 1a, T. 9 bzw. 1b, T. 11).
Die Dreiklangsmotivik am Beginn der Periode (T. 9–24) könnte als Ableitung der eröffnenden Akkordbrechung interpretiert werden. Allerdings erscheint das Satzbild zu different, und wie erwähnt ist die Akkordbrechung im Gegensatz zur Motivik des Anfangs der Periode athematisch. Die Periode bildet die Grundlage für Derivate. Für den ersten Satz sind auch die beiden Takte der Gegenphrase (T. 11f.) prägend, die in Abb. 2, 1b und 2b dargestellt sind. Eine Diminution von T. 11f. erscheint erstmals in T. 43f. – nun in A-Dur statt fis-Moll – und ist Ausgangspunkt für die Abspaltung der mittleren beiden Sechzehntel in T. 50f. Auf abstrakterer Ebene besteht dieses Motiv der Periode aus einem Sekundschritt nach unten (obere Klammer), der vordergründig im Terzrahmen (untere Klammer) umspielt wird. Bemerkenswert ist der Vorhalt, der auch in anderen Bildungen eine Rolle spielen wird. Die Figur in T. 25f. und die entsprechenden folgenden Takte bis einschließlich T. 33 unterscheiden sich zwar in der Intervallstruktur (siehe Abb. 2, 2b) von den restlichen Bildungen von 1b, bei denen der Terzrahmen wesentlich ist. Jedoch bleiben sowohl der nach unten bogenförmige Melodieverlauf sowie der untere Vorhalt im zweiten Takt erhalten.
Abb. 2: 1) Wesentliche Motive des ersten Satzes
2) Strukturelle Analyse (a–c ist jeweils zusammengehörig zu betrachten)
* = Vorhalt
Unter Abb. 2, 1c bzw. 2c fällt die Erscheinung ab T. 35/2, die ein Tetrachord abwärts zeigt, das durch angesprungene Vorhalte verziert ist und anschließend durch ein aufwärts gerichtetes Tetrachord rückwärts abgeschritten wird. Wie die Klammern zeigen, ist die abwärts gerichtete Bildung entfernt mit 2b verwandt, da auch sie sich aus Terzsprüngen und Sekundschritten zusammensetzt. Insgesamt steht zwar dem fallenden Tetrachord ein steigendes gegenüber, jedoch ist das gis von T. 37/1 durch veränderte Dynamik (plötzliches Piano in T. 37 nach vorhergehendem Crescendo) sowie die abgeänderte Intervallstruktur der ersten Takthälfte von T. 37 (Quart- statt Terzsprung) von der vorhergehenden melodischen Sequenz verschieden. Zudem setzt sich dieses letzte Glied von der vorhergehenden harmonischen Quintfallsequenz[51] ab, da diese dort keine Fortsetzung findet. Auch in der steigenden Tonleiter und der damit gekoppelten Aufwärtssequenz (steigender Parallelismus[52]) weicht das letzte Glied von der harmonischen Sequenz ab: Das cis“ in T. 39 ist mit einem zwischendominantischen Septakkord harmonisiert, der in die Subdominantregion (D-Dur) der lokalen Tonika A-Dur weist. Zwar erscheint anschließend ein d“, das den Tonleiterausschnitt fortsetzt, das aber durch das fis“ in die Mittelstimme verlagert und außerdem nicht mehr unter den Phrasierungsbogen gefasst ist. Dieser durch fis“ zustande kommende Wechsel in ein höheres Register ist womöglich durch das Wiederaufnehmen des zuvor in T. 29 erreichten und durch Oktavgriffe verstärkten fis“ sowie durch den Spitzenton des Abschnitts, d“‘, motiviert, der in den Takten 34 und 35 nochmals erscheint und damit der dargestellten Abwärtssequenz ab T. 35/2 vorausgeht. Diese Sequenz schließt sich dem über die Basslinie (T. 32f.) d–dis–e–fis–gis und auf a erreichten A-Dur unmittelbar an. Insofern mangelt es den Takten 35ff. an tonartlicher bzw. harmonischer Stabilität und thematischer Prägnanz, die hier ein eindeutiges Zweites Thema annehmen ließen. Auch die folgenden Takte (T. 37‒43) sind durch eine trugschlüssige Wendung in T. 41 harmonisch instabil, jedoch durch die melodische Linie ab T. 39/2, welcher der genannte Parallelismus aufwärts vorausgeht und mit ihr durch die Zwischendominante verbunden ist, thematisch eindeutiger gefasst. Melodisch bestehen die Bildungen der beschriebenen Stelle von T. 35/2ff. aus Tonleiterausschnitten, die an ihren Rändern die Verbindung zu ihrer Umgebung herstellen.
Zweiter Satz
Die folgenden beiden Sätze werden auf die bereits dargestellten Motive im ersten Satz untersucht. Der zweite Satz beginnt syntaktisch in der Art eines Satzes, der sich allerdings dergestalt fortsetzt, dass er lediglich sieben Takte umfasst.
Abb. 3: 2. Satz: 1a, 2a und 3a jeweils Melodik
1b, 2b und 3b jeweils strukturelle Analyse
* = Vorhalt
Bereits in diesem Notenbeispiel werden die Bezüge zur Motivik des ersten Satzes offensichtlich. Sogar die Abfolge der Motive der ersten sieben Takte ist der Periode des ersten Satzes ähnlich. Auf die Dreiklangsmotivik, die in den Halbe-Auftakten von T. 135 und 137 auftritt, folgt eine Kombination aus Terzsprung und Sekundschritt. In T. 140 erscheint eine ähnliche Situation wie im ersten Satz: Auch hier ist ein Tonleiterausschnitt wie von Abb. 2, 1c bzw. 2c erkennbar, wobei – artikulatorisch verdeutlicht – das e‘ noch dem unmittelbar vorhergehenden a‘ zuzuordnen ist, während die akkordisch gehaltene Fortsetzung ein Tetrachord bis zum h‘ weiterführt. Die Kadenzformulierung von T. 141/2f. (Alla breve) besteht wiederum aus einer Terz-Sekund-Struktur. Die Vorhaltsmotivik setzt sich in den Takten 143 bis 146 mit Auftakt kontrapunktisch fort. Und schließlich findet sich in T. 149/2‒152/1 in der Oberstimme eine in Terzen abwärts geführte Tonleiter, die insgesamt einen Tritonusrahmen (a‘ bis dis‘), also einen nun abwärts gerichteten Tonleiterausschnitt, ergibt.
Ab T. 153/2 (Abb. 3, 2a und 2b) geht die Satzstruktur in eine von Viertelnoten dominierte Melodik über, welche durchlaufende Achtelnoten begleiten. Auch hier wird, wie in Abb. 2, 1b bzw. 2b, die Struktur von Terz und Sekunde offenbar. Zusätzlich zeigt der obere Vorhalt den Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten Formteil. Eine erwähnenswerte Abwandlung bildet die Fortspinnung ab T. 169/2. Auch sie lässt sich auf die Dreiklangsstruktur beziehen, die in Abb. 2, 1a bzw. 2a gezeigt wurde.[53]
Dritter Satz
Der dritte Satz verweist noch eindeutiger auf den ersten zurück. Schon der Beginn (T. 231) nimmt die Dreiklangsbrechung der ersten beiden Takte der Periode im Kopfsatz auf und leitet davon die Formulierung von T. 241 mit Auftakt (T. 240) ab, die ebenso Ähnlichkeit zu Abb. 3, 3a bzw. 3b aufweist. In T. 293 erscheint hiervon eine Umkehrung.
Abb. 4: 1) Wesentliche Motive des dritten Satzes
2) Strukturelle Analyse (a–c ist jeweils zusammengehörig zu betrachten)
* = Vorhalt
Ab T. 248 sind die Läufe von T. 232f. mit Auftakt der rechten Hand in abgewandelter Form in die linke Hand verlagert und werden vom Motiv in Abb. 4, 1b (T. 248) kontrapunktiert. Auffälligstes Merkmal ist hier der obere Vorhalt, der schon im zweiten Satz wesentlich war, während im ersten Satz der untere Vorhalt eine wichtige Rolle spielte. Die sich anschließende Gestaltung (T. 257) verläuft schrittweise abwärts, wobei die im Terzabstand auf schwerer Zählzeit befindlichen Töne mittels Durchgängen erreicht werden. Die Mittelstimme nimmt dabei die Töne auf, die im ersten Satz T. 25f. eine Oktave tiefer erscheinen.[54]
Schließlich tritt ab T. 270/3 eine kantable Melodie mit einem charakteristischen oberen Vorhalt auf, wie dies bereits im zweiten (Abb. 3, 2a und 2b) und in Ansätzen auch im ersten Satz (Abb. 2, 1c bzw. 2c) der Fall war. Bezüglich der weiteren Ableitungen, speziell in der Durchführung (T. 304b–362), sei noch darauf verwiesen, dass hier neben Sechzehntel-Läufen (vgl. T. 231/5ff.) eine Variation des Motivs aus T. 293 prägend ist.
Die dargestellten Motive leiten sich von gebrochenen Dreiklängen bzw. von Kombinationen aus Terzsprung und Sekundschritt ab. Hinzu kommen längere Tonleiterausschnitte sowie Vorhalte, die sich besonders auf den letzten Ton eines Motivs konzentrieren. Die motivischen Bausteine lassen sich in allen Sätzen der Fantasie nachweisen und offenbaren deren dichte Arbeit.
Form
Bezüge zur Sonatensatzform
Inwiefern der erste Satz von Mendelssohns Fantasie op. 28 einer Sonatensatzform nach dem Schema Erstes Thema – Modulation [Überleitung] – Zweites Thema – Koda [Schlussgruppe][55] in der Exposition entspricht und damit den ursprünglichen Titel von »Sonate écossaise« stützt, wird im Folgenden untersucht. Fraglich ist vor allem, wo die Durchführung beginnt, ob ein Zweites Thema angenommen werden kann und wie die Anlage der Reprise zu erklären ist. Während sich der dritte Satz in der Bestimmung seiner Form weit unproblematischer als Sonatensatzform ausnimmt und die Teile Exposition (mit der genannten typischen Untergliederung), Durchführung und Reprise dort klar bestimmbar sind, weist der erste Satz Elemente auf, deren Einordnung in die Schematik Schwierigkeiten bereitet.[56]
Ullrich Scheideler interpretiert den Kopfsatz der Fantasie als A – B – A‘ – B‘ – A“, wobei es sich bei den A-Teilen um die ›rauschenden‹, mit der Tempovorschrift Con moto agitato versehenen Akkordbrechungen in Zweiunddreißigstel-Noten handelt. Der B-Teil (Andante) umfasst die Takte 9 bis 51, denn in T. 52 kehrt eine abgewandelte Form des Con moto agitato als A‘ wieder, deren Zweiunddreißigstel sich bis zum Wiedererscheinen der Periode (B‘) in T. 84 (ab T. 85 Tempovorschrift Andante) erstrecken. Der Bogen zum Beginn wird mit dem Teil A“ (ab T. 115) gespannt, der die Arpeggien vom Anfang aufnimmt und wiederum Con moto agitato gespielt werden soll.[57] Die Gliederung scheint hier vorrangig an Tempoaspekten orientiert zu sein. Diese Bogenform wird gleichzeitig durch eine Sonatensatzform überlagert, deren Teile Scheideler wie folgt bestimmt: Exposition (T. 1–43), Durchführung (T. 43–84) sowie Reprise (ab T. 84).[58]
Dieser Erklärung sei eine in Teilen abweichende Interpretation entgegengestellt. Der Frage nach der Rolle der anfänglichen Zweiunddreißigstel-Arpeggien lässt sich über die Betrachtung der Lieder ohne Worte nachgehen. Zwar ist die Annahme einer konkreten Auswirkung der Lieder ohne Worte auf die Fantasie und auch umgekehrt spekulativ,[59] doch erscheinen in op. 19,4, op. 30,3 und op. 38,4 Akkordbrechungen in kleinen Notenwerten, die das sonst homophone und choralartige musikalische Geschehen rahmen.[60] Diese Kombination von Arpeggien und ›Choralsatz‹ findet sich in der Fantasie in T. 1–24; der ›Choralsatz‹ löst sich danach sukzessive auf. Die Parallelen der genannten Lieder ohne Worte zur Fantasie gehen aber noch weiter: Opus 19,4 weist ab T. 13 einen gleichmäßigen Achtelpuls in der linken Hand auf, wie er in der Fantasie ab T. 25 zu finden ist, und Opus 30,3 zeigt eine melodische wie auch rhythmische Ähnlichkeit ab T. 3/3 zu T. 9f. der Fantasie. Die von Scheideler in der Fantasie mit A und A“ bezeichneten, eröffnenden bzw. schließenden Abschnitte liegen eigentlich außerhalb des dazwischenliegenden Teils, jedoch erscheinen die Zweiungddreißigstel-Arpeggien auch innerhalb der umrahmten Form. Sie treten in T. 34f. auf, wo, wie zu zeigen sein wird, Platz für ein Zweites Thema wäre, und prägen außerdem den musikalischen Ablauf der Takte 52 bis 59. Dennoch unterscheiden sich diese beiden Einschübe von den rahmenden Arpeggien: In T. 34f. ist die Dominante zur parallelen Durtonart (E-Dur –> A-Dur) durch die Figuration und zusätzlich durch das plötzliche Pianissimo herausgehoben. Die Takte 52 bis 59 erstrecken sich nicht über einen Orgelpunkt wie T. 1‒8 bzw. T. 115ff., sondern über ein absteigendes Tonleitersegment (ohne e), das von a und einer Wandlung von A-Dur zu a-Moll in T. 51 ausgeht. Der Ton fis in T. 52 ist zwischendominantisch zum Sextakkord von H-Dur in T. 54 harmonisiert, ebenso wie die Harmonik über gis zwischendominantisch auf den folgenden Sextakkord von cis-Moll bezogen ist.
Abb. 5: 1) Ausschnitte aus dem Durchführungsteil
(erster Satz, im Original alle Noten groß gedruckt)
2) Schematische Darstellung
* = Vorhalt
Dass der Durchführungsteil seine Oberflächengestaltung von der einleitenden und entsprechend von den direkt vorausgehenden Akkordbrechungen in Zweiungddreißigsteln erhält, ist offensichtlich. Allerdings zeigen sich auch motivische Bezüge der Takte 60ff. (Abb. 5, 1a bzw. 2a) zu Abb. 4, 1c bzw. 2c im Schluss- sowie Abb. 3, 2a bzw. 2b im Mittelsatz. Diese wären im Kopfsatz wegen des oberen Vorhalts vermutlich von Abb. 2, 1c bzw. 2c abzuleiten. Eindeutiger zuzuordnen sind die Takte 71f. (Abb. 5, 1b bzw. 2b), deren Vorhaltsbildung auf T. 11 (Abb. 2, 1b bzw. 2b) verweist. Die Arpeggien erfüllen weniger eine thematische Funktion, sondern dienen vielmehr als Folie, vor der die motivisch-thematische Arbeit stattfindet. Auf dem Höhepunkt der Durchführung (T. 73) erscheinen kurz nach der Hälfte des ersten Satzes die Akkordbrechungen nochmals an sehr exponierter Stelle. Dort findet die steigende, größtenteils chromatische Basslinie, die zusammen mit der figurativ immer wieder veränderten rechten Hand den Wechsel des Basstons der Takte 60‒72 sukzessive beschleunigt (Abb. 6), ihren Zielpunkt im dis. Gleichzeitig setzt in T. 73 mit dem oktavierten Gis eine steigende Basslinie ein, die zunächst zum cis in T. 81 führt und in T. 82 bei fis ansetzt. Sie führt wiederum chromatisch steigend in die Wiederaufnahme der Periode in der rechten Hand und damit in die Reprise, während in der linken Hand die Basslinie noch fortgeführt wird. Quasi im Schnelldurchgang sind in den Takten 73 bis 83 wesentliche Bestandteile des ersten Satzes rekapituliert: Die Arpeggien (T. 73‒76), die Phrase der Periode (T. 77‒80, vgl. Abb. 2, 1a, T. 9) sowie ein Ausschnitt der Gegenphrase der Periode (T. 81f., vgl. Abb. 2, 1b, T. 50).
Abb. 6: Schema der Durchführung des ersten Satzes
(Bässe jeweils mit unterer Oktav,
ohne Rücksicht auf den realen Oberstimmenverlauf)
Die Durchführung setze ich von T. 52 bis T. 84 an, wobei die Ränder jeweils mit Exposition und Reprise überlappen. Die Takte 52 bis 59 dienen, wie schon am Beginn, als Eröffnungssignal, jedoch nun als Vorbereitung der Durchführung. Der Grund dieser Annahme liegt in der Vermeidung kadenzieller Einschnitte und stabiler, grundstelliger Akkorde, die selbst im Eintritt der Reprise mittels eines Sextakkords in T. 85 umgangen werden.
Um eine vergleichende Perspektive zu eröffnen, kann der dritte Satz der Fantasie als Bezugspunkt dienen.[61] Der dritte Satz ist dabei, wie oben dargestellt, weit eindeutiger als Sonatensatzform einzuordnen als der erste Satz; er veranschaulicht, wie Mendelssohn verschiedene Elemente innerhalb der Sonatensatzform behandelt. Wie die Aufstellung der Motive zeigt, weisen sowohl die Periode des ersten Satzes in T. 9f. als auch der Beginn des dritten Satzes eine Dreiklangsmotivik auf.[62] Während im Kopfsatz das Erste Thema als sechzehntaktige Periode verläuft, ist für den Beginn des Schlusssatzes eine Einordnung in die Kategorien Satz bzw. Periode nicht möglich: Die Takte 232 mit Auftakt bis 239 könnten als Vordersatz gedeutet werden, jedoch würden Fortspinnung und Kadenz in T. 247 zunächst trugschlüssig enden, um dann mit neuer Motivik in der rechten Hand (Abb. 4, 1b, T. 248), die von einer abgewandelten Variante des Beginns des dritten Satzes in der linken Hand kontrapunktiert ist, fortgesetzt zu werden. Eine syntaktische Interpretation als Satz wäre damit wenig einleuchtend. In T. 254 mit Auftakt wird der Satzanfang wieder aufgenommen und führt auf einen Ganzschluss in der Ausgangstonart (fis-Moll). Letzteres geschieht im Kopfsatz in T. 24.
Abb. 7: Schematische Darstellung der Harmonik der Überleitungen
im ersten Satz (a) und im dritten Satz (b)
Kreuznotenköpfe = nicht real erklingend.
Umringte Kreuznotenköpfe = nur sehr kurz real erklingend.
Große Notenköpfe = Besonders hier werden Übereinstimmungen deutlich.
Der reale Oberstimmenverlauf wurde nicht berücksichtigt.
Beiden Sätzen gemeinsam ist in der Fortsetzung[63] das durchgehend pulsierende cis, das im weiteren Verlauf dieses Überleitungsabschnitts, der schematisch in Abb. 7 dargestellt ist, zu fis (erster Satz: T. 28; dritter Satz: T. 263) wechselt. Die Takte 258 mit Auftakt bis 261 verbleiben zunächst in fis-Moll, erst die Wiederholung dieser Takte weist nach zwei Takten eine Abweichung (ab T. 263/6) auf, die gleichsam als Ausgangspunkt für den anschließenden Weg in die parallele Durtonart gesehen werden kann. Die Modulation wird dabei über beinahe dieselben Harmonien vollzogen wie in T. 31–34; selbst die Basslinie lässt Ähnlichkeiten erkennen.
Für den dritten Satz lässt sich ein Zweites Thema ab T. 270 feststellen. Dort ist die parallele Durtonart A-Dur jedoch nicht grundstellig und stabil erreicht, sondern die Dominante E-Dur als vergleichsweise labiler Sextakkord.[64] Ein a im Bass wird erst in T. 272 nachgereicht. Dadurch ist A-Dur ebenso nur angedeutet wie im ersten Satz (T. 35/3), wo das a im Bass stufenweise und nicht durch einen Quintfall angesteuert sowie der Fokus durch Figuration und Dehnung über eineinhalb Takte auf den E-Dur-Septakkord in erster Umkehrung von T. 34f. gelegt wird. Das kurze, insgesamt zweitaktige Motiv im dritten Satz (Abb. 4, 1c bzw. 2c) erscheint in den folgenden Takten aufwärts sequenziert und setzt sich, relativ frei gestaltet sowie nach cis-Moll modulierend, fort. Diese Modulation findet sich im ersten Satz an entsprechender Stelle nicht,[65] die Sequenzierung aber sehr wohl, wenn auch in anderer Gestalt zunächst abwärts und anschließend aufwärts (Abb. 2, 1c und 2c). Zudem sei auf die Ähnlichkeit der Motive mit Terz-Sekund-Strukturen und dem oberen Vorhalt hingewiesen. Damit liegt die Interpretation der Takte 35/3 bis 43 als Bereich des Zweiten Themas sehr nahe.
Diese Annahme wird außerdem durch die Interpretation der Takte 43 bis 51 bzw. 290 bis 304 als Schlussgruppen bestätigt, die durch den relativen harmonischen Stillstand und die Konzentration auf die Bestätigung der Tonart geprägt sind. Im ersten Satz pendelt die Harmonik zwischen A- und E-Dur; auf das Motiv (Abb. 2, 1b bzw. 2b, T. 43) folgt eine variierte Wiederholung mit Kadenz (T. 41–47).[66] Dieses Schema tritt direkt anschließend nochmals auf, wird jedoch nach der variierten Motivwiederholung durch eine Abspaltung (T. 49ff.) ersetzt, die in die Durchführung leitet. Im dritten Satz ist die Schlussgruppe trugschlüssig eingeführt, indem in T. 290 die Tonart A-Dur statt cis-Moll erscheint. Über dem Orgelpunkt a wird durch das Pendel einer E7– und einer A-Dur-Harmonie an diesem Trugschluss festgehalten und nach zweimaligem Anlauf beim dritten Mal eine Kadenzierung eingeleitet, der wiederum trugschlüssig im vorhergehenden Pendel mündet. Bei dieser Wiederholung setzt sich der Kadenzablauf jedoch weiter wiederholend bzw. variativ fort und endet in einer Oktavpassage mit dem Zielton cis.
Die Reprise des ersten Satzes ist im Vergleich zur Exposition verkürzt und leicht abgeändert: Die Gegenphrase in T. 93/2ff. erscheint sequenziert und mündet in T. 100 in die Oberstimmengestaltung von T. 41ff., allerdings nach Fis-Dur anstelle von A-Dur transponiert. Diese Fis-Dur-Kadenz in T. 102 ist die erste schlusskräftige Kadenz seit T. 47. Ihr folgt in Fis-Dur die zur Exposition (T. 43–48) parallele Stelle, um in T. 108, bis zu dem der Grundton fis vorenthalten bleibt, den in T. 92ff. suspendierten Nachsatz beinahe wörtlich von T. 17 bis T. 24 zu übernehmen. Dies bereitet gleichsam den Bogen vor, der den ersten Satz umspannt. Werden die hier abgewandelt wieder aufgenommenen Arpeggien des Con moto agitato – wie bei Ullrich Scheideler angedeutet – als ein eigenständiges Thema interpretiert, so wären in der Reprise die Themen vertauscht (erst B‘, dann A“).[67] Das ist zwar kein ganz ungewöhnliches Vorgehen, doch ist auch denkbar, dass die Wiederholung des Bereichs des Zweiten Themas aufgrund seiner relativen Undefiniertheit in der Reprise vermieden wird. So bliebe die Interpretation der Arpeggien als Rahmen unangetastet.
Die Analyse der Expositionen des ersten und des dritten Satzes hat gezeigt, dass dort großflächig Parallelen feststellbar sind, die eine Interpretation des Kopfsatzes als Sonatensatzform mit dem Bereich eines Zweiten Themas zulassen. Außerdem bestätigt sich die Vermutung, dass die Arpeggien des Anfangs und Schlusses im ersten Satz innerhalb der sie umschließenden Form einen neuen Abschnitt ankündigen bzw. damit gleichzeitig den vorhergehenden abschließen. Die charakteristischen Zweiunddreißigstel erscheinen als Eröffnung des Satzes – und damit noch vor dem Ersten Thema –, danach vor dem Bereich des Zweiten Themas, vor der Durchführung sowie auf dem Höhepunkt des Satzes, der über die diminuierte Rekapitulation des Ersten Themas und die Motivabspaltung aus der Schlussgruppe in die Reprise führt. Schließlich läuft der Satz in den Arpeggien – nun in Fis-Dur – aus, nicht ohne zuletzt vier Takte der Periode (T. 130–133) erklingen zu lassen.
Weitere Besonderheiten
Über die Verschleierung der Sonatensatzform hinaus führen auch weitere Aspekte – darunter beispielsweise die Taktgruppengestaltung – zu einer Anlage, die regelmäßige Strukturen verunklart. Die Besonderheiten des ersten Satzes mit seinen Verschränkungen von Exposition, Durchführung und Reprise wurde ausführlich dargestellt, weshalb an dieser Stelle noch kurz der Mittelsatz sowie der ebenso relativ ausführlich behandelte Schlusssatz betrachtet werden.
Insgesamt stellt der zweite Satz eine A–B–A‘-Form dar, wobei sich die A-Teile nochmals in eine für Menuette typische a–b–a‘-Form unterteilen lassen.[68] Im Gegensatz zu den A-Teilen ist der B-Teil sehr regelmäßig gestaltet, weshalb nicht weiter auf ihn eingegangen wird. Die Takte 135/2 (Alla breve) bis 142 (a-Teil) wurden bereits untersucht (siehe Abb. 3, 1a bzw. 1b). Das auf die Dominanttonart modulierende, siebentaktige und satzartige Gebilde weist auch bei seiner Wiederkehr ab T. 145/2 Eigenheiten auf, welche die nun reguläre Achttaktigkeit weiterhin unterwandern. Ein regulärer Satz wird im a‘-Teil durch die Abspaltung des Motivkopfs in der Phrasenwiederholung verhindert (ab T. 148/2), allerdings bleibt die Gliederung von 2 + 2 + 4 Takten erhalten. Besonders erwähnenswert sind die Takte 145f., da hier die vorhergehenden Takte des kontrapunktischen b-Teils mit dem a‘-Teil überlappen (Abb. 8). Diese Technik findet allerdings im A‘-Teil an entsprechender Stelle (T. 211f.) keine Anwendung. Stattdessen wird dort ab T. 219/2 das Tetrachord a‘ – gis‘ – fis‘ – e‘ separiert, transponiert und nach der Kadenz in T. 227 nochmals durch Viertelnoten, die durch regelmäßige Pausen unterbrochen sind, variiert. Während Mendelssohn im B-Teil des zweiten Satzes also vorrangig mittels Kontrapunkt und Motiventwicklung bzw. Fortspinnung Abwechslung erreicht, tritt in den A-Teilen ein stetiges Spiel mit der Syntax bzw. mit Taktgruppen hinzu.
Abb. 8: b-Teil des zweiten Satzes mit Überlappen des a‘-Teils.
Die Kleinbuchstaben a und b bzw. x und y beziehen sich nur auf die Motivik.
An der Symmetrieachse zeigt sich die beinahe punktsymmetrische Spiegelung.
Der dritte Satz bereitet zwar keine Schwierigkeiten, die sonatensatztypischen Formteile zu lokalisieren, doch treten hier andere Besonderheiten auf. Neben dem ungewöhnlichen, trugschlüssigen Eintritt der Schlussgruppe (T. 290) ist der Anfang der Reprise (T. 362) wie im ersten Satz (T. 84 bzw. 85) eigentümlich verschleiert und wird in beiden Fällen durch eine ansteigende Basslinie[69] vorbereitet. Über dem pulsierenden cis als Orgelpunkt im Bass beginnt die Reprise im Schlusssatz als Quartsextakkord von fis-Moll, der in T. 369 nur unzureichend aufgelöst wird: Dort erscheint zwar ein fis im Bass, aber die Töne e und g bewirken Spannungen, die sich im Nachhinein als Vorhalte zum Fis7-Akkord in T. 370 herausstellen. Auch hier erfolgt in T. 371 nur eine instabile Auflösung in den Sextakkord von h-Moll. Eine schlusskräftige Kadenz steht erst in T. 411.[70]
Fazit
Sonaten oder Phantasien (was liegt am Namen!)[71]
Robert Schumanns Diktum lässt sich auf Felix Mendelssohn Bartholdys Fantasie op. 28 übertragen. Formal steht der Kopfsatz der Fantasie einer Sonatensatzform nahe, die jedoch zugleich von Elementen eines Liedes ohne Worte durchdrungen ist. Besonders der erste Satz trägt Züge, die auch dem Genre der Fantasie zugeordnet werden können. Dabei sind vor allem die Arpeggien wesentlich, wie sie auch in Mendelssohns opp. 19,4, 30,3 und 38,4 einen »Chorsatz ohne Worte«[72] einrahmen. Ihr improvisatorischer Charakter, der am Beginn metrisch kaum greifbar ist, trägt damit der Beschreibung der »Freyen Phantasie« nach Carl Philipp Emanuel Bach Rechnung, der für dieses Genre die fehlende Takteinteilung postulierte. Darüber hinaus erfüllen die Arpeggien eine formale Funktion, da sie den Anfang eines neuen Formteils bzw. das Ende des vorhergehenden signalisieren, jedoch kommt gerade durch sie gleichzeitig der von Ferdinand Gotthelf Hand für die Fantasie geforderte ›Anschein der Zufälligkeit‹ zustande.
Auch in den anderen Sätzen lassen sich ähnlich wie im Kopfsatz mit seinem relativ undefinierten Bereich des Zweiten Themas sowie dem ›Ineinanderschieben‹ von Durchführung und Reprise Verkürzungen und Überlappungen feststellen, die den Eindruck einer formalen Unschärfe fördern. Hinzu tritt oftmals eine durch Sequenzen hervorgerufene harmonische Instabilität und Unbestimmtheit. Dennoch schafft Mendelssohn durch ein satzübergreifendes Netz von motivischen Bezügen Zusammenhalt.
All diese Parameter und auch die Kürze des Werks[73] mögen Mendelssohn bewogen haben, die Umbenennung des Opus 28 von »Sonate« zu »Fantasie« vorzunehmen. Was sich formal in den gezeigten Verschleierungstechniken von Ineinanderschieben und Verwischen klarer Grenzen andeutet, vollzieht sich letztlich auch auf der Ebene der Gattung, wenn Mendelssohn in seiner Komposition Elemente von Sonate, Fantasie und Lied ohne Worte verbindet.
Anmerkungen
[1] Die hohen Opuszahlen resultieren aus der posthumen Herausgabe der Werke durch Julius Rietz; vgl. Dietrich Kämper, Die Klaviersonate nach Beethoven. Von Schubert bis Skrjabin, Darmstadt 1987, S. 65f. sowie S. 69.
[2] Vgl. ebd., S. 70f.
[3] Auch in Mendelssohns ›Schottischer Sinfonie‹ op. 56 sollen die Sätze ohne größere Unterbrechung gespielt werden.
[4] Vgl. Ullrich Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise) fis-Moll für Klavier op. 28, in: Mendelssohn-Interpretationen, Laaber, im Druck.
[5] Felix Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, in: Klavierwerke, Bd. 1, hrsg. von Rudolf Elvers, Ernst Herttrich und Ullrich Scheideler, München 2009, S. 163–185.
[6] Arnfried Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 3: Von 1830 bis zur Gegenwart, Laaber 2004 (Handbuch der musikalischen Gattungen 7,3), S. 54.
[7] Dagmar Teepe, 18. Jahrhundert / 19. und 20. Jahrhundert, in: Fantasie (Sp. 316–345), in: MGG2S, Bd. 3, Sp. 339.
[8] Kämper, Klaviersonate, S. 70f.
[9] Gudrun Fydrich, Fantasien für Klavier nach 1800, Diss. Frankfurt am Main 1990.
[10] Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise), im Druck.
[11] Vgl. Arnfried Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2: Von 1750 bis 1830, Laaber 2003 (Handbuch der musikalischen Gattungen 7,2), S. 70.
[12] Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, hrsg. von Wolfgang Horn, Kassel u. a. ²2003, Teil II, S. 325.
[13] Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2, S. 80.
[14] Zum Zusammenhang von Fantasie und Capriccio vgl. Daniel Gottlob Türk, Klavierschule, Leipzig u. a. 1789, S. 396: »Das Kapriccio […] ist ebenfalls eine Art Fantasie ohne festgesetzten Plan u. dgl.« Damit dürfte die Freie Fantasie gemeint sein, denn Türk stellt fest: »Gebunden heißen diejenigen Fantasien, in welchen eine Taktart zum Grunde liegt, wobey man sich mehr an die Gesetze der Modulation bindet, worin mehr Einheit beobachtet wird u.s.w.« (ebd.).
[15] Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2, S. 80.
[16] Die Beschleunigung des Tempos vom ersten zum dritten Satz in Beethovens op. 27,2 lässt sich in Mendelssohns op. 28 wiederfinden. Dass Beethovens Sonate aber als Vorbild für Mendelssohns Fantasie gedient hätte, wäre nicht nachzuweisen; vgl. Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise).
[17] Zu Schubert vgl. auch Fydrich, Fantasien für Klavier, S. 174 und vor allem S. 268.
[18] Ferdinand Gotthelf Hand, Aesthetik der Tonkunst, 2 Bde., Leipzig 1837 (Bd. 1) und Jena 1841 (Bd. 2).
[19] Hand, Aesthetik, Bd. 2, S. 377f.
[20] Johann Friedrich Anton Fleischmann, Wie muss ein Tonstück beschaffen seyn, um gut genannt werden zu können?, in: AmZ 1 (1798/99), Nr. 14, Sp. 209–213, und Nr. 15, Sp. 225–228.
[21] Vgl. Alfred Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform« im musiktheoretischen Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1968 (Neue musikgeschichtliche Forschungen 1), S. 218. Die üblichen Bezeichnungen »Exposition«, »Durchführung« und »Reprise« für die drei Teile des Kopfsatzes einer Sonate hat im deutschsprachigen Gebiet Alfred Richter (Lehre von der musikalischen Form, Leipzig 1904) zusammengeführt und Hugo Leichtentritt (Musikalische Formenlehre, ebd. 1911) im heutigen Sinne geprägt. Vgl. Markus Bandur, Sonatenform, in: MGG2S, Bd. 8, Sp. 1609.
[22] Vgl. Heinrich Birnbach, Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke aller Art und deren Bearbeitung, in: BAmZ 4 (1827), Nr. 34, S. 269–272, hier S. 270–272, sowie S. 277–281, hier S. 277f. Vgl. Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform«, S. 213–221. Der Einfluss von Birnbachs Ideen auf Adolf Bernhard Marx’ Lehre von der musikalischen Komposition (1838) war enorm, wenn auch Birnbach für das Erste und Zweite Thema noch forderte, dass sie »in karakteristischer Hinsicht übereinstimmen«: Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke, S. 277; vgl. auch Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform«, S. 223.
[23] Ebd., S. 379f.; siehe auch Heinrich Birnbach, Ueber die Form des ersten Tonstücks einer Sonate, Symphonie, eines Quartetts, Quintetts u. s. w. in der weichen Tonart, in: BAmZ 5 (1828), Nr. 14, S. 105.
[24] Hand, Aesthetik, Bd. 2, S. 298.
[25] Vgl. ebd., S. 300.
[26] Vgl. ebd., S. 299.
[27] Vgl. Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 3, S. 34f.
[28] Robert Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Bd. 3, Leipzig 1854, S. 80. Schumann selbst überlegte zeitweise, seine Fantasie op. 17 »Sonate für Beethoven« zu nennen. Vgl. Nicholas Marston, Schumann: Fantasie, Op. 17, Cambridge 1992 (Cambridge Music Handbooks), S. 23.
[29] Ebd., S. 79. Schumanns Artikel Sonaten für das Clavier, aus dem auch voriges Zitat stammt, erschien am 26. April 1839 in der NZfM 10 (1839), Nr. 34, S. 134f.
[30] Schumann, Gesammelte Schriften, Bd. 4, S. 19.
[31] Zur Problematik, das Lyrische Klavierstück bzw. das Lied ohne Worte als eigene Gattung zu bezeichnen, siehe Edler, Gattungen der Musik: Teil 3, S. 161.
[32] Vgl. Edler, Gattungen der Musik: Teil 2, S. 257.
[33] Brief vom 15. Juni 1832, zitiert nach: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe, Bd. 2 (Juli 1830‒Juli 1832), hrsg. von Anja Morgenstern und Uta Wald, Kassel u. a. 2009, S. 559.
[34] Vgl. Christa Jost, Mendelssohns Lieder ohne Worte, Tutzing 1988 (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft 14), S. 11 und S. 20.
[35] Ebd., S. 72.
[36] Ebd., S. 81.
[37] Ebd., S. 74.
[38] Zum Beispiel in einem Brief an Abraham Mendelssohn Bartholdy vom 25./26. Mai 1830: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe, Bd. 1 (1816‒Juni 1830), hrsg. von Juliette Appold und Regina Back, Kassel u. a. 2008, S. 532.
[39] Vgl. Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise). Scheideler weist darauf hin, dass die Überschrift »Sonate écossaise« eventuell nachträglich hinzugefügt wurde. Vgl. außerdem: Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, Kritischer Bericht von Ullrich Scheideler, S. 244.
[40] Vgl. Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, Vorwort von Ullrich Scheideler, S. IX.
[41] Kämper, Die Klaviersonate nach Beethoven, S. 64.
[42] Vgl. Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, Kritischer Bericht von Ullrich Scheideler, S. 244, sowie Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise).
[43] Brief vom 28./29. Dezember 1833: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe, Bd. 3 (August 1832‒Juli 1834), hrsg. von Uta Wald, Kassel u. a. 2010, S. 317.
[44] Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, Vorwort von Ullrich Scheideler, S. IX.
[45] Mendelssohn Bartholdy, Briefe, Bd. 3, S. 311.
[46] »Die Musik will gar nicht rutschen ohne Dich«. Briefwechsel 1821 bis 1846 zwischen Fanny und Felix Mendelssohn, hrsg. von Eva Weissweiler, Berlin 1997, S. 164.
[47] Vgl. Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise): »Die Form […] lässt zumindest im Großen eine Nähe zur Sonate erkennen, ist das Werk doch in drei Sätze untergliedert, die zwar attacca aneinander anschließen, aber weder durch Überleitungen noch durch gemeinsame Themen oder Motive miteinander verbunden sind.«
[48] Dagmar Teepe, im Artikel Fantasie in MGG2S, Sp. 339.
[49] Kämper, Die Klaviersonate nach Beethoven, S. 71.
[50] Arnfried Edler, Gattungen der Musik: Teil 3, S. 54.
[51] Innerhalb der harmonischen Quintfallsequenz ist nur jede zweite Station grundstellig.
[52] Damit ist die Umkehrung des üblicherweise fallenden Parallelismus gemeint. In A-Dur ergäbe das fallende Modell die Harmoniefolge: A – E – fis – cis. In T. 37–39 verkehrt sich dies zu cis – fis – E – A. Der »steigende Parallelismus« bietet zudem eine einfache und gängige Möglichkeit, von einer Molltonart in die parallele Durtonart zu modulieren. Entsprechend wäre sie bereits in T. 32f. zu erwarten gewesen, wo er aber zugunsten eines ansteigen Fauxbourdon in der linken und einer entgegenlaufenden Linie mit Vorhalten in der rechten Hand nicht erscheint.
[53] Zur Form des zweiten Satzes siehe Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise).
[54] In Abb. 4, 2b ist dies mittels Kreuznotenköpfen dargestellt.
[55] Vgl. Birnbach, Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke, S. 270ff. und S. 277f.
[56] Ullrich Scheideler (Fantasie (Sonate écossaise)) gliedert den dritten Satz in Exposition: T. 232‒304; Durchführung: T. 304‒363; Reprise: T. 363‒430; Koda: T. 431‒468.
[57] Zu dieser formalen Interpretation vgl. ebd.
[58] Vgl. ebd.
[59] In Bezug auf Schumann und die Verbindung von Einzelsätzen schreibt Gudrun Fydrich: »Da Schumann sich die Gestaltung größerer Formen über das kurze Klavier- und Charakterstück erarbeitet, finden wir während seiner Klavierdekade nur in den Intermezzi op. 4 ›Attacca‹-Vorschriften«: Fantasien für Klavier, S. 176f. Es ist möglich, dass beim Auffinden individueller Formlösungen kleiner dimensionierte Formate auch bei Mendelssohn für größer angelegte Formen Vorbild waren.
[60] Eine Dreiklangsbrechung eröffnet auch Mendelssohns Fantasie über das irländische Lied »The Last Rose of Summer« op. 15. Zudem findet sich dort ebenfalls das Thema in akkordischer Begleitung und in der rechten Hand z. B. in T. 29ff. eine Motivik, die der von Abb. 2, 1b, T. 11 nahe steht.
[61] In den Durchführungen sind Ähnlichkeiten weit weniger ausgeprägt, wenn auch beispielsweise dem Bereich um Gis-Dur und damit der Doppeldominante in beiden Sätzen breiter Raum eingeräumt wird (erster Satz: T. 73‒76; dritter Satz: T. 339‒345). Zudem führt die Dominante Cis-Dur zurück in die Ausgangstonart fis-Moll. Auch dies ist einerseits eine Gemeinsamkeit zwischen den Durchführungen des ersten und dritten Satzes, andererseits entspricht dies der Harmoniefolge, wie sie in den Takten 1 bis 9 (vgl. Abb. 1b) erscheint.
[62] Gleichfalls besteht die »rauschende« Einleitung von Abb. 1, wie erwähnt, aus Akkordbrechungen. Auch sie könnte mit den Sechzehnteln, die allerdings den gesamten dritten Satz prägen, in Verbindung gebracht werden.
[63] Auf eine Ähnlichkeit des motivischen Materials sei nochmals verwiesen: Vgl. Abb. 2, 2b, T. 25 und Abb. 4, 2b.
[64] Dies entspricht einem Halbschluss in der Nebentonart; vgl. auch Birnbach, Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke, S. 271.
[65] Cis-Dur wird in T. 37 lediglich peripher berührt.
[66] Birnbach fordert für den »Koda«-Teil (bei mir: »Schlussgruppe«), »das Gehör in Ruhe zu bringen« und Modulationen zu vermeiden: Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke, S. 278. Mendelssohn setzt dies durch die Pendelharmonik um.
[67] Vgl. Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise), im Druck.
[68] Joseph Riepel schreibt, »ein Menuet« sei »der Ausführung nach, nichts anders […] als ein Concert, eine Arie oder Simpfonie«: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst, Regensburg und Wien 1752, S. 1. Formal entsprechen die A-Teile des zweiten Satzes mit ihrer Gliederung a–b–a‘ einem Menuett. Ist nun a die Exposition, b die Durchführung und a‘ die Reprise, so entsteht, wie Abb. 8 zeigt, eine Verknüpfung von b und a‘, also von Durchführung und Reprise. Genau dies findet sich an entsprechenden Stellen im ersten und dritten Satz.
[69] Im ersten Satz ab T. 83, im dritten Satz ab T. 357.
[70] An dieser Stelle ist in der Exposition des dritten Satzes der trugschlüssige Einsatz der Schlussgruppe zu finden.
[71] Schumann, Gesammelte Schriften, Bd. 3, S. 80.
[72] Christa Jost gebraucht für die genannten Stücke den Begriff »Chorlied ohne Worte«: Mendelssohns Lieder ohne Worte, S. 81.
[73] Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise), im Druck.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Edition
Mendelssohn Bartholdy, Felix: Phantasie op. 28, in: Klavierwerke, Bd. 1, hrsg. von Rudolf Elvers, Ernst Herttrich und Ullrich Scheideler, München 2009, S. 163–185.
Quellen
Bach, Carl Philipp Emanuel: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Faksimile-Reprint der Ausgaben Teil I, Berlin 1753 und Teil II, Berlin 1762, hrsg. von Wolfgang Horn, Kassel u. a. ²2003.
Birnbach, Heinrich: Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke aller Art und deren Bearbeitung, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 4 (1827), Nr. 34, S. 269–272, und Nr. 35, S. 277–281.
Ders.: Ueber die Form des ersten Tonstücks einer Sonate, Symphonie, eines Quartetts, Quintetts u. s. w. in der weichen Tonart, in: dass. 5 (1828), Nr. 14, S. 105–108.
Fleischmann, Johann Friedrich Anton: Wie muss ein Tonstück beschaffen seyn, um gut genannt werden zu können?, in: AmZ 1 (1798/99), Nr. 14, Sp. 209–213, und Nr. 15, Sp. 225–228.
Hand, Ferdinand Gotthelf: Aesthetik der Tonkunst, 2 Bde., Leipzig 1837 (Bd. 1) und Jena 1841 (Bd. 2).
Mendelssohn Bartholdy, Felix: Sämtliche Briefe, Bd. 1 (1816‒Juni 1830), hrsg. von Juliette Appold und Regina Back, Kassel u. a. 2008.
Ders., Sämtliche Briefe, Bd. 2 (Juli 1830‒Juli 1832), hrsg. von Anja Morgenstern und Uta Wald, ebd. 2009.
Ders.: Sämtliche Briefe, Bd. 3 (August 1832‒Juli 1834), hrsg. von Uta Wald, ebd. 2010.
Ders.: »Die Musik will gar nicht rutschen ohne Dich«. Briefwechsel 1821 bis 1846 zwischen Fanny und Felix Mendelssohn, hrsg. von Eva Weissweiler, Berlin 1997.
Riepel, Joseph: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst, Bd. 1, Regensburg und Wien 1752.
Schumann, Robert: Sonaten für das Clavier, in: NZfM Bd. 10 (1839), Nr. 34, S. 134f.
Ders.: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, 4 Bde., Leipzig 1854.
Türk, Daniel Gottlob: Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende, Leipzig u. a. 1789.
Literatur
Bandur, Markus: Sonatenform, in: MGG2S, Bd. 8, Sp. 1607–1615.
Edler, Arnfried: Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2: Von 1750 bis 1830, Laaber 2003 (Handbuch der musikalischen Gattungen 7,2).
Ders.: Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 3: Von 1830 bis zur Gegenwart, Laaber 2004 (dass. 7,3).
Fydrich, Gudrun: Fantasien für Klavier nach 1800, Diss. Frankfurt am Main 1990.
Jost, Christa: Mendelssohns Lieder ohne Worte, Tutzing 1988 (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft 14).
Kämper, Dietrich: Die Klaviersonate nach Beethoven. Von Schubert bis Skrjabin, Darmstadt 1987.
Marston, Nicholas: Schumann: Fantasie, Op. 17, Cambridge 1992 (Cambridge Music Handbooks).
Ritzel, Alfred: Die Entwicklung der »Sonatenform« im musiktheoretischen Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1968 (Neue musikgeschichtliche Forschungen 1).
Scheideler, Ullrich: Fantasie (Sonate écossaise) fis-Moll für Klavier op. 28, in: Mendelssohn-Interpretationen, Laaber, im Druck.
Teepe, Dagmar: 18. Jahrhundert und 19. und 20. Jahrhundert, im Artikel Fantasie (Sp. 316–345), in: MGG2S, Bd. 3, hier Sp. 336–341.
Elisabeth Sasso-Fruth: Das Melodramma in Italien. Felice Romanis Bearbeitungen des »Romeo und Julia«-Stoffes
Das Melodramma in Italien
Felice Romanis Bearbeitungen des »Romeo und Julia«-Stoffes
Elisabeth Sasso-Fruth (HMT Leipzig)
(Übertragungen sämtlicher italienischer und französischer Texte ins Deutsche: Elisabeth Sasso-Fruth)
Il dramma per musica deve
far piangere, inorridire, morire cantando.
(Vincenzo Bellini)
Das auf das Griechische zurückgehende Wort »Melodram« hat, zum Teil mit mehreren Bedeutungen, in viele europäische Sprachen Eingang gefunden. In einer Bedeutung bezeichnet es in zahlreichen Sprachen, etwa im Deutschen und Französischen, eine Gattung, in der Begleitmusik das gesprochene Wort untermalt. Das Italienische hat hierfür den Begriff melologo. Das Wort melodramma dagegen wird im Italienischen, angefangen bei Jacopo Peri und Claudio Monteverdi, durch die Jahrhunderte hindurch synonym zum Begriff für die Oper, opera (in musica) bzw. opera lirica, in ihren unterschiedlichen Ausprägungen verwendet.
I. Felice Romani
Im deutschen Sprachraum ist der Name Felice Romani (1788–1865) heutzutage nahezu in Vergessenheit geraten. Höchstens in Spezialistenkreisen ist er noch geläufig. Dabei war der gebürtige Genuese der meistgefragte Librettist seiner Zeit und gilt als der »Begründer des romantischen melodramma«.[1] Er arbeitete mit den namhaftesten Komponisten des frühen 19. Jahrhunderts zusammen: mit Rossini, Donizetti, Bellini, Mercadante und vielen mehr.
Seine Schaffensperiode als Librettist umfasste zwar nur gut zwanzig Jahre (von 1813 bis 1834), doch war sie mit ca. 90 Libretti sehr intensiv. Der Mittelpunkt seiner Arbeit als Librettist lag in Mailand (am Teatro alla Scala), wo Felice Romani seit 1814 wohnte. Aber auch in Venedig, Parma etc. gelangten seine Werke zur Aufführung.
Sein Ruhm, aber nicht zuletzt auch das Angebot aus Wien, als kaiserlicher Hofdichter in die Fußstapfen Metastasios zu treten, trugen ihm den Beinamen Metastasio redivivo (der wiedererstandene Metastasio) ein.[2] Felice Romani schlug die Einladung allerdings aus, schließlich wollte er nicht die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen. Doch auch hinsichtlich ihrer Libretti (Stoffwahl, sprachliche Bearbeitung etc.) weisen Metastasio und Romani große Unterschiede auf.
II. Felice Romani und Vincenzo Bellini
Besonders eng gestaltete sich die Beziehung zwischen Felice Romani und Vincenzo Bellini, was sich nicht zuletzt in der Intensität ihrer Zusammenarbeit niederschlug. Ihre Begegnung fällt in das Jahr 1827 in Mailand: Romani galt damals schon als der profilierteste Textdichter Italiens, der aus Sizilien stammende und um 13 Jahre jüngere Bellini dagegen stand noch am Anfang seines Schaffens. Von den acht Opern, die Bellini von da an noch komponieren sollte, stammt bei sieben das Libretto aus der Feder Romanis. Das erste Ergebnis ihrer Zusammenarbeit war Il Pirata, die 1827 an der Scala uraufgeführt wurde.
Wie sehr Bellini die Arbeit Romanis schätzte, geht beispielsweise aus einem Brief an seinen Freund Florimo hervor. Während der Arbeit an La Straniera war Romani erkrankt, so dass Gaetano Rossi als Librettist in Erwägung gezogen wurde. Bellini sah dadurch die Qualität der Oper gefährdet:
[…] [Rossi] mai mai potrebb’essere un verseggiatore come Romani, e specialmente per me che sono molto attaccato alle buone parole; ché vedi dal Pirata come i versi e non le situazioni mi hanno ispirato del genio […] e quindi per me Romani è necessario.
[…] [Rossi] könnte niemals ein so guter Versdichter sein wie Romani, vor allem für mich nicht, der ich doch solchen Wert auf eine gute Sprache lege; Du kannst schon am Pirata sehen, wie mich die Verse, und nicht die Situationen, inspiriert haben […] und so ist für mich Romani unabdingbar.[3]
Über der Arbeit an ihrer letzten gemeinsamen Oper, Beatrice di Tenda, kam es wegen der andauernden unpünktlichen Zuarbeit durch den chronisch überlasteten Romani zum Zerwürfnis mit Bellini. Der Streit war in Mailänder und venezianischen Zeitungen öffentlich ausgetragen worden. Obwohl sich Romani und Bellini nach der wenig erfolgreichen Uraufführung der Oper am 16. März 1833 in Venedig brieflich wieder aussöhnten,[4] kam es zu keiner weiteren Zusammenarbeit mehr. Das Libretto für das Pariser Auftragswerk I Puritani – der letzten Oper Bellinis – verfasste Carlo Pepoli (Uraufführung: 24. Januar 1835, Théâtre Italien, Paris). Im September 1835 starb Bellini in Puteaux bei Paris.
Für Romani war der Streit mit Bellini der Anfang vom Ende seiner Karriere als Librettist. 1834 ging er nach Turin, wo er fortan als Journalist arbeitete (zunächst als Direktor der Gazzetta Ufficiale Piemontese); ab 1836 stellte er seine Arbeit als Librettist vollständig ein.
III. Felice Romanis zweifache Beschäftigung
mit dem »Romeo und Julia«-Stoff
Nach Il pirata (Uraufführung: 27. Oktober 1827, Teatro alla Scala, Mailand), La straniera (Uraufführung: 14. Februar 1829, Teatro alla Scala, Mailand), und Zaira (Uraufführung: 16. Mai 1829, anlässlich der Einweihung des Teatro Ducale, Parma), ist I Capuleti e i Montecchi (Uraufführung: 11. März 1830, Teatro La Fenice, Venedig) die vierte Oper, die auf die Zusammenarbeit Vincenzo Bellinis mit Felice Romani zurückgeht. Später folgten La Sonnambula (Uraufführung: 6. März 1831, Teatro Carcano, Mailand), Norma (Uraufführung: 26. Dezember 1831, Teatro alla Scala, Mailand) und Beatrice di Tenda (Uraufführung: 16. März 1833, Teatro La Fenice, Venedig).[5]
Im Januar 1830 erhielt Bellini vom Teatro La Fenice di Venezia den Auftrag, eine Oper zu komponieren, deren Datum für die Uraufführung in der laufenden Karnevalssaison bereits auf den 11. März 1830 festgesetzt war.[6] Bellini und Romani standen also unter enorm hohen Zeitdruck. So ist es verständlich, dass sie beide für die neue »Romeo und Julia«-Oper, die Bellini dem Impresario der Fenice, Alessandro Lanari, vorgeschlagen hatte, auf schon erarbeitetes Material zurückgreifen: Bellini verwendete teilweise seine Melodien aus Zaira neu, Romani dagegen zog für seine Arbeit sein eigenes Libretto Romeo e Giulietta heran, das 1825 von Nicola Vaccai vertont und unter diesem Titel im Teatro alla Canobbiana in Mailand uraufgeführt worden war. Für Romani war es also innerhalb von fünf Jahren das zweite Mal, dass er sich mit dem »Romeo und Julia«-Stoff beschäftigte. Doch trotz des Rückgriffs auf schon vorhandenes Material sollte etwas Neues entstehen. So schrieb Bellini am 20. Januar 1830 an seinen Freund Florimo:
Il libro, Romani che già jeri è qui giunto, mi scriverà da nuovo Giulietta e Romeo, ma lo titolerà diversamente, e con diverse situazioni.
Das Buch, Giulietta e Romeo, das wird mir Romani, der gestern hier eingetroffen ist, neu schreiben, aber mit einem anderen Titel und anderen Situationen.[7]
So war also schon vor Beginn der Arbeit an der neuen Oper eine weitgehende Neuschöpfung gegenüber dem Vaccai-Libretto intendiert. Obwohl dieses als Grundlage für die neue Oper diente, sollten – mit neuem Titel und neuen Situationen – doch auch wesentlich neue Akzente gesetzt werden.
IV. Neuer Titel, neue Situationen:
Romanis Arbeiten für Vaccai und Bellini im Vergleich
Romanis »Romeo und Julia«-Libretti
vor dem Hintergrund der Stoffgeschichte
und zeitgenössischer Produktionen
Seit seinem Aufkommen in der italienischen Novellistik des 15. Jahrhunderts stieß der Stoff von Romeo und Julia auf großes Interesse seitens der Autoren und des rezipierenden Publikums, welches sich spätestens ab dem 16. Jahrhundert nicht mehr nur auf Italien beschränkte.[8] So sind auch die beiden Bearbeitungen des Stoffes durch Felice Romani als Glieder in einer europaweiten Reihe von Werken zu sehen, die sich mit der Geschichte der beiden Liebenden aus Verona auseinandersetzten.
Im ausgehenden 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren auf italienischen Bühnen mehrere neue Fassungen des »Romeo und Julia«-Stoffes aufgeführt worden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in Zusammenhang mit unserem Thema zunächst die Sprechtheaterfassungen, die auf zwei französischsprachige Autoren zurückgehen. Das Stück von Jean-François Ducis, Roméo et Juliette, tragédie imitée de l’Anglais (1772), wurde mindestens zweimal ins Italienische übersetzt.[9] Von der Tragödie von Louis-Sébastien Mercier, Les Tombeaux de Vérone, drame en 5 actes (1782), liegen ebenfalls mindestens zwei italienischsprachige Versionen vor.[10] Beide Stücke erfreuten sich in ihren italienischen Fassungen beim italienischsprachigen Publikum großer Beliebtheit und sollten, wie später zu zeigen sein wird, auch auf Romanis Schaffen Einfluss nehmen.
Obwohl Ducis im Untertitel seines Stückes darauf verweist, dass sich sein Werk an englischsprachigen Vorbildern orientiert, ist seine Tragödie nicht in der Tradition William Shakespeares zu sehen, der mit seiner Bearbeitung des »Romeo und Julia«-Stoffes im Jahr 1595 maßgebliche neue Akzente weit über den englischen Sprachraum hinaus gesetzt hatte. Während bei Shakespeare die Kerngeschichte um die beiden Titelhelden durch zahlreiche Nebenhandlungen mit durchaus auch komischen Zügen angereichert wird – was eine beträchtliche Erhöhung der Zahl der dramatis personae[11] gegenüber Vorläufermodellen zur Folge hatte –, reduziert Ducis die Handlung wieder auf ihre wesentlichen Momente und kommt so mit entsprechend wenigen Personen aus. Mercier folgt diesbezüglich dem Beispiel von Ducis. Auch bei ihm ist die Anzahl der Figuren gering gehalten, die Handlung konzentriert sich auf ihre wesentlichen Momente. Eine weitere, den beiden französischen Dramen gemeinsame Abweichung gegenüber Shakespeare besteht darin, dass sich in beiden die Handlung um eine ›Nebenfigur‹ zentriert: Bei Ducis steht Romeos Vater im Mittelpunkt,[12] bei Mercier dagegen Benvoglio, der als Arzt und Mitwisser um die Liebe der beiden Protagonisten die Funktion des namentlich seit der Novelle Luigi da Portos als Pater Lorenzo eingeführten Mönches übernimmt, auf dessen Initiative der Rettungsversuch für die Liebe Romeos und Julias zurückgeht.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten setzen die beiden französischen Sprechtheaterstücke aber durchaus auch unterschiedliche Akzente: so erfährt bei Ducis der Stoff eine deutliche Politisierung, der Streit der Familien wird bei ihm in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen Guelfen und Ghibellinen im Italien des 13. Jahrhunderts gebracht.[13] Eine Einbettung des Konfliktes in einen historischen politischen Kontext ist dagegen bei Shakespeare nicht intendiert, vielmehr unterstreicht dieser im Prologsonett mit dem Begriff mutiny die Belanglosigkeit des Anlasses für den Streit zwischen Capuleti und Montecchi.[14] Auch bei Mercier wird der Konflikt der beiden Häuser nicht vor dem Hintergrund des politischen Geschehens gesehen. Eine Besonderheit des Dramas Merciers liegt dagegen im glücklichen Ausgang, den der düstere Titel zunächst nicht suggeriert. Die zentrale Figur, der moralisierende Menschenfreund Benvoglio, überzeugt nicht nur die Familienoberhäupter, in die Heirat ihrer Kinder einzuwilligen, er wird darüber hinaus auch zum Garanten eines stabilen Friedens zwischen beiden Häusern.[15] Bei Ducis dagegen endet die Geschichte tragisch mit dem Tod der beiden Protagonisten. Trotz auch voneinander abweichender Akzentuierungen lässt sich also festhalten, dass sich das französische Sprechtheater des ausgehenden 18. Jahrhunderts, das um die Jahrhundertwende in Italien rezipiert wird, insgesamt von Shakespeare distanziert und auf Traditionen rückbesinnt, wie sie die italienische Novellistik schon vorgezeichnet hatte (Kernhandlung, reduzierte Anzahl von Figuren).
Doch nicht nur die Bühnen der Sprechtheater bekundeten um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert ihr Interesse am »Romeo und Julia«-Stoff, vielmehr datieren aus dieser Zeit auch die ersten Adaptionen für die Bühnen des Musiktheaters. Den Auftakt hierzu bildete das fünfaktige Ballett Giulietta, [sic!] e Romeo. Ballo tragico-pantomimo von Filippo Beretti nach Musik von Luigi Marescalchi (Uraufführung im Frühjahr 1785, Nuovo Regio-Ducal Teatro, Mantua).[16] Elf Jahre später, am 30. Januar 1796, fand an der Scala von Mailand die Uraufführung der Oper Giulietta e Romeo statt, die Nicola Zingarelli, der spätere Lehrer von Vincenzo Bellini am Konservatorium von Neapel, auf das Libretto von Giuseppe Maria Foppa komponiert hatte.[17]
Die folgende Synopsis zu Titel und Personenzahl insgesamt sowie die vergleichende Auflistung der einzelnen Personen geben Aufschluss, wie sehr im Opernlibretto Giuseppe Maria Foppas und den beiden Versionen Felice Romanis für Vaccai und Bellini die Stoffbearbeitungen, die auf das französischen Sprechtheater, insbesondere auf Mercier,[18] zurückgehen, nachwirken bzw. wo die Opernlibrettisten dieser Tradition gegenüber neue Akzente setzen.
Synopse zu Titeln und Personen in Sprech- und Musiktheater-Libretti
des »Romeo und Julia«-Stoffes
am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
(Die gleiche Tabelle als PDF.)
Titel
Die Titel führen, wie schon fast immer in der älteren Tradition sowie auch bei Shakespeare und Ducis, zumeist die Namen der beiden Liebenden. Wie bereits erwähnt, setzt Mercier mit seinem Titel Les Tombeaux de Vérone (Die Grabmale von Verona) einen düsteren Akzent, den er aber durch das lieto fine am Schluss überraschend konterkariert. So stellte sich bezüglich seines Stückes auch schnell die Gattungsfrage.[19] Romani beschreitet mit seinem Titel für das Vaccai-Libretto (im Folgenden: FR I) zunächst den Pfad der Tradition. Dagegen signalisiert er mit dem neuen Titel für das Bellini-Libretto (im Folgenden: FR II), dass der Opernbesucher etwas Neues gegenüber seiner Erstfassung des Stoffes von 1825 zu erwarten habe. – Die Namen der beiden Familien gehen auf den sechsten Gesang des Purgatorio der Divina Commedia (Verse 106–108) von Dante Alighieri[20] zurück, doch finden sich bei Dante keine Hinweis auf die Geschichte der beiden Liebenden,[21] mit der diese Namen später[22] verbunden wurden. Auch eine Verbindung zu dem Konflikt zwischen Ghibellinen und Guelfen wird von Dante nicht ausdrücklich hergestellt,[23] sie liegt nur insofern nahe, als dieser Canto insgesamt stark auf zeitpolitische Geschehnisse Bezug nimmt. Vor dem Hintergrund, dass Ducis aber Julias Familie, die Capuleti, und die von Romeo, die Montecchi, den unterschiedlichen politischen Lagern im Italien des 13. Jahrhunderts zugeordnet hatte – was dem italienischen Publikum im frühen 19. Jahrhundert noch präsent gewesen sein dürfte –, gewinnt die Neubetitelung durch Romani an Brisanz, evoziert sie doch mit den beiden Familiennamen sogleich den politischen Hintergrund des Italien des 13. Jahrhunderts. Dieser war zwar auch schon bei FR I klar gegeben, doch ist der Handlungsstrang der Liebe von Romeo und Julia mit dem der politisch bedingten Fehde zwischen den Guelfen (Capuleti) und den Ghibellinen (Montecchi) in FR II vom Beginn der Oper an konsequenter und geschickter verwoben.[24]
Gesamtzahl der Personen
Vom französischen Sprechtheater hin zu FR II ist eine Reduzierung der Gesamtzahl der Personen festzustellen, wobei diese aber von vornherein gering ist. Man vergleiche in diesem Zusammenhang die Anzahl der dramatis personae bei Shakespeare: Escalus, Prince of Verona – Mercutio, kinsman of the Prince and friend of Romeo – Paris, a young count, kinsman of the Prince and Mercutio, and suitor of Juliet – Page of Count Paris – Montague, head of a Veronese family at feud with the Capulets – Lady Montague – Romeo, son of Montague – Benvolio, nephew of Montague and friend of Romeo and Mercutio – Abram, servant of Montague – Balthasar, servant of Montague attending on Romeo – Capulet, head of a Veronese family at feud with Montagues – Lady Capulet – Juliet, daughter of Capulet – Tybalt, nephew of Lady Capulet – An old man of the Capulet family – Nurse of Juliet, her foster-mother – Peter, servant of Capulet attending on the Nurse – Sampson, Gregory, Anthony, Potpan, a Clown, Servingmen: of the Capulet household – Friar Laurence, a Franciscan – Friar John, a Franciscan – An Apothecary of Mantua – Three Musicians (Simon Catling, Hugh Rebeck, James Soundpost). – Members of the Watch – Citizens of Verona, maskers, torchbearers, pages, servants – Chorus.[25]
Die Väter
Die wie auch immer begründete Fehde zwischen den beiden Familien konfrontierte in der Tradition zunächst vor allem deren Oberhäupter, also die beiden Väter. Bei Ducis avancierte Romeos Vater sogar zur zentralen Figur des Stückes,[26] in FR I dagegen fällt dem Vater Julias die zentrale, da die Handlung im Wesentlichen bestimmende, Rolle zu. Das Ballett von Beretti und Marescalchi brachte noch beide Väter auf die Bühne, in den Opernlibretti von Foppa und Romani dagegen taucht der Vater von Romeo nicht mehr auf. Dies hat Konsequenzen für die Gestaltung der Figur des Romeo, der in allen drei Libretti als der einzige Vertreter der Montecchi auf der Bühne nicht nur der tragisch Liebende, sondern auch der (politische) Anführer seiner Familie ist. Diese handlungsstrategische Doppelfunktion der Figur gestattet in den beiden Versionen von Romani die Engführung der Liebes- mit der politischen Handlung, die, wie bereits erwähnt, in FR II stringenter und überzeugender erfolgt als in FR I.
Die Mutter und die Vertraute Julias
Während bei Mercier noch beide Positionen besetzt sind, fallen sie bei FR II ganz weg; Foppa und FR I dagegen arbeiten mit der einen oder der anderen Figur. In der Funktion sind sich die Vertraute und die Mutter der Julia ähnlich und auch ähnlich schwach: sie treiben die Handlung nicht voran und sind dadurch leicht austauschbar (Indiz hierfür ist auch derselbe Name für die Mutter Julias bei Mercier und für die Vertraute bei Foppa) oder gar zu eliminieren. Als wohlgesinnte Gesprächspartnerinnen Julias stellen sie strategisch eine Erweiterung der Figur der Julia dar, ohne ein wirklich ›eigenes Gesicht‹ zu bekommen. Mit ihrer Einfühlsamkeit bildet die Figur der Mutter der Julia auch einen Gegenpart zu ihrem Gatten, sie ist aber auch in diesem Zusammenhang auf eine andere, zentral handlungsbestimmende Figur, ihren Ehemann, hin ausgerichtet und erlangt kein richtiges Eigenleben.
»Te(o)baldo«
In dieser Figur fließen in den drei Opernlibretti zwei handlungsstrategisch wichtige Funktionen zusammen, die in der Tradition auf zwei Figuren aufgeteilt waren, von denen häufig eine als Bruder oder Vetter in verwandtschaftlichem Verhältnis zu Julia steht. Dieser nahe Verwandte wird in der Regel von Romeo getötet – was den Konflikt zwischen den verfeindeten Häusern neu entfacht und quasi unüberbrückbar macht.[27] Die zweite Funktion besteht darin, dass diese Figur, meist[28] aus der Gefolgschaft der Capuleti, der vom Vater Julias für seine Tochter auserkorene Bräutigam ist. Während bei Mercier diese Figur fehlt und auch mit nur einer der beiden Hauptfunktionen als Teil der Vorgeschichte die Handlung mitbedingt (Romeo hat Tebaldo getötet, daraufhin soll er ins Exil gehen, wovor ihn Benvoglio bewahrt, indem er ihn versteckt), gehen von der Figur des – nicht mit Julia verwandten – Tebaldo mit Elementen aus den beiden Funktionen in den Opernlibretti von Foppa und Romani immer wieder Impulse für den Handlungsverlauf aus. Dies trifft insbesondere für FR II zu.
Der ›Helfer‹ für Romeo und Giulietta
In der Tradition ist diese Figur entweder nur einer oder sogar beiden Familien freundschaftlich verbunden. Sofern sein Beruf genannt wird, ist der Helfer meist ein Mönch, gelegentlich auch Arzt, und trägt fast immer den Namen Lorenzo.[29] Möglicherweise bewog die Bedeutung des sprechenden Namens Benvoglio, »der das Gute will«, Mercier dazu, dem ›Gutmenschen‹ als der zentralen Figur seines moralisierenden Stückes den bei Shakespeare schon für eine Figur aus dem Lager der Montecchi verwendeten Namen zu geben. Schließlich beabsichtigt der Helfer in Merciers Version nicht nur das Gute, sondern bewirkt es am Ende sogar noch erfolgreich im lieto fine. Nicht in der Stofftradition begründet ist dagegen die Wahl des Namens »Gilberto« bei Foppa. Romani lehnt sich mit »Lorenzo« in beiden Libretti wieder stark an die Tradition an. – Durch seinen gut gemeinten, jedoch (in den meisten Versionen) verhängnisvoll verlaufenden Hilfsplan wird »Lorenzo« zum Verursacher des tragischen Endes der beiden Liebenden, in der Regel aber auch zugleich zum Begründer des Friedens zwischen den beiden Familien.
Romeo und Julia
Die beiden Liebenden, Sprösse zweier verfeindeter Familien aus Verona. In die Figur des Romeo fließt, je nachdem, ob die Rolle seines Vaters besetzt ist, auch die Funktion der politischen Führerschaft der Montecchi ein.
Strategien der Handlungsführung
in Felice Romanis »Romeo und Julia«-Libretti
In seinem Schreiben an Florimo vom 20. Januar 1830 hatte Bellini seinem Freund neben einem neuen Titel für die neue Oper auch angekündigt, dass Romani gegenüber dem Vaccai-Libretto an den Situationen ebenfalls Veränderungen vornehmen werde.[30] Im Folgenden sollen anhand dreier Beispiele Unterschiede in der Handlungsführung in FR I und FR II aufgezeigt werden.
Erstes Beispiel – das Duett von Romeo und Giulietta im ersten Akt
In beiden Libretti kommt es mit Hilfe Lorenzos im zweiten Bild des ersten Aktes jeweils zu einer heimlichen Begegnung Romeos und Giuliettas in deren gabinetto (Gemächern) (FR I: I, (6) 7–8; FR II: I, (5) 6). Während Romeo jeweils im ersten Teil des ersten Aktes bereits aufgetreten war, fällt der erste Auftritt Giuliettas bei beiden Versionen in den zweiten Teil. In FR I fällt er mit der Duettszene zusammen, während er in FR II dieser mit Rezitativ und Arie Eccomi in lieta vesta – Oh quante volte (FR II: I, 4) vorausgeht.
Der erste Auftritt Giuliettas erfüllt in FR II die Funktion, dem Publikum die weibliche Protagonistin in ihrer verzweifelten Lage vorzustellen und somit auch die folgende Duettszene vorzubereiten. Die Situation Giuliettas ist nicht nur verzweifelt, die Gefahr für sie ist auch imminent: schon ist sie als Braut gekleidet (»in lieta vesta« – »im Festkleid«), doch anstatt Freude über ihre bevorstehende Hochzeit zu empfinden, fühlt sie sich als Opfer (»vittima«), soll sie doch auf Wunsch des Vaters den ungeliebten Tebaldo heiraten, während derjenige, dem ihre Liebe gilt, als Feind ihrer Familie für sie als Bräutigam aus politischem Kalkül nicht in Frage kommt. Angesichts dieses Dilemmas lädt Giulietta in ihrem Wunschdenken die für die Trauungszeremonie bereitgestellten Gegenstände semantisch negativ auf, empfindet sie doch den ihr aufgezwungenen Weg als Braut zum Traualtar als den eines Opfers zum Opferaltar, wobei sie bei dieser imaginierten Alternative die Option ›Opfer‹ vorzieht und sich also die Hochzeitsfackeln (»nuziali tede«) als Fackeln ihres Todes (»faci ferali«) wünscht. Diese in nur wenigen Worten skizzierte Verzweiflung mündet noch im Rezitativ in den Ruf nach Romeo; in der anschließenden Arie bringt Giulietta ihre Sehnsucht nach dem (unerreichbar fern geglaubten) Geliebten zum Ausdruck.
Auch bei FR I wird das Publikum im Vorfeld des Duetts mit der verzweifelten Lage Giuliettas vertraut gemacht, doch fällt seine Konfrontation mit dem Unglück Giuliettas wesentlich sanfter aus. Dies liegt zum einen daran, dass sich Giulietta nicht selbst mitteilt, sondern der Zuschauer indirekt, zunächst aus einem Gespräch zwischen Lorenzo und Romeo (FR I: I,4) und dann aus Äußerungen der um ihre (in diesem Moment schlafende!) Tochter besorgten Mutter Adele (FR I: I,5), von Giuliettas Leid (»i suoi mali«) erfährt. Dieses erschöpft sich in diesen beiden Szenen außerdem auch in Giuliettas Sehnsucht nach Romeo und ihrem Leiden unter der Trennung – von der bevorstehenden Hochzeit aber muss sie in FR I an dieser Stelle erst noch in Kenntnis gesetzt werden, bittet doch Adele Lorenzo, die Tochter über die Entscheidung ihres Vaters aufzuklären.
In der nächsten Szene (FR I: I,6 und FR II: I,5) führt Lorenzo jeweils Romeo durch eine Geheimtür (»uscio segreto«) zu der von dem Wiedersehen völlig überraschten Giulietta. Während sie aber bei Bellini ihrem Geliebten im Brautkleid gegenüber steht, unterstreicht das Libretto für Vaccai ihre nachlässige Kleidung, hatte sie doch gerade noch geschlafen (»ella è vestita neglettamente« – »sie ist nachlässig gekleidet«). Nachdem sich die beiden Liebenden in die Arme gefallen sind, verlässt Lorenzo diskret Giuliettas Gemächer.
Das nun folgende Duett erstreckt sich in FR I über zwei Szenen, während es in FR II nur eine umfasst (FR I: I,7–8; FR II: I, 6). Die Aufteilung auf zwei Szenen bei Vaccai ist durch den Auftritt Lorenzos in der achten Szene bedingt, der die Liebenden aufsucht, um sie vor einer Gefahr zu warnen – ist doch Capellio auf dem Weg zu Giuliettas Gemach. Auch bei Bellini wird das Gespräch des Paares gestört: In der Ferne ist festliche Musik (nämlich die Hochzeitsmusik für Giuliettas Trauung) zu hören (»Odesi festiva musica da lontano«). Obwohl sich das Duett bei Bellini nur über eine Szene erstreckt, ist der Text in seiner Version allerdings erheblich länger als bei Vaccai. Dabei fällt vor allem die sehr unterschiedliche Länge der beiden Texte nach dem jeweiligen Störmoment auf.
Neben der in beiden Versionen vorhandenen Unterbrechung bzw. Störung des Dialoges weisen die beiden Duette aber auch am Anfang Parallelen auf. So mischen sich in die anfängliche übergroße Wiedersehensfreude die Erinnerungen an die leidvollen Tage der Trennung. Doch in der Folge nehmen die beiden Duette einen unterschiedlichen Verlauf. Zunächst zur Entwicklung des Gespräches bei Vaccai:
[I,7]
[…]
Romeo:
Ah! che divisi ognor / Ach! andauernd getrennt
non languirem così; / werden wir nicht mehr leiden;
a noi sereni ancor / frohe Tage sind uns bestimmt,
serban fortuna i dì. / die noch Glück für uns bereit halten.
Ma sia pur barbara / Doch wenn auch das Schicksal
con me la sorte, / grausam zu mir sein sollte,
potrà dividerci / vermag uns doch nur
la sola morte. / der Tod zu trennen.[…]
Romeo:
Il crudele l’esige invano / Der Grausame verlangt dies vergebens,
a noi scampo amor darà. / die Liebe wird uns retten.A 2: / Beide:
Ah più diletto / Ach, keine Freude
non spero in terra, / erhoffe ich mir mehr auf Erden,
eterna guerra / ewigen Krieg
ci giura amor. / verheißt uns die Liebe.
[I,8]
Lorenzo:
[…] a questa stanza […] Capellio
Volge Capellio il piè … / ist im Anmarsch…Giulietta:
Fuggi… ti salva… / Flieh… bring dich in Sicherheit…
Non esitar… / Zaudere nicht…Romeo:
Odimi in pria… / Hör mich erst noch an…
Nach der eingangs von beiden zum Ausdruck gebrachten Wiedersehensfreude und dem Rückblick auf das Leid fern vom anderen richtet Romeo seinen Blick auf die Zukunft: Ob ihre Tage von Glück (»fortuna«) geprägt sein werden oder ihnen ein grausames Schicksal (»barbara […] sorte«) bereithalten sollten, nie wieder wird das Paar sich trennen lassen, dies kann nur der Tod (»morte«) bewirken. Selbst angesichts der größten Bedrohung für das Paar, die Giuliettas Vater (»Il crudele« – »der Grausame«) verkörpert, der seine Tochter mit einem anderen vermählen möchte,[31] wissen die beiden sich von der Macht und Kraft der Liebe geschützt (»a noi scampo amor darà«). Allerdings ist das erhoffte Glück des gemeinsamen Lebens noch zu fern; sie ahnen, dass ihr Leben sich wohl zu einem ewigen Krieg (»eterna guerra«) um ihrer Liebe willen gestalten wird, so dass sie am Schluss der Szene ihrer Hoffnungslosigkeit Ausdruck verleihen (»più diletto non spero in terra«).
Obwohl die gegenwärtigen Hindernisse für die Realisierung des gemeinsamen Glückes sehr greifbar sind, richten die Liebenden ihren Blick vor allem auf ihr Leben in der Zukunft. Sie sprechen dabei in abstrakten Termini und überantworten ihr Schicksal höheren Mächten. Insofern haftet dem Dialog in I,7 etwas Träumerisches an, denn trotz der konkreten Gefahr (Giulietta soll Tebaldo ehelichen) wird kein konkreter Plan formuliert. Nach der Unterbrechung des Gespräches durch das Herannahen Capellios (I,8) allerdings sind die Liebenden gezwungen, auf der Stelle zu handeln: Giulietta fordert Romeo zur sofortigen Flucht auf, doch hebt Romeo in diesem Augenblick zu einem letzten Diskurs an: »Odimi in pria…«. Will er seiner Geliebten an dieser Stelle einen konkreten Handlungsplan unterbreiten? Diese Frage bleibt offen, schaltet sich doch Lorenzo ein zweites Mal mit der Aufforderung an Romeo zu gehen in das Gespräch ein, der dieser nun Folge leistet.
Nun zum Duett Romeo – Giulietta bei Bellini:
Romeo:
[…]
vengo,vengo a morir deciso, / ich komme, komme, entschlossen zu sterben,
o a rapirti per sempre ai tuoi nemici. / oder dich für immer deinen Widersachern zu entreißen.
Meco fuggir dêi tu. / Du musst mit mir fliehen.Giulietta:
Fuggire? Che dici? / Fliehen? Was sagst du da?
Romeo:
Sì, fuggire: a noi non resta / Ja, fliehen: in dieser äußersten Not
altro scampo in danno estremo / bleibt uns kein anderer Ausweg[…]
Giulietta:
Ah! Romeo! Per me la terra / Ach, Romeo! Für mich ist die Welt
è ristretta in queste porte: / auf diese Räume beschränkt:[…]
Qui m’annoda, qui mi serra / Hier bindet mich und schließt mich
un poter d’amor più forte. / eine stärkere Macht als die Liebe ein.
Solo, ah! solo all’alma mia / Nur, ach! nur meiner Seele
venir teco il ciel darà / wird der Himmel gestatten, mit dir zu ziehen[…]
Romeo:
Che mai sento? E qual potere / Was höre ich da? Und was für eine Macht
è maggior per te d’amore? / ist für dich stärker als die Liebe?Giulietta:
Quello, ah! quello del dovere, / Die, ach! die der Pflicht,
della legge, dell’onor, sì, sì, dell’onore. / des Gesetzes, der Ehre, ja, ja, der Ehre.[…]
(Odesi festiva musica di lontano.) / (In der Ferne ist festliche Musik zu hören)
Romeo:
Odi tu? L’altar funesto / Hörst du? Schon wird der unheilvolle Altar
Già s’infiora, già t’attende. / mit Blumen geschmückt und erwartet dich.Giulietta:
Fuggi, va. / Flieh, geh.
Romeo:
No, teco io resto. / Nein, ich bleibe bei dir.
[…]
Im Unterschied zum Duett in der Vaccai-Version präsentiert sich Romeo bei Bellini nach der gemeinsamen Wiedersehensfreude unumwunden mit der Alternative, die sich für ihn im textimmanenten Hier und Jetzt stellt. Er ist fest entschlossen, entweder zu sterben (»morire«) oder Giulietta für immer ihren (und seinen) Feinden zu entreißen (»rapirti per sempre ai tuoi nemici«), um anschließend mit ihr zu fliehen (»fuggir«). Durch dieses Ansinnen Romeos wird wiederum Giulietta vor eine Handlungsalternative gestellt, nämlich entweder Romeo Folge zu leisten oder ihrem Vater zu gehorchen. Sie fühlt sich in ihrem Inneren dem Konflikt zweier widerstreitender Mächte (»potere«) ausgesetzt, nämlich zwischen der Liebe (»amore«) und der Pflicht (»dovere«). Letztere wird weiter konkretisiert: Giulietta weiß sich in der Pflicht gegenüber dem Gesetz (»legge«) und der Ehre (»onore«).
Das Dilemma, vor dem Giulietta steht und das Romani mit den Wörtern »amore« und »dovere« sehr deutlich zitiert, ist der Konflikt schlechthin, in dem sich die Helden der klassischen französischen Tragödie des 17. Jahrhunderts befinden (amour vs. devoir) und auf dem die Handlung der jeweiligen Tragödie basiert. Die klassische französische Tragödie fand im Italien des 18. Jahrhunderts im Werk Vittorio Alfieris[32] eine Fortsetzung. Romani war mit der langen Tradition der klassischen Literatur nicht nur bestens vertraut, er hatte sich, teilweise noch vor seiner Tätigkeit als Librettist, immer wieder durch Veröffentlichungen[33] oder in literarischen Debatten als Verfechter der klassischen Ideale hervorgetan und gegen romantische Strömungen Position bezogen.[34]
Während für Romeo unbestritten die Liebe (»amore«) überwiegt, stellt für Giulietta die Pflicht (»dovere«) eine stärkere Macht als die Liebe dar (»un poter d’amor più forte«). Über dieser Frage der Gewichtung kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Liebenden, die erst durch das Erklingen der festlichen Musik in der Ferne (»festiva musica«) unterbrochen wird. Dieses lässt in Kürze das Kommen des Vaters erwarten, und so fordert Giulietta, wie schon in FR I, Romeo zur Flucht auf (»fuggi, va«). Doch im Gegensatz zu FR I, wo Romeo dieser Aufforderung ziemlich schnell nachkommt, beharrt er in der Version von Bellini auf der Klärung des Konflikts mit Giulietta, weswegen er bei ihr bleiben will (»No, teco io resto«) und wofür er sich sogar schon in diesem Moment zu sterben bereit erklärt. In dieser nach dem Störmoment durch die festliche Musik weiter ausgetragenen Diskussion liegt die unterschiedliche Länge der Duette in FR I und FR II begründet: Romeo wirft Giulietta ihre Unbeugsamkeit vor, Giulietta bittet ihn, nachzugeben – was er dann letztlich tut, bezwungen durch Giuliettas Bitten (»vinto dalle preghiere di Giulietta«).
Im Unterschied zu der Vaccai-Version befassen sich die beiden Protagonisten bei Bellini also konkret und durchaus kontrovers mit der Lösung ihres Problems. Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und überantworten es nicht abstrakten Mächten. Den Figuren haftet trotz ihrer großen Sehnsucht nach einem gemeinsamen Leben nichts in dem Maße wie bei Vaccai Träumerisches an, vielmehr scheinen sie pragmatischer und real(istisch)er und damit für den Zuschauer auch ›greifbarer‹ zu sein als bei Vaccai.
Zweites Beispiel – die Figur des Tebaldo
Sowohl bei Vaccai als auch bei Bellini ist Tebaldo der von Capellio für Giulietta auserkorene Ehemann. In beiden Versionen will Capellio mit der Hand seiner Tochter Tebaldo für seine treuen Dienste belohnen und damit zugleich dem Angebot des Unterhändlers der Montecchi (der der verkleidete Romeo selbst ist) eine Absage erteilen, in dem den Capuleti der Vorschlag unterbreitet wurde, mit der Heirat Romeos und Giuliettas den Streitigkeiten zwischen den beiden Häusern für immer ein Ende zu setzen.[35] Der Figur des Romeo, die in sich, wie oben dargelegt, zwei Funktionen vereint, nämlich die des politischen Anführers der Montecchi und die des Liebenden, sind im Lager der Capuleti zwei Gegenspieler zugeordnet: Capellio als der Anführer der politischen Gegner, und Tebaldo als der Rivale um Giulietta.
Neben diesen Parallelen in FR I und FR II weist der Tebaldo-Handlungsstrang in den beiden Versionen allerdings auch große Unterschiede auf. So ist bei Vaccai Tebaldo von Beginn der Oper an als der ›verlängerte Arm‹ des Capellio dargestellt und charakterlich an diesen angelehnt. Als Romeos Gegenspieler um die Hand Giuliettas wird er – zwischen dem ersten und zweiten Akt, also hinter den Kulissen – im Duell von Romeo getötet. Dass Romeo seinen Rivalen um Giulietta tötet, entspricht der Stofftradition. Wenn Lorenzo zu Beginn des zweiten Akts Giulietta seinen Plan erläutert, sind bereits alle über Tebaldos Tod informiert. Giuliettas Motivation, sich auf den Plan Lorenzos einzulassen, ist also nicht, der Hochzeit mit Tebaldo zu entgehen, sondern der Wut des Vaters (der sie wahrscheinlich in ein Kloster stecken würde):
Lorenzo:
E non temi / Und fürchtest du nicht
L’ira paterna? / Den Zorn deines Vaters?Giulietta:
A lui sottrarmi io spero / Ich hoffe, mich ihm zu entziehen,
Col tuo favor, e a pien mutar sorte. / Mit deiner Hilfe, und mein Schicksal völlig zu ändern.
Bei Bellini wird zwar ebenfalls die Vermählung von Tebaldo mit Giulietta von Capellio betrieben, doch zeichnet Romani in dieser Version Tebaldo von Beginn der Oper an als eine Figur, die tatsächlich zärtliche Gefühle für Giulietta hegt. Auch hier kommt es zum Duell zwischen den beiden Rivalen, das aber auf der Bühne stattfindet (II,6). Lorenzos Intrige wurde schon vor dem Duell der beiden eingeleitet (II,2), die Motivation der Giulietta lag darin begründet, dass sie sich so der Heirat mit Tebaldo entziehen wollte. Das Duell von Romeo und Tebaldo wird unterbrochen durch die Trauermusik, die den vorüber ziehenden Leichenzug der (scheintoten) Giulietta begleitet. An dieser Stelle wird in FR II nun zum zweiten Mal eine entscheidende Auseinandersetzung zwischen zwei Figuren durch die musikalische Untermalung eines wichtigen Ereignisses unterbrochen: War es im Duett Romeo – Giulietta im ersten Akt die Musik für die Hochzeit Giuliettas mit Tebaldo, ist es jetzt die Trauermusik anlässlich ihres vermeintlichen Todes.
Die beiden Gegner nehmen das Duell auch nicht wieder auf. Vielmehr entsteht aus der von beiden empfundenen Trauer eine verbale Auseinandersetzung, in der Romeo Tebaldo den Tod Giuliettas zum Vorwurf macht und dieser – plötzlich zur Einsicht in seine Mitschuld gelangt – sich daraufhin untröstlich in Selbstvorwürfen ergeht. Ihr Dialog kreist um die Frage, wessen Leid das größere sei, und gipfelt darin, dass jeder nun sterben möchte. Tebaldo, gerade noch Romeos Duellgegner, ist aber nun nicht mehr in der Lage, den untröstlichen Romeo, der ihn darum bittet, zu töten.
Obgleich es hier nicht zu einer expliziten Aussöhnung der Duellanten kommt, liegt doch eine Deutung der Szene in diese Richtung nahe. In der Tradition endet die Geschichte von Romeo und Julia in der Regel mit der Versöhnung der beiden verfeindeten Familien über dem Grab ihrer Kinder. Diese geschieht bei Romani in keiner der beiden Versionen.[36] Doch während in FR I das Ende so unversöhnlich ist wie schon der ganze Handlungsverlauf von Anfang an, kündigte sich in der Figur des liebenden Tebaldo bei FR II auf der Seite der Capuleti seit Beginn die Möglichkeit eines Einlenkens an. Trotzdem ihr Schmerz auch unterschiedliche Aspekte aufweist, eint Romeo und Tebaldo doch die Trauer um die tot geglaubte Giulietta, die ihnen eine Fortsetzung des Streites, hier des Duells, nicht möglich macht.
Drittes Beispiel – die Schlussszene
Die Tradition des »Romeo und Julia«-Stoffes kennt zwei Grundvarianten für die Schlussszene. In der einen Variante, die etwa bei Shakespeare zu finden ist, nimmt Romeo in der Gruft an der Seite der vermeintlich toten Julia das tödliche Gift zu sich und stirbt daran. Als Julia erwacht, fällt ihr Blick auf den toten Romeo und sie ersticht sich mit Romeos Dolch. In der anderen Variante, wie sie beispielsweise die italienische Novellistik bevorzugt, erwacht Julia, noch bevor Romeo stirbt. Es kommt zu einem dramatischen Dialog zwischen den beiden Liebenden, dann stirbt Romeo an den Folgen des Giftes, kurz darauf stirbt Julia.[37]
Für das Musiktheater ist die zweite die reizvollere Variante, bietet sie doch die Gelegenheit, nach einer Arie des Romeo, in der er beim Anblick der vermeintlich toten Giulietta seine Trauer und Verzweiflung zum Ausdruck bringt und das Gift nimmt, die Protagonisten nach Giuliettas Erwachen in einer hochdramatischen Situation ein letztes Liebesduett im Angesicht des nahen Todes singen zu lassen. Nach Foppa und Zingarelli optiert auch Romani bei beiden Versionen seines Stoffes für diese Schlussvariante – und doch unterscheiden sich seine beiden Libretti auch in der Schlussszene wesentlich. Denn während in FR I nach dem Duett Giulietta noch ein letzter musikalischer Höhepunkt, nämlich eine Arie, gegönnt ist, die sie in Anwesenheit von Lorenzo und der inzwischen unter der Führung Capellios in die Gruft geeilten Capuleti singt und in der sie bittere Vorwürfe an ihren Vater richtet und ihren Wunsch zu sterben äußert, folgt in FR II der Tod Giuliettas unmittelbar auf den Romeos:
Romeo:
Addio… ah! Giulie… / Lebewohl…. ah! Giulie…
Giulietta:
Ei muore… oh, Dio! / Er stirbt… oh, Gott!
(Cade sul corpo di Romeo) / (Sie bricht über dem toten Romeo zusammen)«
Dann erst stürmen Lorenzo, Capellio und in ihrem Gefolge die Capuleti in die Gruft. Sie können nur mehr den Tod beider feststellen (Lorenzo: »Morti ambedue« – »sie sind beide tot«, FR II: II,11). Im Unterschied zu FR I findet also die Vereinigung Romeos und Giuliettas im Tod in FR II ihre Entsprechung auch auf der musikalischen und der Handlungsebene, ist ihr letzter musikalischer Auftritt doch ein gemeinsamer, an dessen Ende sie gleichzeitig aus dem Leben und als aktive Figuren von der Bühne scheiden.
Für die Schlussszenen der beiden Libretti ergibt sich also folgendes Schema der musikalischen Nummern:[38]
FR I:
- Arie (Romeo)
- Duett (Romeo und Giulietta)
- Arie (Giuletta)
FR II:
- Arie (Romeo)
- Duett (Romeo und Giuletta)
Diese unterschiedliche Disposition des Opernschlusses veranlasste die Mezzosopranistin Maria Malibran, 1832 bei der Aufführung der Bellini-Oper am Teatro Comunale di Bologna, in der sie die Rolle des Romeo sang,[39] zu der Anregung, das Finale von FR II durch das Vaccai-Finale zu ersetzen, was dann auch so geschah.[40] Dieses Beispiel machte Schule: Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde Bellini immer wieder mit dem Vaccai-Schluss aufgeführt, übrigens sehr zum Verdruss des Nobelpreisträgers für Literatur, Eugenio Montale, der 1966 in seinen Besprechungen der Erstaufführungen an der Mailänder Scala bemerkt:
I Capuleti e i Montecchi, settima fra le undici opere di Vincenzo Bellini, apparvero più volte alla Scala dopo il successo ottenuto a Venezia nel 1830. In ognuna di queste rappresentazioni (1834, 1837, 1844, 1849 e 1861) l’opera continuava a portare un finale che non apparteneva al Bellini ma al maestro marchigiano Nicola Vaccai, autore di una precedente Giulietta e Romeo già apparsa alla Scala nel ’26. E lo stesso libretto del Romani non era che il rimaneggiamento del testo composto dallo stesso Romani per il Vaccai. Figuratevi che cosa accadrebbe oggi se un’opera di Pizzetti portasse il finale di un’opera scritta da un altro e rappresentata appena quattro anni prima nel medesimo teatro![41]
I Capuleti e i Montecchi, die siebte der insgesamt elf Opern von Vincenzo Bellini, ist nach der erfolgreichen Erstaufführung von 1830 in Venedig mehrmals auch an der Scala gespielt worden. Bei jeder dieser Aufführungen (1834, 1837, 1844, 1849 und 1861) endete die Oper immer mit einem Finale, das nicht aus der Feder Bellinis stammt, sondern dem aus den Marken stammenden Maestro Nicola Vaccai zuzuschreiben ist, der zuvor eine Oper mit dem Titel Giulietta e Romeo komponiert hatte, die bereits 1826 an der Scala uraufgeführt worden war. Und sogar das Libretto Romanis war lediglich eine Umarbeitung des Textes, den ebenderselbe Romani schon für Vaccai geschrieben hatte. Stellen Sie sich vor, was heute passieren würde, wenn in einer Oper von Pizzetti das Finale einer Oper aus der Feder von jemand anderem zu sehen wäre, die gerade erst einmal vier Jahre vorher in demselben Theater aufgeführt worden ist!
V. Ausblick auf das französische Repertoire
Hector Berlioz
In dieser Hinsicht war Hector Berlioz mehr Glück beschieden, der sich 1831 in Florenz, wo er sich unter anderem in den wundervollen Gärten am linken Arnoufer (»dans les bois délicieux qui bordent la rive gauche de l’Arno«) schon tagelang mit Shakespearelektüren vergnügt hatte, mit großer Vorfreude ins Theater begab und auch tatsächlich Bellinis Werk in seiner ganzen Länge zu sehen bekam:
Sachant bien que je ne trouverais pas dans la capitale de la Toscane ce que Naples et Milan me faisaient tout au plus espérer, je ne songeais guère à la musique, quand les conversations de table d’hôte m’apprirent que le nouvel opéra de Bellini (I Montecchi ed i Capuleti (sic!)) allait être représenté. On disait beaucoup de bien de la musique, mais aussi beaucoup du libretto, ce qui, eu [sic!] égard au peu de cas que les Italiens font pour l’ordinaire des paroles d’un opéra, me surprenait étrangement. Ah ! ah ! c’est une innovation !!! je vais donc, après tant de misérables essais lyriques sur ce beau drame, entendre un véritable opéra de Roméo, digne du génie de Shakespeare ! Quel sujet ! Comme tout y est dessiné pour la musique !… D’abord le bal éblouissant dans la maison de Capulet, où, au milieu d’un essaim tourbillonnant de beautés, le jeune Montaigu aperçoit pour la première fois la sweet Juliet, dont la fidélité doit lui coûter la vie ; puis ces combats furieux, dans les rues de Vérone, auxquels le bouillant Tybalt semble présider comme le génie de la colère et de la vengeance ; cette inexprimable scène de nuit au balcon de Juliette, où les deux amants murmurent un concert d’amour tendre, doux et pur comme les rayons de l’astre des nuits qui les regarde en souriant amicalement, les piquantes bouffonneries de l’insouciant Mercutio, le naïf caquet de la vieille nourrice, le grave caractère de l’ermite, cherchant inutilement à ramener un peu de calme sur ces flots d’amour et de haine dont le choc tumultueux retentit jusque dans sa modeste cellule… puis l’affreuse catastrophe, l’ivresse du bonheur aux prises avec celle du désespoir, de voluptueux soupirs changés en râle de mort, et enfin le serment solennel des deux familles ennemies jurant, trop tard, sur le cadavre de leurs malheureux enfants, d’éteindre la haine qui fit verser tant de sang et de larmes. Je courus au théâtre de la Pergola. Les choristes nombreux qui couvraient la scène me parurent assez bons, leurs voix sonores et mordantes ; il y avait surtout une douzaine de petits garçons de quatorze à quinze ans, dont les contralti étaient d’un excellent effet. Les personnages se présentèrent successivement et chantèrent tous faux, à l’exception de deux femmes, dont l’une, grande et forte, remplissait le rôle de Juliette, et l’autre, petite et grêle, celui de Roméo. — Pour la troisième ou quatrième fois après Zingarelli et Vaccaï, écrire encore Roméo pour une femme !… Mais, au nom de Dieu, est-il donc décidé que l’amant de Juliette doit paraître dépourvu des attributs de la virilité ? Est-il un enfant, celui qui, en trois passes, perce le cœur du furieux Tybalt, le héros de l’escrime, et qui, plus tard, après avoir brisé les portes du tombeau de sa maîtresse, d’un bras dédaigneux, étend mort sur les degrés du monument le comte Pâris qui l’a provoqué ? Et son désespoir au moment de l’exil, sa sombre et terrible résignation en apprenant la mort de Juliette, son délire convulsif après avoir bu le poison, toutes ces passions volcaniques germent-elles d’ordinaire dans l’âme d’un eunuque ?
Trouverait-on que l’effet musical de deux voix féminines est le meilleur ?… Alors, à quoi bon des ténors, des basses, des barytons ? Faites donc jouer tous les rôles par des soprani ou des contralti, Moïse et Othello ne seront pas beaucoup plus étranges avec une voix flûtée que ne l’est Roméo. Mais il faut en prendre son parti ; la composition de l’ouvrage va me dédommager…
Quel désappointement !!! dans le libretto il n’y a point de bal chez Capulet, point de Mercutio, point de nourrice babillarde, point d’ermite grave et calme, point de scène au balcon, point de sublime monologue pour Juliette recevant la fiole de l’ermite, point de duo dans la cellule entre Roméo banni et l’ermite désolé ; point de Shakespeare, rien ; un ouvrage manqué. Et c’est un grand poëte, pourtant, c’est Félix [sic!] Romani, que les habitudes mesquines des théâtres lyriques d’Italie ont contraint à découper un si pauvre libretto dans le chef-d’œuvre shakespearien !
Le musicien, toutefois, a su rendre fort belle une des principales situations ; à la fin d’un acte, les deux amants, séparés de force par leurs parents furieux, s’échappent un instant des bras qui les retenaient et s’écrient en s’embrassant : « Nous nous reverrons aux cieux. » Bellini a mis, sur les paroles qui expriment cette idée, une phrase d’un mouvement vif, passionné, pleine d’élan et chantée à l’unisson par les deux personnages. Ces deux voix, vibrant ensemble comme une seule, symbole d’une union parfaite, donnent à la mélodie une force d’impulsion extraordinaire ; et, soit par l’encadrement de la phrase mélodique et la manière dont elle est ramenée, soit par l’étrangeté bien motivée de cet unisson auquel on est loin de s’attendre, soit enfin par la mélodie elle-même, j’avoue que j’ai été remué à l’improviste et que j’ai applaudi avec transport.[42]
Mir war sehr wohl klar, dass ich in der Hauptstadt der Toscana nicht das finden würde, worauf ich in Neapel und Mailand in höchstem Maße hoffen konnte, so hatte ich die Musik gar nicht im Sinne, als ich aus den Unterhaltungen am Esstisch erfuhr, dass die neue Oper von Bellini (I Montecchi ed i Capuleti [sic]) aufgeführt werden sollte. Man äußerte sich sehr lobend zur Musik, aber auch zum Libretto, was mich doch sehr überraschte, machen doch die Italiener gewöhnlich um die Worte einer Oper kaum Aufhebens. Ah! ah! das ist also etwas ganz Neues! ich werde also, nach so vielen erbärmlichen dichterischen Versuchen an diesem schönen Theaterstück, eine richtige Romeo-Oper zu hören bekommen, die dem Genie Shakespeares würdig ist! Was für ein Sujet! Und wie hier auch alles schon für die Musik vorgezeichnet ist!… Zunächst der rauschende Ball im Hause der Capulet, wo, inmitten einer wirbelnder Schar von Schönheiten, der junge Montaigu zum ersten Mal die sweet Juliet erblickt, zu der ihn seine Treue sein Leben kosten soll; dann die wilden Kämpfe in den Straßen von Verona, die der aufbrausende Tybalt wie der Geist der Wut und der Rache anzuführen scheint, diese unaussprechliche Nachtszene am Balkon von Juliette, in der die beiden Liebenden ein Konzert der zärtlichen Liebe murmeln, die so süß und rein ist wie die Strahlen des Nachtgestirns, das freundlich lächelnd auf sie herabblickt; die stichelnden Späße des unbekümmerten Mercutio, das naive Geschwätz der alten Amme, der schwermütige Charakter des Eremiten, der vergeblich versucht, ein bisschen Ruhe in die Wogen der Liebe und des Hasses zurückzubringen, deren lärmender Aufschlag bis in seine bescheidene Zelle dringt… schließlich die entsetzliche Katastrophe, der Rausch des Glückes im Widerstreit mit dem der Verzweiflung, die Seufzer der Lust, die zum Todesröcheln werden, und dann das feierliche Versprechen der beiden verfeindeten Familien, die, zu spät, über den Leichnamen ihrer unglücklichen Kinder, dem Hass abschwören, der sie so viel Blut und Tränen vergießen ließ. Ich eilte zum Pergola-Theater. Zahlreiche Chorsänger bevölkerten die Bühne, sie schienen mir ziemlich gut zu sein mit ihren sonoren und beissenden Stimmen; da gab es vor allem etwa ein Duzend kleiner Jungen von vierzehn, fünfzehn Jahren, deren contralti hervorragend wirkten. Nach und nach traten die Figuren auf die Bühne, sie sangen alle falsch, außer zwei Frauen, von denen die eine, sie war groß und kräftig, die Rolle der Juliette bekleidete, und die andere, klein und zierlich, Romeo darstellte. – Zum dritten oder vierten Mal nach Zingarelli und Vaccai wird da noch einmal ein Romeo für eine Frau geschrieben!… Aber, um Himmels Willen, ist das jetzt also ein für alle mal so festgesetzt, dass der Geliebte Juliettes bar der Attribute der Männlichkeit in Erscheinung zu treten hat? Ist ein Knabe dazu in der Lage, in drei Zügen das Herz des rasenden Tybalt, dieses Meisters der Fechtkunst, zu durchbohren, und später, nachdem er den Zugang zur Gruft seiner Geliebten aufgebrochen hat, den Grafen Paris, der ihn provoziert hatte, auf den Stufen des Grabmales mit verächtlicher Geste zur Strecke zu bringen? Und seine Verzweiflung im Augenblick des Exils, seine dumpfe und schreckliche Resignation bei der Nachricht von Juliettes Tod, sein Wahn und seine Todeskrämpfe, nachdem er das Gift getrunken hat, all diese vulkanischen Leidenschaften – keimen die gewöhnlich in der Seele eines Eunuchen?
Sollte man etwa befinden, dass die musikalische Wirkung von zwei Frauenstimmen besser ist?… Wozu sind denn dann Tenöre, Bässe, Baritone überhaupt nutze? Dann sollen doch gleich Soprane und contralti alle Rollen übernehmen, Moses und Othello werden mit einer Flötenstimme auch nicht sehr viel befremdlicher sein als Romeo. Aber damit hat man sich wohl abzufinden, die Komposition des Stückes wird mich schon entschädigen…
Was für eine Enttäuschung!!! in dem Libretto kommt kein Ball bei den Capulet vor, kein Mercutio, keine schwatzhafte Amme, kein schwermütiger Eremit, keine Balkonszene, kein sublimer Monolog für Juliette, wenn sie das Fläschchen aus der Hand des Eremiten entgegennimmt, kein Duett in der Zelle zwischen dem verbannten Romeo und dem untröstlichen Eremiten; kein Shakespeare, gar nichts; ein missglücktes Werk. Und dabei ist das doch ein großer Dichter, dieser Felix [sic] Romani, den die armseligen Gewohnheiten der Operntheater in Italien dazu gezwungen haben, ein so klägliches Libretto aus dem Meisterwerk Shakespeares herauszuschneiden!
Doch eine der Hauptsituationen ist dem Musiker doch sehr gut gelungen; am Ende des einen Aktes, wenn die beiden Liebenden gewaltsam von ihren wütenden Eltern getrennt werden und sich für einen Augenblick den Armen entreißen können, die sie eben noch zurückhielten und nun, sich umarmend, ausrufen: »Im Himmel werden wir uns wieder sehen«, hat Bellini die Worte, die diese Idee ausdrücken, mit einer lebhaften, leidenschaftlichen Phrase untermalt, die voller Schwung ist und von den beiden Figuren im Unisono gesungen wird. Diese beiden Stimmen, die zusammen wie eine einzige vibrieren, sind als Symbol einer perfekten Vereinigung anzusehen und verleihen der Melodie eine außergewöhnliche Antriebskraft; und, sei es aufgrund der Einbettung der melodischen Phrase und der Art ihrer Herbeiführung, sei es aufgrund des sehr wohl begründeten seltsamen Eindruckes dieses Unisono, das nicht im Entferntesten zu erwarten war, oder vielleicht auch aufgrund der Melodie selbst, muss ich jedenfalls zugeben, dass ich auf einmal gerührt war und begeistert Beifall klatschte.[43]
Die Erwartungen Berlioz’, mit der Komposition von Bellini eine ›Shakespeare-Oper‹ genießen zu können, hatten sich also nicht erfüllt, war doch die Handlung des Romani-Librettos gegenüber dem überquellenden englischen Drama auf die wesentlichen Handlungsabläufe reduziert.[44] Als Berlioz dann 1839 in seiner Symphonie dramatique Roméo et Juliette den Stoff selbst neu vertonte, trug er dieser Enttäuschung beim Theaterbesuch in Florenz Rechnung und reicherte nicht nur sein Stück wieder mit den aus Shakespeare bekannten poetischen Momenten, lyrischen Akzenten und (realen wie phantastischen) (Neben-)Figuren an[45] (z. B. Ball- und Balkonszene, Mercutio, die Königin Mab, Versöhnung der verfeindeten Familien etc.), sondern bringt im Text selbst auch seine große Bewunderung für Shakespeare explizit zum Ausdruck:
Premier amour, n’êtes-vous pas
Plus haut que toute poésie?
Ou ne seriez-vous point, dans notre exil mortel,
Cette poésie elle-même,
Dont Shakespeare lui seul eut le secret suprême
Et qu’il remporta dans le ciel?
Erste Liebe, bist du nicht
Höher als alle Poesie?
Oder bist du vielleicht, hier in unserem irdischen Dasein,
Jene Poesie selbst,
Deren höchstes Geheimnis Shakespeare allein kannte
Und das er mit sich in den Himmel nahm?
Charles Gounod
Begeistert von Berlioz’ Komposition, die er in jungen Jahren am Conservatoire de Paris zu hören bekam, ließ sich Charles Gounod zu seiner Oper Roméo et Juliette (Uraufführung 1867, Théâtre Lyrique, Paris) anregen, wobei auch er und seine Textdichter Jules Barbier und Michel Carré sich in die stoffgeschichtliche Tradition nach Shakespeare stellen, diese weiterentwickeln (z. B. im Duett Roméo und Juliette (IV, erstes Bild), wo die beiden Lieben nicht wissen, ob schon die Lerche, die Künderin des Tages (»messagère du jour«), singt und sie sich also trennen müssen, oder ob noch die Nachtigall, die Vertraute der Liebe (»confidant de l’amour«) zu hören sei) und der gegenüber sie beispielsweise mit der Figur der Pagen Stéphano, neue Akzente setzen.
Nachweise und Anmerkungen
[1] Albert Gier, Das Libretto – Theorie und Geschichte, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel 2000, S. 215.
[2] So die Witwe Felice Romanis, Emilia Branca, in der von ihr verfassten Biographie ihres Mannes (Emilia Branca, Felice Romani ed i più riputati maestri di musica del suo tempo. Cenni biografici ed aneddotici, Torino: Loescher 1882, S. 116), zitiert in: Valeria Gaffuri, Felice Romani librettista per Bellini, in: Il magnifico parassita, hrsg. von Ilaria Bonomi und Edoardo Buroni, Milano: Franco Angeli 2010, S. 76, und in: Alessandro Roccatagliati, Felice Romani Librettista, Lucca: Libreria Musicale Italiana 1996, S. 23, Anm. 11.
[3] Vincenzo Bellini an Florimo, September 1828, zitiert in: Gaffuri, S. 76. – Über Felice Romani als den idealen Librettisten für Vincenzo Bellini siehe auch: Vincenzo Bellini, Norma. Melodramma in due atti di Felice Romani, hrsg. von Carlo Parmentola, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1974, S. 51f.
[4] Vincenzo Bellini an Felice Romani, 7. Oktober 1834, zitiert in: Roccatagliati, S. 384: »Forse scriverò un’opera per Napoli, forse sarà per Milano, forse anche per Parigi, eccoti tutte le offerte che mi sono state fatte in questo momento: io mi riserberò di accettare le più utili per l’interesse e per la gloria di noi due. Ora che sono ritornato con te, o mio gran Romani, mio egregio collaboratore e protettore, mi sento riposato e contento. […] Scrivimi subito e dimmi dove sei, se a Milano o a Torino, che presto ci rivedremo. Non vedo l’ora di abbracciarti.« (»Vielleicht schreibe ich eine Oper für Neapel, vielleicht wird es für Mailand sein, vielleicht auch für Paris, hier hast du alle Angebote, die man mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemacht hat: Ich werde mir vorbehalten, diejenigen anzunehmen, die für unser beider Interesse und Ruhm am nützlichsten sind. Jetzt wo ich mich wieder mit Dir zusammen getan habe, oh Du mein großer Romani, mein vortrefflicher Mitarbeiter und Förderer, fühle ich mich erholt und zufrieden. […] Schreib mir sofort und sag mir, wo du bist, ob in Mailand oder Turin, so werden wir uns bald wiedersehen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu umarmen.«
[5] Der Vollständigkeit halber sei hier auch die Oper Bianca e Fernando (erste Aufführung am 7. April 1828 anlässlich der Einweihung des Teatro Carlo Felice, Genua) genannt, doch handelt es sich hierbei nicht um eine Neuschöpfung Romanis, sondern vielmehr um eine Überarbeitung des von Domenico Gilardoni verfassten Librettos, das Bellini unter dem Titel Bianca e Gernando vertont hatte und das 1826 am S. Carlo in Neapel uraufgeführt worden war. Der Name des männlichen Helden bei Gilardoni sollte ursprünglich ebenfalls Fernando lauten, er wurde aber modifiziert, um sich nicht dem Verdacht der Anspielung auf den König beider Sizilien, Ferdinando di Borbone, auszusetzen (vgl. hierzu: Friedrich Lippmann, Romani e Bellini. I fatti e i principi della collaborazione, in: Felice Romani – Melodrammi, Poesie, Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 86ff., und Gaffuri, S. 75).
[6] Ursprünglich war Giovanni Pacini mit der Komposition einer Oper für diesen Termin beauftragt worden. Da er jedoch parallel dazu an drei weiteren Opern arbeitete (Auftragsarbeiten für die Theater San Carlo di Napoli, Scala di Milano und Regio di Torino), wendete sich der Impresario der Fenice, Alessandro Lanari, besorgt um die rechtzeitige Fertigstellung des Auftrags für sein Opernhaus, an Bellini, der sich gerade in Venedig aufhielt. Bellini nahm den Auftrag an. Vgl. hierzu: Fabio Vittorini, Shakespeare e il melodramma romantico, Firenze: La Nuova Italia 2000, S. 351.
[7] Bellini an Florimo, 20. Januar 1830, zitiert in: Gaffuri, S. 77.
[8] Einen Überblick über die Geschichte des Stoffes von Romeo und Julia in der europäischen Literatur bis hin zu Gottfried Keller bietet Elisabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart: Kröner 8/1992, S. 689–692.
[9] Die erste Übersetzung stammt von Antonio Bonucci, Florenz, 1778, die zweite von Francesco Balbi, Venedig, 1804. Von diesem Stück ließ sich der aus Brescia stammende Luigi Scevola zu seiner Tragödie Giulietta e Romeo inspirieren. Zu diesen und weiteren »Romeo und Julia«-Stücken auf italienischen Bühnen im Vorfeld der Libretti von Romani siehe Vittorini, S. 325ff.
[10] Die erste Übersetzung aus der Feder eines Unbekannten stammt aus dem Jahre 1789 und wurde in Venedig angefertigt, die zweite wird dem Venezianer Giuseppe Ramirez zugeschrieben (1797) und sollte Anfang des 19. Jahrhunderts Cesare Della Valle zu einer Neufassung anregen, vgl. Vittorini, S. 327f.
[11] Zu den dramatis personae bei Shakespeare im Vergleich zu der Anzahl der Figuren in Nachfolgestücken siehe die folgenden Kommentare zur Synopse.
[12] Die Figur des Montaigu reichert Ducis zudem mit Motiven aus dem Inferno von Dantes Divina Commedia an, vgl. Vittorini, S. 326.
[13] Vgl. ebd., S. 326f.
[14] William Shakespeare, Romeo and Juliet – Romeo und Julia, übers. und hrsg. von Herbert Geisen, Stuttgart: Reclam 1979, bibliographisch ergänzte Ausgabe 2009, S. 8 und S. 207.
[15] Vgl. Vittorini, S. 329f.
[16] Vgl. ebd., S. 330ff. – Die Betrachtung der Balletttradition würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen.
[17] Vgl. Vittorini, S. 332ff.
[18] Vittorini folgend gehen auch wir von einem gegenüber Ducis etwas stärkeren Einfluss Merciers auf die hier besprochenen »Romeo und Julia«-Libretti aus, obwohl weder Foppa noch Romani ihn unter ihren Quellen anführen (für Foppa: Vittorini, S. 333; für Romani: ebd., S. 341ff.). Da Mercier unter anderem, wie dargestellt, auf Ducis als Vorlage zurückgreift, wird in der Synopse der Übersichtlichkeit halber die Tradition des französischen Sprechtheaters auf Mercier beschränkt.
[19] Vgl. Vittorini, S. 328.
[20] Dante Alighieri, La Divina Commedia, Vol. II: Purgatorio, hrsg. von Natalino Sapegno, Firenze: La Nuova Italia 1984, S. 67f.
[21] Wie bereits erwähnt, ist der »Romeo und Julia«-Stoff erstmals in der italienischen Novellistik des 15. Jahrhunderts, also nach Dante, dokumentiert, und zwar im Novellino des Masuccio (1476), der die Geschichte in Siena ansiedelt: vgl. Frenzel, S. 689.
[22] Ab Luigi da Porto: Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti (1524), vgl. Frenzel, S. 689.
[23] Dieser Umstand hat die Dante-Kritik seit jeher zu unterschiedlichen Mutmaßungen angeregt, siehe hierzu den entsprechenden Kommentar von Natalino Sapegno, in Dante Alighieri, S. 67f.
[24] Siehe unten.
[25] Shakespeare, S. 4/6
[26] Siehe oben.
[27] Dieser Tradition folgend, geht der Handlung von FR I und FR II jeweils die Tötung des Bruders Giuliettas durch Romeo voraus, was textimmanent die Unnachgiebigkeit des Vaters Giuliettas im Konflikt mit den Montecchi erklärt.
[28] Aber nicht immer: So ist etwa die Figur mit dieser Funktion bei Shakespeare, der Graf Paris, als Verwandter des Prinzen und Mercutios nicht den Capuleti zuzuordnen.
[29] Bei Shakespeare fließen in die Figur des Friar Laurence beide ›berufliche‹ Aspekte ein: Bei seinem ersten Auftritt (II,3) sortiert er »baleful weeds and precious-juiced flowers« (II,3, Vers 4), eine Tätigkeit, die ihn in philosophische Gedankengänge abschweifen und auch über die »medicine power« (II,3, Vers 20) der Pflanzen sinnieren lässt. Shakespeare bewegt sich damit nahe an der Realität des Mittelalters, verfügten die Klöster und Abteien doch in der Regel auch über einen Garten mit medizinischen bzw. Heilpflanzen. Vgl. hierzu: Matteo Vercelloni und Virgilio Vercelloni, L’invenzione del giardino occidentale, Milano: Editoriale Jaca Book 2009, S. 32–34.
[30] Siehe oben.
[31] An dieser Stelle ist insofern eine logische Inkohärenz des Librettos festzustellen, als noch aus I,5 hervorgeht, dass Giulietta nichts von den Plänen ihres Vaters weiß, während sie in dieser Szene darüber bereits informiert ist.
[32] Spuren des verehrten Dichters von Tragödien im klassischen Stil, Vittorio Alfieri, bei Felice Romani stellt auch Stefano Verdino fest, wenn er beispielsweise in Zusammenhang mit der Schlussarie Giuliettas, die an den Vater gerichtet ist, ihre verzweifelte Wut als eine »rabbia alfieriana«, einer Wut à la Alfieri, bezeichnet (Stefano Verdino, Come lavorava Felice Romani. Dalle fonti contemporanee ai melodrammi seri, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 162).
[33] Zu nennen wären in diesem Zusammenhang etwa seine Beiträge ab 1818/19 zum Dizionario d’ogni mitologia e antichità, dessen Fertigstellung bis 1827 er dann zusammen mit Antonio Peracchi übernahm: vgl. Roccatagliati, S. 25f.
[34] Siehe etwa seine Polemik gegen die Lombardi alla prima Crociata von Tommaso Grossi (1826) oder seine vernichtende Kritik an den Promessi sposi von Alessandro Manzoni in der Zeitschrift La vespa (1827), vgl. Roccatagliati, S. 30 und S. 44ff.
[35] Die Verflechtung des politischen Handlungsstranges mit dem der Liebe ist in den ersten Szenen von FR I und FR II unterschiedlich stringent. Während beispielsweise in FR I die Absicht Capellios, Giulietta mit Tebaldo zu vermählen, erst später mit der festen und ewigen Freundschaft (»costante ed eterna amistà«, FR I: I,1) Tebaldos begründet wird, stellt Felice Romani diesen Zusammenhang in seinem Libretto für Bellini von vornherein her.
[36] Da mit Romeo am Schluss der Oper in beiden Versionen Romanis auch der einzige handlungsrelevante Vertreter der Montecchi (neben ihm gibt es nur noch den Chor der Gefolgschaft der Montecchi) im Stück stirbt, ist die Versöhnung der beiden Häuser auf der Bühne auch gar nicht möglich.
[37] Ob Julia sich selbst tötet oder vom Schmerz angesichts des toten Romeo dahingerafft wird, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, die Tradition kennt beide Möglichkeiten. Vgl. hierzu Vittorini, Shakespeare e il melodramma romantico, S. 317ff.
[38] Vgl. Vittorini, S. 357.
[39] Giulietta wurde von Sofia Schoberlechner interpretiert.
[40] Vgl. Vittorini, S. 359f.
[41] Eugenio Montale, Prime alla Scala, in: Il secondo mestiere. Arte, musica, società, hrsg. von Giorgio Zampa, Milano: Mondadori 1996, S. 881.
[42] Hector Berlioz, Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm,Kap. XXXV.
[43] Die hier von Berlioz besprochene Szene befindet sich am Ende des ersten Aktes.
[44] Vgl. Lippmann, S. 91: « Qui, in Romani, Romeo e Giulietta parlano solo della fuga, se non della morte. Non vi è alcun corrispondente della “scena del balcone”. » – »Hier, bei Romani, sprechen Romeo und Giulietta nur von der Flucht, wenn nicht gar vom Tod. Es gibt keine Ensprechung für die ›Balkonszene‹.«
[45] Berlioz hält in seinen Mémoires fest, dass er zunächst selbst eine Prosafassung für seine Symphonie dramatique verfasste, die dann der Dichter Emile Deschamps in Verse setzte (Hector Berlioz, Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm, Kapitel XLIX).
Bibliographie
Bellini, Vincenzo: Norma. Melodramma in due atti di Felice Romani, hrsg. von Carlo Parmentola, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1974.
Berlioz, Hector: Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm.
Dante Alighieri: La Divina Commedia, Vol. II: Purgatorio, hrsg. von Natalino Sapegno, Firenze: La Nuova Italia 1984.
Frenzel, Elisabeth: Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart: Kröner 8/1992.
Gaffuri, Valeria: Felice Romani librettista per Bellini, in: Il magnifico parassita, hrsg. von Ilaria Bonomi und Edoardo Buroni, Milano: FrancoAngeli 2010, S. 75–114.
Gier, Albert: Das Libretto – Theorie und Geschichte, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel 2000.
Lippmann, Friedrich: Romani e Bellini. I fatti e i principi della collaborazione, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 83–114.
Montale, Eugenio: Prime alla Scala, in: Il secondo mestiere. Arte, musica, società, hrsg. von Giorgio Zampa, Milano: Mondadori 1996, S. 881–884.
Roccatagliati, Alessandro: Felice Romani Librettista, Lucca: Libreria Musicale Italiana 1996.
Shakespeare, William: Romeo and Juliet – Romeo und Julia, übers. und hrsg. von Herbert Geisen, Stuttgart: Reclam 1979, bibliographisch ergänzte Ausgabe 2009.
Vercelloni, Matteo, und Virgilio Vercelloni: L’invenzione del giardino occidentale, Milano: Editoriale Jaca Book 2009, deutsche Ausgabe: Geschichte der Gartenkultur, Darmstadt: Philipp von Zabern 2010.
Verdino, Stefano: Come lavorava Felice Romani. Dalle fonti tragiche contemporanee ai melodrammi seri, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 145–181.
Vottironi, Fabio: Shakespeare e il melodramma romantico, Firenze: La Nuova Italia 2000.
Diskographie
Bellini, Vincenzo: I Capuleti e i Montecchi, Emi 1985 (Riccardo Muti – Royal Opera House, Covent Garden)
Bellini, Vincenzo: I Capuleti e i Montecchi, Deutsche Grammophon 2009 (Fabio Luisi – Wiener Symphoniker)
Berlioz, Hector: Roméo et Juliette, Deutsche Grammophon 1980 (Daniel Barenboim – Orchestre de Paris)
Gounod, Charles: Roméo et Juliette, RCA Victor Red Seal 1995 (Leonard Slatkin – Münchner Rundfunkorchester)
Vaccai, Nicola: Giulietta e Romeo, Bongiovanni 1996 (Tiziano Severini – Orchestra Filarmonica Marchigiana/Teatro G. B. Pergolesi di Jesi)
Elisabeth Sasso-Fruth: Literarische Aspekte in und um Romance und Mélodie
Elisabeth Sasso-Fruth (Leipzig)
Literarische Aspekte in und um Romance und Mélodie
Phillip Moll zum 70. Geburtstag
Dieser Text basiert auf einem Vortrag an der HMT Leipzig im Rahmen des Studientags Lied-Konzepte um 1800 am 21. Juni 2013. – Übertragungen sämtlicher französischer Texte ins Deutsche: Elisabeth Sasso-Fruth.
1. Musik in der Literatur: zu einem Gespräch in Gustave Flauberts Roman Madame Bovary
 In Gustave Flauberts 1857 erschienenem Roman Madame Bovary findet sich im zweiten Kapitel des zweiten Teils folgender Ausschnitt aus einem Gespräch, das zwischen Madame Bovary, dem Apotheker Homais und dem Notargehilfen Léon, der im Fortgang des Romans zum (zweiten) Liebhaber der Titelheldin werden soll, stattfindet:
In Gustave Flauberts 1857 erschienenem Roman Madame Bovary findet sich im zweiten Kapitel des zweiten Teils folgender Ausschnitt aus einem Gespräch, das zwischen Madame Bovary, dem Apotheker Homais und dem Notargehilfen Léon, der im Fortgang des Romans zum (zweiten) Liebhaber der Titelheldin werden soll, stattfindet:
– Ces spectacles [des paysages de montagnes] doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l’extase! Aussi je ne m’étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d’aller jouer du piano devant quelque site imposant.
– Vous faites de la musique? demanda-t-elle.
– Non, mais je l’aime beaucoup, répondit-il.
– Ah! Ne l’écoutez pas, madame Bovary, interrompit Homais en se penchant sur son assiette, c’est modestie pure. – Comment, mon cher! Eh! L’autre jour, dans votre chambre, vous chantiez L’ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire; vous detachiez cela comme un acteur.
Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage, sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire […].
Emma reprit:
– Et quelle musique préférez-vous?
– Oh! La musique allemande, celle qui porte à rêver.
– Connaissez-vous les Italiens?
– Pas encore; mais je les verrai l’année prochaine, quand j’irai habiter Paris, pour finir mon droit.[1]
– Diese Anblicke [der Gebirgslandschaften], müssen den Betrachter einfach in Begeisterung versetzen und stimmen ihn zwangsläufig zum Gebet, zur Ekstase! Übrigens wundere ich mich auch nicht mehr über jenen berühmten Musiker, der, um seine Phantasie noch besser anzuregen, die Gewohnheit hatte, sich zum Klavierspielen immer vor irgendeine imposante Landschaft zu begeben.
– Machen Sie selbst eigentlich auch Musik? fragte sie.
– Nein, aber ich liebe sie sehr, antwortete er.
– Ach! Hören Sie nicht auf ihn, Madame Bovary, unterbrach Homais und beugte sich dabei über seinen Teller, das ist doch die reinste Bescheidenheit. – Was sagen Sie denn da, mein Lieber! He! Neulich haben Sie in Ihrem Zimmer einfach hinreißend L’ange gardien gesungen. Ich hörte Sie vom Labor aus, Sie deklamierten das so deutlich wie ein Schauspieler.
Tatsächlich war Léon bei dem Apotheker untergebracht, wo er in der zweiten Etage ein kleines Zimmer hatte, das zum Platz hinaus ging. Das Kompliment seines Hausherrn ließ ihn erröten […].
Emma fragte weiter:
– Und welche Musik bevorzugen Sie?
– Oh! Die deutsche Musik, die, die einen zum Träumen bringt.
– Kennen Sie auch die Italiener?
– Noch nicht, aber ich werde sie nächstes Jahr sehen, wenn ich nach Paris umziehen werde, um meine Jurastudium zu beenden.
Unter vier Aspekten ist hier von Musik die Rede: Da ist zunächst die Pose des vor imposanter Kulisse spielenden berühmten Pianisten, dann die vom Apotheker zufällig belauschte Darbietung von L’ange gardien durch Léon, der sich in seinem Zimmer unbeobachtet wähnte, schließlich werden kurz die »deutsche Musik« und »die Italiener« angetippt.
Zunächst soll L’ange gardien näher betrachtet werden. Der Titel des von Léon gesungenen Stückes ist von Flaubert nicht ganz genau wiedergegeben, er lautet korrekt A mon ange gardien. Es handelt sich um eine Romance aus der Feder von Pauline Duchambge (1776–1858), die Graham Johnson als “France’s first notable woman song composer” bezeichnet.[2] Duchambge war in ihrem Schaffen äußerst produktiv: Zwischen 1816 und 1840 schrieb sie rund 400 Romances. Die Komposition A mon ange gardien entstand um 1825, also zum Ende der Blütezeit der Romance als Salonromanze in Frankreich,[3] die in die Revolutionszeit, unter das Empire und die Restauration fällt. Die Autorschaft des vertonten Textes ist unklar. Doch war dieses Gedicht um 1825 sehr bekannt und beliebt.[4]
2. Analyse von A mon ange gardien von Pauline Duchambge
Faksimile:[5]
A mon ange gardien
Bon ange ô sauvez moi d’une erreur dangereuse,
Je ne veux pas l’aimer, l’amour fait trop souffrir!
Mais il me suit partout je suis bien malheureuse
Comment faire mon ange, hélas! pour le haïr?
Quand il m’ouvre son cœur en vain je le repousse
Il pleure et moi ces pleurs me donnent de l’effroi
Je ne veux pas l’aimer, mais sa voix est si douce
Ô mon ange veillez sur moi!Il m’avait autrefois, donné la tourterelle
Que (je sais pourquoi) je préfère aujourd’hui
Lorsque je la caresse, elle me le rappelle,
Je trouve qu’elle est triste, et douce comme lui
En rêvant l’autre jour, j’interrogeai moi-même
Ces fleurs qui des amants peignent dit-on la foi…
Les fleurs que j’effeuillais disaient toutes je t’aime
Ô mon ange, veillez sur moi.Tous les lieux qu’il chérit, je les chéris de même
La couleur qu’il préfère est la mienne à présent,
Je ne chante jamais que la chanson qu’il aime
J’adopte tous les mots qu’il répète souvent
Je conserve toujours la fleur qu’il m’a donnée
Elle est là sur mon cœur… et cependant je crois
Que depuis bien long tems cette fleur est fanée
Ô mon ange veillez sur moi.(Transkription nach dem Manuskript ohne Korrektur von Interpunktion und Rechtschreibung)
An meinen Schutzengel
Guter Engel, oh rette mich vor einem gefährlichen Fehler,
Ich möchte ihn nicht lieben, Liebe bedeutet zu viel Leid!
Doch er folgt mir überall hin, ich bin ziemlich unglücklich,
Was soll ich nur tun, mein Engel, ach! um ihn zu hassen?
Wenn er mir sein Herz öffnet, dann weise ich ihn vergeblich zurück,
Er weint und mich, mich erschrecken diese Tränen,
Ich möchte ihn nicht lieben, aber seine Stimme ist so sanft,
Oh, mein Engel, wache über mich!Er hatte mir einst die Turteltaube geschenkt,
die (ich weiß wohl, warum) ich heute am liebsten habe,
Wenn ich sie liebkose, erinnert sie mich an ihn,
Ich finde, dass sie so traurig und so sanft ist wie er.
Neulich ging ich im Traum in mich
Diese Blumen, von denen es heißt, sie stünden für die Treue der Liebenden…
Die Blumen, die ich abzupfte, sagten alle: ich liebe dich.
Oh, mein Engel, wache über mich.All die Plätze, die ihm so lieb sind, sind auch mir so lieb,
Seine Lieblingsfarbe ist gerade auch die meine,
Ich singe immer nur das Lied, das er so gerne hat,
Ich sage die gleichen Worte, die er so oft ausspricht,
Ich habe noch immer die Blume, die er mir geschenkt hat,
Sie ist da, auf meinem Herzen… und doch glaube ich
Dass diese Blume schon seit langer Zeit verwelkt ist.
Oh, mein Engel, wache über mich.
2.1. Literarische Analyse von A mon ange gardien in Hinblick auf gattungstypische Merkmale der Romance
2.1.1. Aufbau und Metrik
Entsprechend der Tradition der Romance ist die vorliegende Komposition in Strophenform verfasst. Eher untypisch ist der Verzicht auf einen Refrain, doch bei »Pauline Duchambge gibt es in der Regel keine Refrains.«[6] Außerdem erinnert der Endvers der drei Strophen, der immer denselben Wortlaut aufweist, entfernt an dieses Gattungsmerkmal.
Der Wechsel von männlichen und weiblichen Versen und das alternierende Reimschema erfolgen mit Regelmäßigkeit. Diese kennzeichnet auch die Versabfolge innerhalb der Strophen: auf sieben Alexandriner folgt immer ein Achtsilbler. Mit den Alexandrinern und den Achtsilblern kommen in diesem Gedicht zwei der klassischen französischen Verse zur Anwendung, die hier auch beide genau in der Mitte zäsiert sind (also der Alexandriner nach der sechsten, der Achtsilbler nach der vierten Silbe). Nur eine einzige Abweichung weist das Manuskript in der sonst so regelmäßigen Metrik auf, nämlich im zweiten Vers der zweiten Strophe, die aus einem Elfsilbler besteht. Vermutlich liegt allerdings hier ein Versehen vor und es wurde einfach ein ne vergessen: « Que (je ne sais pourquoi) je préfère aujourd’hui ». Dann würde die Aussage in der Klammer verneint: »die (ich weiß nicht warum) ich heute am liebsten habe«. Diese Verneinungspartikel würde nicht nur dem Versschema durchgängig zur Regelmäßigkeit verhelfen, sondern auch inhaltlich besser zur ›Psychologie‹ der Sprecherin in diesem Gedicht passen (siehe unten). Insgesamt lässt sich feststellen, dass die metrischen Strukturen des Textes keine Überraschungen bergen. Dies erleichtert und fördert die Einprägsamkeit des Textes.
2.1.2. Inhalt und sprachliche Aspekte
Das für die Romance typische sentimentale Sujet[7] des Gedichtes lässt sich folgendermaßen kurz zusammenfassen: Ein Mädchen wehrt sich gegen das Gefühl der Liebe, die es für einen Mann empfindet, der ihm ebenfalls in Liebe zugeneigt ist.
Das weibliche lyrische Ich ist offensichtlich noch sehr jung und ›unschuldig‹. Dafür sprechen:
- die gebetartige Hinwendung der Sprecherin in ihrer ›Not‹ an den Schutzengel, den sie um Hilfe bittet (Gesten des Gebets: vgl. I,1 und den sich je wiederholenden Schlussvers)
- die pubertär anmutende Dringlichkeit, mit der sie dies tut (I,1 und I,4: unvermittelte Anrede des Schutzengels, emphatische Interjektion (« hélas! »), die hilflose, litaneiähnliche Selbstüberantwortung an den Schutzengel jeweils im Schlussvers aller drei Strophen)
- das ›Dilemma‹ selbst – denn worin liegt eigentlich das Problem der jungen Frau? Offensichtlich ist die Erfahrung der Liebe für sie neu, ihre Reaktionen auf die Liebesbekundungen des jungen Mannes sind erschreckt und scheinen deshalb hilflos (siehe I,3f. und I,6f.).
- ihr Umgang mit der ›Notsituation‹: Unfähigkeit zur Abstrahierung und Verortung der neuen Erfahrung im eigenen Leben, dieses Liebeserlebnis bleibt ausschließlich auf der Ebene der Emotionen verhaftet. Die umgangssprachliche umständliche Wortstellung in I,6 bildet die emotionale Verwirrung auf sprachlicher Ebene ab.
- Die einzige ›abstrakte‹ Einsicht « l’amour fait trop souffrir » (I,2) scheint mit ihrer fast apodiktischen Gesetztheit eher aus der Überlieferung bzw. einer Spruchsammlung als aus der eigenen Erfahrung der Sprecherin zu stammen. Sie verlässt sich ziemlich unreflektiert auf »Hörensagen« (« dit-on », II,6).
- (Rück)halt und Antworten auf ihre Fragen sucht sie auf metaphysischer Ebene (Schutzengel) und in schlichten (abergläubischen) Volkstraditionen (Abzupfen der Blütenblätter).
Die erste Strophe setzt mit großer emphatischer Geste ein (im ersten Vers: Anrufung des Schutzengels (« Bon ange »); dramatische Bitte um Rettung (« sauvez-moi ») vor einer Gefahr (« dangereuse »), an der sie selbst zumindest eine Mitschuld hat (« erreur »)). Der Zuhörer wird sofort vom Sujet ergriffen und emotional involviert. Außerdem ist die Tatsache, dass das Mädchen hier dem Schutzengel sein Herz ausschüttet, Garantie dafür, dass die Rede des Mädchens – die übrigens auch sprachlich sehr einfach und leicht verständlich ist – absolut aufrichtig und unverfälscht ist. Sie zeugt von der Unverderbtheit des Mädchens, wodurch diesem wiederum die unbedingte Sympathie des Zuhörers sicher ist. Die dramatische Sprechhaltung durchzieht die ganze erste Strophe.
In der zweiten Strophe weicht diese Dramatik der Erinnerung (« autrefois » – Geschenk der « tourterelle » – « l’autre jour ») und der Reflexion (« je m’interrogeai moi-même » – ›Befragen‹ der Blumen, denn die »sagen die Wahrheit über die Liebe«). In der dritten Strophe klopft die junge Frau ihre eigenen Vorlieben (« couleur [préférée] ») und ihr eigenes Verhalten (« chanson » – « mots ») auf Anzeichen für die Seelenverwandtschaft mit dem (verehrten) Verehrer ab. Die Reflexionen und Selbstvergewisserungen sind von großer Schlichtheit und Klischeehaftigkeit und zeichnen insgesamt das Bild eines hochemotionalen und naiven Mädchens, das – dies die Pointe des Gedichtes – sich vielleicht zu lange gegen seine eigenen Gefühle sträubte (« fleur […] fanée »), was die Geschichte für die Protagonistin vermutlich nicht gut ausgehen lässt.
Der Leser, der von Anfang an auf die Denk- und Gefühlsebene des Mädchens gebracht wird, wird emotional in dessen ›Geschichte‹ involviert und kann,wenn er dem Mädchen gegenüber einen Vorsprung an Lebenserfahrung hat und die Situation etwas zu abstrahieren vermag, in der Sprecherin das tragische Opfer ihrer eigenen Unschuld erkennen.
2.2. Musikalische Analyse von A mon ange gardien in Hinblick auf gattungsspezifische Merkmale der Romance
Das Stück A mon ange gardien ist eine Komposition für Gesang mit Klavierbegleitung. Die Melodie ist einfach und weist – wie bei der Romance üblich[8] – keine melodische Überfrachtung auf. Abgesehen von einer einzigen Stelle im vorletzten Takt (die eine Silbe « sur » verteilt sich auf drei Noten) gibt es in dem Stück keine Melismen und keine rhythmischen oder harmonischen Auffälligkeiten. Zwar unterstreicht ein durch Pausen etwas ›bewegterer‹ Rhythmus vor allem in der ersten Strophe den Text an der Stelle « Comment faire, mon ange, hélas, pour le haïr » und lässt sich eine harmonische Auffälligkeit bei dem Auflösungszeichen über dem Wort « Amour » (erste Strophe, zweites System im Manuskript) feststellen, doch tut dies insgesamt der rhythmischen und harmonischen Einfachheit der Komposition keinen Abbruch.
Mit dem Klavier wählt Pauline Duchambge ein für die Romance neben der Gitarre oder Harfe gängiges Begleitinstrument.[9] Obwohl die Begleitung anspruchsvoller als der Gesangspart ist, hält auch diese sich vom Schwierigkeitsgrad her in Grenzen. Es sind keinerlei Bestrebungen nach Unabhängigkeit der Begleitung festzustellen, vielmehr dient die Begleitung – gattungstypisch – dem Gesang.[10]
Auch auf musikalischer Ebene kommt die Strophenform der Verständlichkeit des Textes entgegen, schließlich lässt angesichts der Wiederholung ab der zweiten Strophe das Interesse an der musikalischen Ausformung bzw. der Melodie nach und der Rezipient lenkt seine Konzentration vornehmlich auf den Text.
Die nur einen Vers (acht Silben) umfassende Identität des jeweiligen Schlussverses der drei Strophen ist auch in musikalischer Hinsicht zu kurz, um von einem Refrain sprechen zu können. Doch setzt Duchambge trotz des Verzichtes auf einen Refrain im eigentlichen Sinne in ihrem Stück kunstvoll akustische Wiedererkennungseffekte ein. So ist die Melodie auf den ersten und letzten Alexandriner (also auf den jeweils ersten und siebten Vers einer jeden Strophe) identisch, wobei auf eine minimale rhythmische Differenz hingewiesen sei: punktierte Achtel plus Sechzehntel im ersten Alexandriner vs. zwei Achtel im zweiten Alexandriner. Allerdings ist dieser melodische Abschnitt immer mit einem anderen Text unterlegt.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass mit A mon ange gardien ein auf Emotionalität abzielendes Stück vorliegt, das sowohl auf der Textebene als auch in der musikalischen Bearbeitung dem Ideal der Einfachheit und Schlichtheit verpflichtet ist. Die Komposition ist intelligent, stellt aber weder an den Sänger noch an den Begleiter allzu hohe Ansprüche und ist somit relativ einfach auszuführen.
3. Die Romance im 18. Jahrhundert
Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei A mon ange gardien um eine Romance. Als musikalische Gattung beschäftigte diese bereits im 18. Jahrhundert die Theoretiker. Vor dem Hintergrund der im zweiten Abschnitt der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Analyse des Stückes von Pauline Duchambge seien hier als Folie die Definitionen der Romance in der Encyclopédie von Diderot und d’Alembert (1765) und aus dem Dictionnaire de musique von Rousseau (1768)angeführt:
Vieille historiette écrite en vers simples, faciles et naturels. La naïveté est le caractère principal de la romance […]. Ce poème se chante et la musique française, lourde et niaise, est, ce me semble, très propre à la romance.[11]
Alte Anekdote, geschrieben in schlichten, einfachen und natürlichen Versen. Die Unbefangenheit ist das Hauptmerkmal der Romance […]. Dieses Gedicht wird gesungen und die französische Musik, die plump und einfältig ist, scheint mir für die Romance sehr geeignet zu sein.
ROMANCE. Air sur lequel on chante un petit poème du même nom, divisé par couplets, duquel le sujet est pour l’ordinaire quelque histoire amoureuse et souvent tragique. Comme la romance doit être inscrite d’un style simple, touchant, et d’un goût un peu antique, l’air doit répondre au caractère des paroles; point d’ornements, rien de maniéré, une mélodie douce, naturelle, champêtre, et qui produise son effet par elle-même, indépendamment de la manière de la chanter […] quelquefois on se retrouve attendri jusqu’aux larmes sans pouvoir dire où est le charme qui a produit cet effet. […] Il ne faut, pour le chant de la romance, qu’ une voix juste, nette, qui prononce bien, et qui chante simplement.[12]
ROMANCE. Weise, nach der man ein kleines Gedicht mit derselben Bezeichnung singt, das in Couplets unterteilt ist und dessen Sujet gewöhnlich irgendeine Liebesgeschichte ist, die oft tragisch verläuft. Da die Romance in einem einfachen, anrührenden und etwas altertümlichen Stil verfasst sein soll, muss die Weise dem Charakter der Worte entsprechen; keine Verzierungen, nichts Manieriertes, eine sanfte, natürliche, ländliche Melodie, die ihre Wirkung aus sich selbst heraus erzielt, unabhängig von der Art, wie sie gesungen wird […] manchmal ist man am Schluss zu Tränen gerührt und vermag aber nicht einmal zu sagen, wo der Reiz zu suchen wäre, der diese Wirkung erzielte. […] Für das Singen einer Romance bedarf es lediglich einer natürlichen, klaren Stimme, die gut ausspricht und einfach nur singt.
Auch wenn diese beiden Definitionen noch aus der Zeit vor der »sentimentalen Salonromanze«[13] stammen, die 1783 mit Giovanni Paolo Martinis Plaisir d’Amour[14] begründet wird und der, wie bereits erwähnt, auch A mon ange gardien noch zuzurechnen ist, sind die wesentlichen Charakteristika der Romance bereits benannt. Rousseau – der übrigens auch selbst Romances komponierte[15] und so aktiv zur Herausbildung des Genres beitrug – hält klar fest, dass sich die Musik (und zwar sowohl die Vertonung als auch die Ausführung) nach dem Gedicht zu richten und sich also diesem unterzuordnen habe. Es geht vor allem darum, Emotionen und das Sujet zu befördern. Der Primat des Textes und des Sujets erklärt auch, warum Rousseau auf die deutliche Aussprache großen Wert legt. In dem eingangs angeführten Zitat aus Flauberts Roman tut dies übrigens auch der Apotheker Homais, der zufällig Zeuge von Léons Darbietung des Ange Gardien wurde, lobt er diesen doch vor allem dafür, dass er alles so deutlich wie ein Schauspieler ausgesprochen habe.
4. Die Romance in Flauberts Madame Bovary
Selbstverständlich ist es problematisch, Romanfiguren als verlässliche Garanten für die Rezeption der Romance heranzuziehen, insbesondere wenn sie, wie in diesem Falle der Apotheker Homais in Flauberts Roman, ironisch gebrochen sind. Ihr in der Immanenz des Romans geäußertes Urteil muss dem des Erzählers (und des Autors) sowie dem der Wissenschaft bzw. Musikwissenschaft gegenübergestellt werden und sich hinsichtlich objektiver Aussagen über die musikalische Gattung der Romance behaupten.
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine zweite Stelle aus Madame Bovary, an der von der Romance die Rede ist. Sie befindet sich im sechsten Kapitel des ersten Teils von Madame Bovary, das rückblickend von der Erziehung der Klosterschülerin Emma handelt. Diese verschlang in ihrer Jugend nicht nur begeistert romantische Lektüren (etwa aus der Feder von Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand oder Walter Scott, um nur einige zu nennen), auch der Musikunterricht bot ihr vielerlei Anregungen:
A la classe de musique, dans les romances qu’elle chantait, il n’était question que de petits anges aux ailes d’or, de madones, de lagunes, de gondoliers, pacifiques compositions qui lui laissaient entrevoir, à travers la niaiserie du style et les imprudences de la note, l’attirante fantasmagorie des réalités sentimentales.[16]
Im Musikunterricht war in den Romances, die sie sang, nur von kleinen Engeln mit goldenen Flügeln, von Madonnen, von Lagunen, von Gondolieri die Rede, friedselige Kompositionen, die sie durch die Albernheit des Stils und die Unzulänglichkeiten der Vertonung das verlockende Wahngebilde der Wirklichkeit der großen Gefühle erahnen ließ.
Während sich in dem zuerst angeführten Zitat aus dem Roman, dem Gespräch zwischen Madame Bovary, Léon und Homais, die Romanfiguren in direkter Rede quasi ›ungefiltert‹ äußerten, ergreift bei der Schilderung des Musikunterrichts Emmas, der späteren Madame Bovary, der Erzähler (der nicht mit dem Autor zu verwechseln ist!) das Wort. Angefangen von der Lexik – hier wird beispielsweise der Gattungsbegriff Romance verwendet und diese ziemlich ›komplex‹ beschrieben – bis hin zu der scharfsinnigen Analyse der Auswirkung des Musikunterrichts auf die Protagonistin entspricht dabei nichts dem Sprechen und Denken Emmas; das vernichtende Urteil des Erzählers über die »alberne« Romance richtet sich noch im selben Satz ironisch ebenso vernichtend gegen die Titelheldin.[17] Denn diese, nach Emotionen lechzend, nimmt unter anderem diese triviale Musikform mit ihren abgedroschenen, kitschigen und klischeehaften Themen (man beachte den Plural bei « anges » – « madones » – « lagunes » – « gondoliers ») zum Vorbild und erkennt darin die Ideale, an denen sie ihr späteres Leben ausrichten wird: ein Unterfangen, das, für den Erzähler wie für den Leser kaum verwunderlich, zwangsläufig zum Scheitern führen muss.
Somit bildet die Stelle über den Musikunterricht aus dem ersten Teil von Madame Bovary die Folie, vor der das Gespräch Emmas mit Léon über die Musik im zweiten Teil gelesen werden muss. Bei diesem Gespräch finden sich zwei Seelenverwandte – und tatsächlich wird diese Begegnung auch bestimmend für das weitere, verhängnisvoll verlaufende Romangeschehen.[18]
Die Tatsache, dass sowohl Emma als auch Léon in der Lage sind, eine Romance zu singen, sei es im privaten Kontext oder dem des Musikunterrichts, kann als Indiz dafür verstanden werden, dass die Romance auch für Laien ohne Schwierigkeiten nachzusingen ist. Tatsächlich stellte die Romance, wie bereits erwähnt, grundsätzlich keine allzu hohen Anforderung an den oder die ›Interpreten‹. Große Ansprüche an die ausführenden Künstler zu stellen, lag übrigens auch Pauline Duchambge fern. Der Komponistin, die selbst Gesangsunterricht gab,
ging es [nämlich] […] nicht darum, Sänger für die Bühne oder die großen Salons auszubilden, sondern die Kunst zu vermitteln, « à chanter simplement, pour le charme intime et pour le timide écho de la maison » [»schlicht zu singen, um den intimen Charme und das schüchterne Echo des Hauses einzufangen«].[19]
Die Bekanntheit der Romance auch in ländlichen Gegenden ist oft gerade Laiensängern zu verdanken, die die Stücke in der Provinz darboten. Und so ist es wenig erstaunlich, dass Léon in der nahe Rouen gelegenen kleinen – fiktiven – Ortschaft Yonville imstande ist, solch eine Romance nachzusingen, und der Apotheker diese auch sofort wiedererkennt. Dies spricht für den hohen Bekanntheitsgrad von A mon ange gardien im Speziellen und der Romance im Allgemeinen.
5. « La musique allemande » – das deutsche Lied
Im eingangs angeführten Zitat aus Madame Bovary kommt die Musik in der Unterhaltung zwischen Madame Bovary, Léon und Homais, wie bereits erwähnt, in mehreren Aspekten zur Sprache. Auf Emmas Frage hin erklärt Léon, ohne die Gattung zu bezeichnen, « la musique allemande, celle qui porte à rêver » – also »die deutsche Musik, die, die einen zum Träumen bringt« – zu seiner Lieblingsmusik.[20] Dass er die Gattung nicht benennen kann, entbehrt nicht der Ironie, wodurch die im Gespräch befindlichen Figuren bloßgestellt werden. Die zur Schau gestellte Kunst- bzw. Musikbeflissenheit Léons findet nämlich nicht eigentlich die ›richtigen‹ Worte, was ein Indiz dafür ist, dass die Begeisterung des jungen Mannes oberflächlich und letztlich dem Halbwissen verhaftet ist. Selbst der « musicien célèbre » bleibt in Léons Diskurs namenlos. Dessen Geste (Klavierspiel vor imposanter Landschaft) ist als eine Äußerung des ungebändigten romantischen Genies zu verstehen und sollte als solche die Einzigartigkeit und Individualität des berühmten Künstlers unterstreichen. Doch die Tatsache, dass dessen Identität nicht gelüftet wird (von Léon nicht gelüftet werden kann?), entlarvt diese ausholende Geste als ein klischeehaftes Versatzstück der (Selbst-?)Inszenierung eines Künstlers, den Léon vor Augen hat und den er womöglich überschätzt. – Léons Gesprächspartnerin Emma scheint nicht aufzufallen, dass die Äußerungen Léons unzulänglich, lückenhaft und somit fast nichtssagend sind. Sie nimmt daran keinen Anstoß, im Gegenteil signalisiert sie durch ihre Einwürfe, dass Léons Rede ihr Interesse geweckt hat. Allerdings sind ihre Nachfragen unqualifiziert und tragen nicht zur Vertiefung des Gegenstandes bei, vielmehr lösen sie – von Emma unbeabsichtigt – komische Effekte aus. So führt sie beispielsweise gerade durch ihre unvermittelte Frage nach Léons musikalischen Aktivitäten (« Vous faites de la musique ? ») einerseits die spektakuläre Geste des großen Künstlers (Pianist) und andererseits die Intimität, in der der Laie Léon sich – vermeintlich unbelauscht – künstlerisch äußert, auf engsten Raum zusammen, was den ohnehin schon vorhandenen komischen inhaltlichen Kontrast der beiden Szenerien noch weiter verschärft.
Gemeint ist mit jener « musique allemande » das deutsche Lied der Romantik, vor allem Franz Schuberts,[21] das seit 1833 in Frankreich zunehmend bekannt wurde. Allein zwischen 1840 und 1850 wurden über 300 deutsche Lieder in Frankreich veröffentlicht.[22] Mit der Verbreitung des deutschen Liedes ging in Frankreich die Erschütterung der Salonmusik einher, untergrub es doch mit seinen neuen Maßstäben die Grundfesten der Romance.[23] So kam der Dramatiker Ernest Legouvé in seinem 1837 in der Revue et Gazette musicale publizierten Artikel Mélodies de Schubert zu der Feststellung: “[Schubert] has killed the French romance”.[24] Allerdings hielten die Befürworter der Romance in der Zeitschrift La France musicale dagegen “that the mélodie[25] will not kill our romance because the French romance also has its value”.[26]
Wie ist diese dramatische Entwicklung zu erklären und welche Folgen zeitigte sie? Was das deutsche Lied gegenüber der in Frankreich so verbreiteten Romance auszeichnete, ist die Bedeutung, die es der Begleitung beimaß. Diese wurde von den Komponisten der Romance so gering geschätzt, dass es durchaus möglich war, darauf sogar völlig zu verzichten und nur die Solostimme einzusetzen. Während also bei der Romance der Text und damit auch der – deklamierende! – Gesang im Mittelpunkt des Interesses steht, geht der Gesang im deutschen Lied, vor allem bei Schubert, mit dem Klavier eine derart enge Symbiose ein, dass Sänger und Pianist fast zu ein und demselben Interpreten verschmelzen, um sinngemäß Schubert über seine Aufführungen mit Vogl zu zitieren,[27] ja die Aufwertung des Klavierparts kann sogar zur Priorität des Instruments gegenüber der Stimme führen.
Dem deutschen Lied wurde in ganz Frankreich – auch in der Provinz[28] – große Bewunderung entgegengebracht, doch übernahmen die Franzosen, so Marie-Claire Beltrando-Patier, diese seine Eigenheiten nicht. Tatsächlich sei nämlich die französische Vokalmusik seit jeher sehr auf das Wort bezogen gewesen, so dass jegliche musikalische Vorgehensweise wie beim deutschen Lied suspekt erscheinen musste. Das Lied, so Marie-Claire Beltrando-Patier weiter, sei in Frankreich also niemals nachgeahmt oder kopiert worden, vielmehr habe es den Wunsch nach etwas anderem ausgelöst, den dann die Mélodie erfüllen sollte.[29]
6. Die Anfänge der Mélodie
6.1. Hector Berlioz
Hector Berlioz war der erste, der eigene Kompositionen mit dem Gattungsbegriff mélodie bezeichnete.[30] Doch sehen moderne französische Musikhistoriker die Verwendung dieses Begriffes hinsichtlich der Kompositionen von Berlioz nicht immer eindeutig gerechtfertigt. So schreibt etwa Marie-Claire Beltrando-Patier:
[Les] caractères propres à la romance constituent […] le fondement du goût français en matière de musique vocale. Les grands mélodistes le savent et restent observateurs d’une intelligibilité parfaite. Pour cette raison, les débuts de la mélodie auront quelque chose de la romance, et il est difficile de dire […] que brusquement, Berlioz a abandonné la romance populaire pour […] la mélodie.[31]
[Die] Merkmale der Romance bilden […] die Grundlagen des französischen Geschmackes hinsichtlich der Vokalmusik. Die großen Komponisten der Mélodie wissen dies und achten auf eine perfekte Verständlichkeit. Aus diesem Grund haben die Anfänge der Mélodie etwas von der Romance an sich, und es lässt sich nicht einfach sagen, dass Berlioz plötzlich die populäre Romance […] zugunsten der Mélodie aufgegeben hat.
Auch Les Nuits d’été (1841) von Berlioz seien nicht eindeutig oder ausschließlich der Gattung der mélodie zuzuordnen, vielmehr bewege sich der Komponist hier zwischen einer legitimen Suche nach Neuem und der Natürlichkeit, die man von einer Romance erwarten könne.[32]
6.2. Louis Niedermeyer – Le Lac
Camille Saint-Saëns sieht in der Einleitung zu Vie d’un compositeur moderne (Paris 1893) Louis Niedermeyer als den ersten Komponisten von Mélodies:
[le premier, Niedermeyer a] brisé le moule de l’antique et fade romance française en s’inspirant de beaux poèmes de Lamartine et de Victor Hugo, et créé un genre nouveau d’un art supérieur, analogue au Lied allemand; le succès retentissant du Lac a frayé le chemin à M. Gounod et à tous ceux qui l’ont suivi dans cette voie.[33]
[Niedermeyer hat als erster] die Form der althergebrachten und faden französischen Romance zerbrochen, indem er sich an schönen Gedichten von Lamartine und Victor Hugo inspirierte, und hat so eine neue Gattung von höherer Kunst geschaffen, die dem deutschen Lied entspricht; der durchschlagende Erfolg von Le Lac hat Herrn Gounod den Weg geebnet, sowie auch all denen, die ihm auf diesem Pfad gefolgt sind.
Tatsächlich wird die Komposition Le Lac von Niedermeyer aus dem Jahr 1821 oder 1825[34] nach einem Text von Lamartine oftmals als der Beginn der mélodie in Frankreich bezeichnet. Doch stellt sich die Frage, ob tatsächlich die Vertonung einer qualitativ besseren Textvorlage (Lamartines Méditations von 1820, aus denen Le Lac stammt, gelten als der Prototyp der frühromantischen Dichtung in Frankreich, Victor Hugo, von dem im Zitat ebenfalls die Rede ist, als einer der größten romantischen Dichter Frankreichs) schon ausreicht, um von einer neuen Gattung der Vokalmusik sprechen zu können, wie es das Zitat von Saint-Saëns suggeriert. Und so spricht der Musikhistoriker Frits Noske Niedermeyer auch die Ehre ab, der Begründer der Mélodie zu sein:
Niedermeyer cannot accurately be called the creator of the mélodie. Basically his songs are still romances, even though distinguished form their dull contemporaries by the superior quality of the text, by structural changes, by a closer relationship between words and music, and by the relative importance of the accompaniment.[35]
Genau genommen kann Niedermeyer nicht als der Schöpfer der mélodie bezeichnet werden. Im Grunde sind seine Lieder noch Romances, auch wenn sie sich von den faden zeitgenössischen Kompositionen durch die höhere Textqualität, Veränderungen der Struktur, eine engere Beziehung zwischen Wort und Musik und durch die relative Bedeutung der Begleitung absetzen.[36]
6.3. Romance vs. mélodie (vs. Lied)
Wo sind also die Grenzen zu ziehen zwischen Romance, Mélodie (und Lied), wie ist deren Verhältnis zueinander? Hierzu ein Zitat von Marie-Claire Beltrando-Patier:
En fait, si romance et mélodie – et même lied, pourrait-on ajouter – répondent à la même définition de poème chanté pour voix soliste, il s’agit de catégories d’art différentes, sans hiérarchie dans les valeurs. La romance se présente comme un produit de grande consommation, répondant au goût bourgeois du début du XIXe siècle. […] [Elle] sera cultivée avec bonheur jusque vers 1870. On peut compter parmi ses chefs-d’œuvre quelques-unes des mélodies du 1er Recueil de Fauré, œuvres déjà très raffinées, voire « fauréennes », comme Mai (1862).
Vers 1870 se developpe la mélodie […]. A la base de ce changement se situe le renouveau poétique créé par les Parnassiens, […] hostile aux épanchements romantiques […].[37]
Obschon sich Romance und Mélodie – und selbst das Lied ließe sich hier einreihen – gleichermaßen als gesungenes Gedicht für Solostimme definieren lassen, handelt es sich dabei in Wirklichkeit doch um unterschiedliche Kunstkategorien (Gattungen), ohne dass diese Unterscheidung mit einer Wertehierarchie einherginge. Die Romance präsentiert sich als ein Produkt für den Massenkonsum, sie entspricht dem bürgerlichen Geschmack zu Beginn des 19. Jahrhunderts. […] [Sie] wird bis um 1870 gepflegt werden und sich großer Beliebtheit erfreuen. Zu ihren Meisterwerken können einige der Mélodies aus der Ersten Sammlung (1er Recueil) von Fauré gezählt werden, dabei sind diese Werke bereits sehr kunstvoll gestaltet, ja sogar Fauré-typisch, wie etwa Mai (1862).
Um 1870 entwickelt sich dann die Mélodie […]. Am Beginn dieser Veränderung steht die Erneuerung der Dichtung durch die Parnassiens, […] die den romantischen Gefühlsergüssen ablehnend gegenüber standen […].
Wo auch immer also die Kritik die Anfänge der mélodie verortet – ob schon bei Niedermeyer um 1820, bei Berlioz zwischen 1830 und 1841, oder erst um 1870, etwa vor dem Hintergrund des neuen Schaffensstils Faurés, wird doch ein Kriterium konstant als ausschlaggebend herangezogen: die Wechselwirkung der Entwicklung auf dem Gebiet der Musik mit der Literatur. Sei es, dass die Wahl des Komponisten auf ›bessere‹ Dichter fällt (beispielsweise bei Niedermeyer: Lamartine, bei Fauré die Abwendung von Hugo und Hinwendung zu Baudelaire), oder ein Neuanfang in der Literatur – nämlich die literarische Strömung der Parnassiens, die in ihrer Dichtung und ihren Theorien um die Jahrhundertmitte die romantische Poesie endgültig hinter sich lassen wollten[38] – letztlich die Komponisten zu musikalischem Experimentieren veranlasste und zur Herausbildung der mélodie führte: Die Entwicklung der Solo-Vokalmusik ist im Frankreich des 19. Jahrhunderts nicht ohne den Einfluss der Literatur zu denken. Der enge Bezug zwischen Entwicklungen in der Literatur und der Vokalmusik ist ein prägendes Phänomen, das sich in Frankreich auch im 20. Jahrhundert intensiv fortsetzen wird. Stellvertretend für viele sei hier Poulenc angeführt, der, neben anderen (auch älteren) Dichtern, vor allem Texte von Apollinaire und Eluard vertonte. Wie eng sich dieser Komponist des 20. Jahrhunderts den beiden mit ihm befreundeten Poeten in seinem Schaffen verbunden und verpflichtet weiß, geht aus seinem 1945 geäußerten Wunsch für die Aufschrift seines Grabsteins hervor:
Si l’on mettait sur ma tombe: « Ci-gît Francis Poulenc, le musicien d’Apollinaire et d’Eluard », il me semble que ce serait mon plus beau titre de gloire.[39]
Wenn auf meinem Grabstein stünde: »Hier ruht Francis Poulenc, der Musiker von Apollinaire und Eluard«, dann wäre dies, so scheint mir, mein schönster Ruhmestitel.
Exkurs:
Emma Bovary in der Oper
Die ausführlichste Thematisierung eines Musikerlebnisses in Madame Bovary stellt die Schilderung eines Opernabends dar, die das gesamte fünfzehnte Kapitel des zweiten Teils des Romans umfasst. Auf dem Programm steht die französische Adaption von Donizettis Lucia di Lammermoor, die Emma in Begleitung ihres Mannes im Theater von Rouen besucht. Wie auch an den anderen Stellen, in denen die Musik eine Rolle spielt, geht es Flaubert hier nicht etwa um eine Auseinandersetzung mit der Kunst eines Donizetti, vielmehr ist die Beschreibung des Opernabends funktional auf die Beobachtung des Verhaltens des Publikums und dabei insbesondere der Reaktionen der Titelheldin und ihres Gatten sowie auf die Ironisierung von Künstler und Kunstbetrieb ausgerichtet.
Die Opernaufführung wird ausschließlich entweder aus der Sicht eines x-beliebigen durchschnittlichen Theaterbesuchers oder aus dem Blickwinkel Emmas und ihres Mannes Charles beschrieben; dem der Oper Donizettis nicht kundigen Leser von Madame Bovary erschließt sich das Werk Donizettis aus der Romanlektüre kaum bis gar nicht. Sehr zum Ärgernis seiner Frau versteht Charles, der fast als eine Karikatur des bürgerlichen Opernpublikums angesehen werden kann, gar nichts von der Opernhandlung (die – nicht nur für ihn – sehr viel mehr im Zentrum des Interesses steht als die Musik), trotzdem findet er zunehmend Gefallen an der Aufführung und will im dritten Akt auf die Frage Léons hin die Vorstellung nicht vorzeitig verlassen:
Ah! pas encore! restons! dit Bovary. Elle a les cheveux dénoués: cela promet d’être tragique.[40]
Ach! noch nicht! Bleiben wir doch noch! sagte Bovary. Ihre Haare haben sich gelöst: sieht so aus, als könnte das noch tragisch werden.
Emma dagegen fühlt sich mit Beginn der Aufführung in die Welt ihrer Jugendlektüren versetzt:
Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott.[41]
Sie fühlte sich in ihre Jugendlektüren zurückversetzt, mitten in Walter Scott.
Da sie Walter Scotts Roman, der als Textvorlage für das Libretto diente, als junges Mädchen gelesen hatte, kann sie der Handlung im Gegensatz zu ihrem Mann mühelos folgen. Ab dem Auftritt des Tenors Lagardy in der Rolle des Edgar parallelisiert sie das Bühnengeschehen mit ihren eigenen Erfahrungen in der Liebe:
Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir.[42]
Sie erkannte ein jedes Gefühl der Trunkenheit und der Angst wieder, an denen sie fast gestorben wäre.
Letztendlich stellt sie die große Diskrepanz zwischen der übergroßen – idealen – Liebe der Opernfiguren und ihrem eigenen enttäuschenden Liebesleben fest:
Mais personne sur la terre ne l’avait aimée d’un pareil amour.[43]
Doch niemand auf der Welt hatte ihr je solch eine Liebe entgegengebracht.
Ohne den Sänger von seiner Rolle zu unterscheiden, phantasiert sie sich in der Folge in eine Liebesbeziehung mit dem Tenor, wobei sich dieses Traumbild für Emma auch schon in Wirklichkeit umzusetzen scheint:
[…] entraînée vers l’homme par l’illusion du personnage, elle tâcha de se figurer sa vie, cette vie retentissante, extraordinaire, splendide, et qu’elle aurait pu mener cependant, si le hasard l’avait voulu. Ils se seraient connus, ils se seraient aimés! Avec lui, par tous les royaumes de l’Europe, elle aurait voyagé de capitale en capitale […]; puis, chaque soir, au fond d’une loge, […] elle eût recueilli, béante, les expansions de cette âme qui n’aurait chanté que pour elle seule; de la scène, tout en jouant, il l’aurait regardée. Mais une folie la saisit: il la regardait, c’est sûr![44]
[…] durch die Illusion der Rolle fühlte sie sich zu diesem Manne hingezogen und versuchte, sich sein Leben vorzustellen, dieses aufsehenerregende, außergewöhnliche, glanzvolle Leben, das auch sie hätte führen können, wenn der Zufall es so gewollt hätte. Sie hätten sich kennengelernt, sie hätten sich geliebt! Mit ihm zusammen wäre sie durch alle Königreiche Europas von Hauptstadt zu Hauptstadt gereist […]; schließlich hätte sie jeden Abend ganz hinten in einer Loge […] mit weit aufgerissenem Mund die Ergüsse dieser Seele, die nur für sie ganz allein gesungen hätte, in sich aufgenommen; von der Bühne aus hätte er sie während des Spiels angeblickt. Doch ein Wahn ergriff sie: er blickte sie an, ja, ganz sicher!
Der von Emma bewunderte und angehimmelte Tenor scheint allerdings offensichtlich nicht nur von ihr überschätzt zu werden und in Wirklichkeit alles andere als ein überragender Künstler zu sein, der noch dazu einen Gutteil seiner künstlerischen Anerkennung beim Publikum seinen Liebesabenteuern verdankt. Dieser Umstand trägt zusätzliche zur Steigerung der Ironisierung der Figur der Emma bei und verleiht ihren Träumen schon fast tragische Züge. Nicht zuletzt wird dabei auch ein kritisch-ironisches Licht auf den Künstler und den Kunstbetrieb der Zeit geworfen:
[…] cette célébrité sentimentale ne laissait pas que de servir à sa réputation artistique. […] Un bel organe, un imperturbable aplomb, plus de tempérament que d’intelligence et plus d’emphase que de lyrisme, achevaient de rehausser cette admirable nature de charlatan, où il y avait du coiffeur et du toréador.[45]
[…] die Berühmtheit, zu der er aufgrund seiner Liebesabenteuer gelangt war, trug beständig zu seinem künstlerischen Ansehen bei. […] Ein schönes Organ, eine unerschütterliche Selbstsicherheit, mehr Temperament als Intelligenz und mehr Emphase als lyrischer Ausdruck rundeten diese bewundernswerte Natur von einem Scharlatan vollends ab, der auch etwas von einem Friseur und von einem Stierkämpfer an sich hatte.
So wie der allseits bewunderte Sänger hier entzaubert wird, klaffen auch Emmas Lebenswirklichkeit und ihre hochfliegenden Träumen auseinander. Anstatt mit dem Star von Hauptstadt und Hauptstadt zu eilen, sitzt sie in Gesellschaft der örtlichen Bourgeoisie im Theater der Provinzhauptstadt Rouen, anstatt mit dem großen Künstler ihrem öden Eheleben zu entfliehen, begegnet sie im Theater zufällig Léon wieder, der nunmehr in Rouen lebt und mit dem sie in der Folge eine Liebesbeziehung eingehen wird. Durch das Zusammentreffen mit Léon in der Pause zwischen dem zweiten und dritten Akt verliert sie auch vollständig das Interesse am Bühnengeschehen:
[…] elle n’écouta plus […] tout passa pour elle dans l’éloignement […][46]
[…] sie hörte nicht mehr hin […] alles war für sie mit einem Mal entrückt […]
Ihre Phantasien über ein Leben mit dem Tenor werden völlig verdrängt von der Erinnerung an ihre erste Liebe zu Léon, « tout ce pauvre amour si calme et si long, si discret, si tendre »[47] (»diese ganze arme Liebe, die so ruhig und so lang, so diskret, so zärtlich gewesen war«), so dass sie schließlich, dem Vorschlag Léons folgend, in dessen und ihres Mannes Begleitung die Aufführung, die sie gerade noch so hochfliegend hatte träumen lassen, vorzeitig – noch vor dem dramatischen und musikalischen Höhepunkt der Oper, der Wahnsinnsarie Lucias! – verlässt.
Nachweise und Anmerkungen
[1] Gustave Flaubert, Madame Bovary. Mœurs de Province, hrsg. von Claudine Gothot-Mersch, Paris: Garnier 1971, S. 84f.
[2] Graham Johnson und Richard Stokes, A French Song Companion, New York: Oxford University Press 2000, S. 134.
[3] Unabhängig davon, ob die Untersuchungen zur Romance das gesamte 18. Jahrhundert wesentlich einbeziehen, herrscht insgesamt in der Kritik Einhelligkeit darüber, dass Martinis Plaisir d’Amour (1783) einen Meilenstein in der Geschichte der Romance darstellt. Diese Komposition ist in den Worten Gstreins der Auftakt für das Genre der »sentimentalen Salonromanze, die in den folgenden Jahrzehnten das Bild des frz. Salonliedes prägen sollte.« (Rainer Gstrein, Die vokale « romance française » im 18. Jahrhundert, in: Zur Entwicklung, Verbreitung und Ausführung vokaler Kammermusik im 18. Jahrhundert: XXII. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 10. bis 12. Juni 1994, hrsg. von Bert Sigmund, Michaelstein: Stiftung Kloster Michaelstein 1997 (Michaelsteiner Konferenzberichte 51), S. 128). Erst ab 1833 geriet diese in Krise, als das deutsche Lied in Frankreich zunehmend bekannt wurde (Marie-Claire Beltrando-Patier, Romance, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 562; vgl. hierzu auch Abschnitt 5. dieser Untersuchung). Zur zeitlichen Eingrenzung der Romance siehe auch die Standardwerke Frits Noske, French Song from Berlioz to Duparc, übers. von Rita Benton, New York: Dover Publications 1970, Neuauflage 2012; Henri Gougelot, La Romance française sous la Révolution et l’Empire, Melun: Legrand et Fils 1937; Roger Hickman, Romance, in: Grove Music Online (www.oxfordmusiconline.com).
[4] Vgl. Herbert Schneider, Duchambge, in: MGG2P, Bd. 5, Sp. 1495. Der Text dieser Romance wird von der weiterführenden Literatur irrtümlicherweise immer wieder der mit Pauline Duchambge eng befreundeten und von ihr häufig vertonten Dichterin Marceline Desbordes-Valmore zugeschrieben(vgl. beispielsweise Christian Goubault, La musique et les lettres au XIXe siècle, in: Histoire de la France littéraire, Bd. 3, hrsg. von Patrick Berthier und Michel Jarrety, Paris: PUF 2006, 32009, S. 561). Diese hat auch tatsächlich ein Gedicht mit dem Titel L’ange gardien (!) verfasst, allerdings wurde dieses Gedicht nicht vertont. Bei der Vertonung des aus unbekannter Feder stammenden Textes wirkte aber eine Dichterin an der Seite Pauline Duchambges mit, nämlich Amable Tastu (vgl.Johnson/Stokes,S. 134f.). Hinter dem Pseudonym verbirgt sich Sabine Casimire Amable Voïart (1798–1885).
[5] Nach dem Digitalisat auf http://archive.org/details/monangegardien830duch.
[6] Claudia Schweitzer, Pauline Duchambge (http://mugi.hfmt-hamburg.de/A_lexartikel/lexartikel.php?id=duch1776).
[7] Zu weiteren typischen Sujets in der Romance siehe Gougelot, S. 24–88. Er unterscheidet folgende Romance-Typen nach inhaltlichen Aspekten: Romances historiques – pastorales – sentimentales (historische – pastorale – sentimentale Romances). Ferner differenziert er die Romances nach ihrer Darbietung in Romances narratives – dramatiques – lyriques (narrative – dramatische – lyrische Romances).
[8] Zu den Gattungsmerkmalen siehe z. B. Beltrando-Patier, Romance, S. 559.
[9] Vgl. Hickman.
[10] Beltrando-Patier, Romance, S. 559.
[11] Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d’Alembert: Romance, in: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (online über http://fr.wikisource.org).
[12] Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique (online über http://www.imslp.org).
[13] Gstrein, S. 128,vgl. auch Anm. 3.
[14] Text: Jean-Pierre Claris de Florian.
[15] Beispielsweise in Le devin du village (Intermède, 1752); hier wird der Begriff Romance (die Romance des Colin, achte Szene, Textanfang: « Dans ma cabane obscure ») erstmals als Liedtitel verwendet (vgl. Gstrein, S. 126). Rousseaus Komposition wurde richtungweisend für die Romance als charakteristischem Bestandteil der Opéra Comique.
[16] Flaubert, S. 39.
[17] Zu Ironiestrategien in der Literatur allgemein und bei Flaubert im Besonderen siehe die Forschungsarbeiten von Rainer Warning: Ironiesignale und ironische Solidarisierung, in: Das Komische, hrsg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning (Poetik und Hermeneutik, Bd. 7), München: Fink 1976, S. 416–423; Ders., Die Phantasie der Realisten, München, Fink 1999, S. 150–184.
[18] In diesem Kontext empfiehlt sich ein kurzer Exkurs zum Begriff Bovarysme, der auch hinsichtlich der Grobstruktur der Romanhandlung aufschlussreich ist. Beim Bovarysme handelt es sich um das nach Flauberts Titelheldin Madame Bovary benannte Motiv des Scheiterns im und Zerbrechens am realen Leben, zu dem es kommt, weil – wie prototypisch in Flauberts Roman dargestellt – Emma an das reale Leben die Maßstäbe anlegt, die sie durch eine überaktive träumerische Einbildungskraft anhand von (romantischen) Lektüre- und anderen ›Kunst‹-Erlebnissen ausgebildet hat. So sind ihre Anforderungen an das reale Leben, das sie mit ihrem unbedeutenden und langweiligen Mann in der Provinz führt, einfach zu hoch; aus Enttäuschung über ihr unausgefülltes Dasein unternimmt sie mehrere Ausbruchsversuche (unter anderem die Liebesaffaire mit Léon). Schließlich endet sie im Selbstmord. Der Begriff geht auf den französischen Philosophen Jules de Gaultier (1858–1942) zurück und findet zur Beschreibung des Handlungsmusters auch bei anderen literarischen Werken Verwendung.
[19] Le Ménestrel, 6. Juni 1858, S. 3, zitiert in Schneider, Sp. 1493.
[20] Kurz darauf kommen Emma und Léon noch auf ein weiteres musikalisches Interessensgebiet zu sprechen: mit der von Emma lapidar als « les Italiens » – »die Italiener« – bezeichneten Musik ist die Gattung der italienischen Oper gemeint. Im Gegensatz zu Romance und Mélodie kann man diese in der Abgeschiedenheit der Provinz (Yonville) unmöglich rezipieren, daher stellt sich hier auch zunächst eher die Frage des Kennens (« Connaissez-vous […] » – »Kennen Sie […]«) als die nach musikalischen Vorlieben. Nicht zuletzt zielt somit Emmas Frage indirekt auch auf die Mobilität und eventuelle soziale Kontakte Léons zur Großstadt ab, nach der sie selbst sich vom Land fortsehnt. – Die italienische Oper feierte im Paris der Zeit, in der Madame Bovary spielt, große Erfolge, einige Opern aus der Feder renommierter italienischer Komponisten (Rossini, Bellini, Donizetti) wurden dort sogar uraufgeführt. Die Opernstoffe entsprachen dem Geschmack Emmas, stammten sie doch beispielsweise von Walter Scott, dessen Werke sie neben anderen in ihrer Jugend verschlungen hatte. Zum Zeitpunkt dieses Gespräches mit Léon war sie selbst allerdings noch nicht in den Genuss eines Opernbesuches in Paris gekommen. Erst sehr viel später im Fortgang des Romans wird sie einer Aufführung der französischen Adaption von Donizettis Lucia di Lammermoor beiwohnen, allerdings nicht in Paris, sondern in der Provinzstadt Rouen (siehe den Exkurs am Ende des Textes).
[21] Auf der romaninternen, inhaltlichen Ebene trifft Léon mit der Präzisierung, »die einen zum Träumen bringt«, ganz den Geschmack der sich nach großen Gefühlen sehnenden Emma Bovary, und gibt sich nicht zuletzt mit diesem Ausdruck als ihr Seelenverwandter zu erkennen. – Darüber hinaus geht jenseits der Immanenz des Romans aus einem Eintrag Flauberts in sein Dictionnaire des Idées reçues hervor, dass er die Deutschen allgemein für »ein Volk von (alten) Träumern hält« (« Allemands : peuple de Rêveurs (vieux) », zitiert in Flaubert, Madame Bovary, S. 456, Anm. 46). Dieses Attribut zielt auf die Romantik deutscher Prägung, als eine deren künstlerischer Ausdrucksformen Schuberts Musik, vor allem sein Liedschaffen, gilt. – Flauberts Roman Madame Bovary ist als Abrechnung mit der Romantik zu lesen, dennoch hat der Autor in seiner Korrespondenz mit befreundeten Schriftstellern immer wieder (und dies durchaus auch selbstironisch) betont, dass er selbst sich der Romantik verpflichtet weiß. Flauberts Verhältnis zur Romantik bleibt also letztlich widersprüchlich.
[22] Vgl. Noske, S. 25ff., und Beltrando-Patier, Romance, S. 562f. Besondere Erwähnung verdient hier der Tenor Adolphe Nourrit, der mit seinen Liederabenden und Übersetzungen der Liedtexte Schuberts wesentlich dazu beitrug, Schubert in ganz Frankreich bekannt zu machen. – Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Entstehungszeit von Madame Bovary. Flaubert hat fünf Jahre, von 1851 bis 1856, intensiv an diesem Stoff gearbeitet, bevor er den Roman ein erstes Mal 1856 in der Zeitschrift Revue de Paris veröffentlichte. Der Text bedeutete einen Skandal, es kam zum Prozess. Aus diesem ging Flaubert als Sieger hervor, und so konnte der Roman 1857 unzensiert in vollem Umfang als Buch erscheinen.
[23] Noske, S. 34.
[24] Zitiert – in englischer Übersetzung – in Noske, S. 34. Vgl. auch Noske, S. 415, Anm. 91 und 85. Ernest Legouvé war mit Berlioz befreundet und arbeitete auch mit diesem zusammen (vgl. Gérard Condé, Hector Berlioz, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 45); so basiert beispielsweise die Komposition La Mort d’Ophélie auf einem Text von Legouvé nach William Shakespeare.
[25] Mit mélodie ist hier das Lied Schuberts gemeint, nicht die Gattung der französischen mélodie. Das Lied Schuberts und seiner Nachfolger bezeichnet man im Französischen heute mit dem deutschen Begriff le lied.
[26] Zitiert – in englischer Übersetzung – in Noske, S. 34.
[27] Zitiert in Beltrando-Patier, Romance, S. 562.
[28] Nourrit gab seine Konzerte auch in der Provinz und macht so das deutsche Lied über die Hauptstadt hinaus bekannt. Vgl. Noske, S. 27ff.
[29] « Le Français apprécie sans la faire sienne cette dernière proposition [de donner la priorité à l’instrument sur la voix]. Il y a en effet dans la musique vocale française une constante référence au verbal qui rend suspecte toute opération musicale de type lied. Le lied ne sera donc jamais imité ou copié, mais déclenchera un désir d’autre chose, que la mélodie viendra combler » (Beltrando-Patier, Romance, S. 563). – »Ohne es sich selbst anzueignen, schätzt der Franzose letzteres [einem Instrument gegenüber der Stimme den Vorzug zu geben]. Es gibt nämlich in der französischen Vokalmusik einen ständigen Bezug zum wortsprachlichen Ausdruck, was jegliche musikalische Operation wie beim Lied verdächtig erscheinen lässt. Das Lied wird also niemals imitiert oder nachgeahmt werden, vielmehr sollte es das Verlangen nach etwas anderem auslösen, das dann die Mélodie einlösen wird.«
[30] Neuf mélodies / imitées de l’anglais (Irish Melodies) / pour une ou deux voix, et chœur / avec acompagnement de piano lautete 1830 der ursprüngliche Titel, den Berlioz später (1849) zu Irlande mit dem Untertitel Neuf mélodies verkürzte (vgl. Condé, S. 47,und Pierre Bernac, The interpretation of French song, übers. von Winifred Radford, London: Kahn & Averill 1997, Nachdruck 2005, S. xiii).
[31] Beltrando-Patier, Romance, S. 560.
[32] Vgl. Condé, S. 45. Noske reiht Berlioz unter die mélodistes ein, allerdings unterteilt er kurioserweise das Mélodie-Œuvre Berlioz in folgende Kategorien: “1. The youthful romances and the Mélodies irlandaises […]. 2. The […] pieces written between 1830 and 1838, and the collection Les nuits d’été, composed about 1840. The evolution from romance to mélodie occurred during this time. 3. The last songs” (Noske, S. 93).
[33] Camille Saint-Saëns, Vie d’un compositeur moderne, Paris 1893, zitiert in Marie-Claire Beltrando-Patier, Louis Niedermeyer, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 476. Diese Stelle wird – gekürzt – auch in Goubault, S. 561, und – in voller Länge auf Englisch – in Noske, S. 12 angeführt.
[34] Die Angaben hinsichtlich des Entstehungsjahrs der Komposition sind widersprüchlich: So wird die Komposition in David Tunley, Romantic French Song 1830–1870, Bd. 1, hrsg. von David Tunley, New York, London: Garland 1994, S. xxviiauf das Jahr 1821datiert; bei Beltrando-Patierdagegen auf 1825 (Beltrando-Patier, Louis Niedermeyer, S. 476).
[35] Noske, S. 12.
[36] Übersetzung aus dem Englischen: Elisabeth Sasso-Fruth.
[37] Marie-Claire Beltrando-Patier, Gabriel Fauré, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 212f.
[38] Der romantischen Gefühlbetontheit (« émotions ») stellten die Parnassiens ihr Ideal der « impassibilité » (Ungerührtheit) gegenüber.
[39] Claire Delamarche, Francis Poulenc, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 488.
[40] Flaubert, S. 233.
[41] Ebd., S. 228.
[42] Ebd., S. 229.
[43] Ebd.
[44] Ebd., S. 231f.
[45] Ebd., S. 229.
[46] Ebd., S. 233.
[47] Ebd.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Beltrando-Patier, Marie-Claire: Romance, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 558–565.
Dies.: Louis Niedermeyer, in: ebd., S. 476–477.
Dies.: Gabriel Fauré, in: ebd., S. 211–230.
Bernac, Pierre: The interpretation of French song, übers. von Winifred Radford, London: Kahn & Averill 1997, Nachdruck 2005.
Condé, Gérard: Hector Berlioz, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 44–53.
Delamarche, Claire: Francis Poulenc, in: ebd., S. 488–503.
Diderot, Denis, und Jean Baptiste le Rond d’Alembert: Romance, in: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Bd. 14, Paris 1751: http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/Volume_14# ROMANCE.
Duchambge, Pauline: A mon ange gardien: http://archive.org/details/monangegardien830duch.
Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Mœurs de Province, hrsg. von Claudine Gothot-Mersch, Paris: Garnier 1971.
Goubault, Christian: La musique et les lettres au XIXe siècle, in: Histoire de la France littéraire, Bd. III, hrsg. von Patrick Berthier und Michel Jarrety, Paris: PUF 2006, 32009, S. 555–569.
Gougelot, Henri: La Romance française sous la Révolution et l’Empire, Melun: Legrand et Fils 1937.
Gstrein, Rainer: Die vokale « romance française » im 18. Jahrhundert, in: Zur Entwicklung, Verbreitung und Ausführung vokaler Kammermusik im 18. Jahrhundert: XXII. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 10. bis 12. Juni 1994, hrsg. von Bert Sigmund, Michaelstein: Stiftung Kloster Michaelstein 1997 (Michaelsteiner Konferenzberichte 51), S. 125–129.
Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994.
Hickman, Roger: Romance, in: Grove Music Online: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/23725?q=Romance&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit.
Johnson, Graham, und Richard Stokes: A French Song Companion, New York: Oxford University Press 2000, S. 134f.
Noske, Frits: French Song from Berlioz to Duparc, übers. von Rita Benton, New York: Dover Publications 1970, Neuauflage 2012.
Perrin, Jean-François: Cordes sensibles: la mélodie du penseur, in: Le Magazine Littéraire (Nr. 514), Dezember 2011, S. 64f.
Rousseau, Jean-Jacques: Dictionnaire de musique, Paris: Duchesne 1768: http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP72006-PMLP144356-Dictionnaire_de_musique__1768_.pdf.
Schneider, Herbert: Duchambge, in: MGG2P, Bd. 5, Sp. 1492–1495.
Schweitzer, Claudia: Pauline Duchambge: http://mugi.hfmt-hamburg.de/A_lexartikel/lexartikel.php?id=duch1776.
Starobinski, Jean: Rousseau – Eine Welt von Widerständen, übers. von Ulrich Raulff, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 133–137.
Tunley, David: Romantic French Song 1830–1870, Bd. 1, hrsg. von David Tunley, New York, London: Garland 1994.
Warning, Rainer: Ironiesignale und ironische Solidarisierung, in: Das Komische, hrsg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning, München: Fink 1976 (Poetik und Hermeneutik 7), S. 416–423.
Ders.: Die Phantasie der Realisten, München, Fink 1999.
August Bungert: Vorwort zu „Nausikaa“ (1885)
Im Jahre 1885 veröffentlichte August Bungert im Verlag von Friedrich Luckhardt die Erstfassung eines Librettos seiner Tetralogie „Homerische Welt“. Er wählte „Nausikaa“ als Ausgangspunkt, von dem aus sich das Konzept allerdings in den nächsten Jahren wesentlich verschieben sollte. Als die Tetralogie von 1896 bis 1903 in Dresden, Berlin und Hamburg über die Bühnen ging, handelte der erste Teil von Kirke, der zweite von Nausikaa, der dritte von Odysseus’ Heimkehr und der vierte von Odysseus’ Tod, den Homer gar nicht schilderte. Auch in der Ideenwelt hatte sich seit 1885 viel verändert; aus der Betonung des Lebens als Leiden und der Kunst als Tröstung wurde nach Bungerts Bekanntschaft mit Friedrich Nietzsche eine immer stärkere Akzentuierung des aktiven, handelnden Menschen und der selbstständigen Gestaltung des eigenen Geschicks.
Zur Einführung
Es giebt ein Wort, das so alt ist wie die Welt. Alle dahingegangenen Völker kannten und alle bestehenden Völker kennen dieses Wort. In ihren Religionen ist es niedergelegt oder es haben uns das Wort ihre Dichter und ihre Philosophen in ihren Werken ausgesprochen. In den verschiedensten Weisen ward es und wird es gesungen. Im einfachen Volksliede wie im höchsten Kunstgedicht klingt uns das Wort entgegen. Am Abend eines stillen, eingeschränkten Lebens ertönt das herbe Wort und am Ende des prometheischen Ringens eines jeglichen Helden, eines jeglichen Uebermenschen vernehmen wir es. – Dieses alte orphische Urwort heißt: „Entsagen!“ Das Wort „Entsagen“ ist der Grundgedanke unseres Daseins – es ist das Ende vom Lebensliede. Das Höchste, was der Mensch erreichen kann, ist als Heros, entsagend, au diesem Leben zu scheiden! Kein Erdenwanderer bringt es weiter, als, nach übermenschlichem Ringen und Kämpfen, ausgesöhnt mit dem mühevollen, kurzen Dasein, mit Lächeln ohne Bitterkeit auf den Lippen, verscheidend, stammeln zu können: „Ich entsage!“ Dieses Wort, das mit jedem Schritt, den wir weiter thun auf dieser Lebensbahn, uns lauter und vernehmlicher tönt, macht uns reifer, stiller und mahnt uns zu bedenken, daß Leben Sterben ist.
Wo aber ist der Lethebecher, aus dem die müde Seele Vergessen trinken kann und uns alle Qual des Daseins entfernen? – Die Kunst ist der Becher. Aus diesem Becher trinken wir jegliches Lebens-Leid fort.
Das echte Kunstwerk bietet uns das Menschenleben, oder Episoden desselben, von jenem geklärten, hohen Standpunkte aus gesehen, wo nur die bedeutungsvollen Fäden, welche die Handlung, d. h. den symbolischen Grundgedanken des Kunstwerkes bilden, licht und klar uns entgegenleuchten. Aus diesen Fäden, einem Liniensystem gleich, bauen sich die ethischen Akkorde auf, die, mögen sie nun herb oder milde klingen, doch Musik sind, und unsere Seele klärend berühren. Unsere Seele wird mit dem Dichter hellsehend – hellhörend – entrückt im Lande der Kunst. Wie vergessen in solcher Anschauung, unter dem Banne des Kunstwerkes stehend, das eigene Leid, weil wir auch dieses nun von jenem geklärten, hohen, einzig wahren Standpunkte des Weltgeistes aus ansehen und empfinden!
Das schöne erquickende der Kunst ist eben der klingende göttliche Akkord, den der Dichter, sein Kunstwerk schaffend, gehört hat, nun uns in diesem enthüllt! –
Der Grundgedanke des vorliegenden Werkes ist: die Entsagung. Es ist also dasselbe alte Lied, das in dem größten Werk unseres größten Dichters, im Faust ertönt: „Entbehren sollst du, sollst entbehren!“
Das Ideal des griechischen Helden ist neben Achilleus vor allen Odysseus. Sein Leben heißt: Kämpfen – genießen – leiden! Er ist der unermüdliche Kämpfer – der nie ermüdende Genießende – der erhabene Dulder! Kurz vor dem Ende seiner Laufbahn tritt ihm im Phäakenlande, Nausikaa die Mädchenblume entgegen. Neuer Kampf – neues Leid! Aber zugleich, und dieses habe ich in meiner Dichtung besonders betont, ist ihm das Phäakenland auch das Land der Kunst; hier hört er seine eigenen Thaten bereits durch den Mund des Sängers verherrlicht. – Die ganze Art, wie auch Homer, am Schluß seiner Irrfahrten Odysseus noch nach Phäakenland gelangen läßt, die Schilderung des Volkes, dessen Freude und Lust am Dasein, seine Pflege und Verehrung des Schönen; dann die Art und Weise, wie Odysseus Nachts von diesem Traumlande schlafend fortgefahren wird, um Morgens endlich in seiner Heimat Ithaka zu landen – all dieses hat bei Homer einen eigenen, bei ihm ganz einzig dastehenden, beinahe phantastischen Zug. Wie ein Lethebecher ist dem Helden, nach dieser Seite hin, der Aufenthalt im Phäakenland –, wie ein Becher der Erquickung vor dem letzten Kampf gegen die Freier in der Heimat! –
Und nun Nausikaa! In der Odyssee im 7. und 13. Gesange bringt Homer wenigstens äußerlich nicht das Tragische der Gestalt zum Austrag. Es war dies aus vielen Gründen im Epos nicht am Platze. Das Verhältnis zur Nausikaa mußte und konnte nur vorübergehend dargestellt werden; denn es handelt sich vor allem um die Heimkehr des Odysseus. Dem Epiker genügte hier das Tragische nur anzudeuten. Daß der Dramatiker durchaus anders den Stoff anfassen mußte, ist natürlich. Auf Nausikaa’s Gestalt ruht, nachdem sie den Helden gesehen, der ganze Zauber, der bei Tag und Sonne, voll und stolz aufblühenden Rose – und bei Odysseus Abschied – steht sie da, wie die arme Blume, auf die der Reif der Frühlingsnacht gefallen ist! – –
*
Bezüglich der Betonung Nāūsika und Nausikaá statt der bisher durchweg gebräuchlichen bin ich theilweise derselben Ansicht wie Jordan, der in seiner neuen Uebersetzung des Homer auch Folgendes sagt: „Aus irrthümlicher Analogie mit Nausīthoos hat man bisher den Namen Nausīkaa ausgesprochen. Da der Name mit dieser Aussprache unschön klingt und das griechische Nausikaá in unserm lediglich accentuierenden Hexameter unmöglich ist, bin ich für die Aussprache Nāūsika.“
In der freien Strophe der Musik-Tragödie in keiner Weise jenem Zwange unterworfen, hab’ ich beides, sowol Nausikaá wie Nāūsika gebraucht.
Daß es lange Zeit ein Lieblingsgedanke Goethes gewesen ist, seine Nausikaa zu schreiben, daß er in Palermo am Strande wandelnd eine Skizze entwarf, die allerdings nur sehr dürftig ist, ist aus seiner Italienischen Reise bekannt. Dieses war am 16. April 1787; also vor beinahe 100 Jahren. Die nach einem späteren Entwurf ausgeführten Nausikaa-Szenen sind aus seinen Werken bekannt.
Sophokles soll eine Nausikaa geschrieben haben. Es ist uns aber leider nichts übrig geblieben; von den Scholastikern wird nur der Titel mitgetheilt.
Noch will ich hinzufügen, daß diese Nausikaa der dritte Theil, d. h. der III. Abend meiner Tetralogie „Homerische Welt“ ist.
Der erste Abend betitelt sich: Achilleus und Helena, mit dem Vorspiel: das Opfer der Iphigenie in Aulis.
Der zweite Abend: Orestes und Klytemnestra.
Der dritte Abend: Nausikaa.
Der vierte Abend: Odysseus Heimkehr.
Da indeß ein jedes Drama für sich allein besteht, so gehe ich einstweilen nicht darauf ein, den Grundgedanken des ganzen Werkes, wie auch der einzelnen anderen Abende hier näher zu entwickeln. Das Erscheinen des ganzen Werkes wird in nicht ferner Zeit erfolgen.
Pegli bei Genua, 14. März 1885.
August Bungert.
[Transkription: Christoph Hust]
Cäcilien-Vereins-Katalog
Als Zwischenschritt zum Projekt der HMT einer Datenbank zu den Cäcilien-Vereins-Katalogen können wir Ihnen hier Scans der ersten Einträge dieses Katalogs präsentieren. Sie finden diese Scans auf der Homepage des Instituts für Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Theater Leipzig auch als OCR-erfasste PDF-Dokumente.
Joseph Joachim Raff als Kompositionslehrer
Im Jahre 1864 unterrichtete Joseph Joachim Raff, mittlerweile aus Weimar nach Wiesbaden übergesiedelt, seine Privatschülerin Marie Rehsener (später machte sie nicht als Musikerin Karriere, sondern als Scherenschnittkünstlerin). Der umfangreich dokumentierte Kurs führte von Generalbass- und Kontrapunktübungen bis zu einfachen Satzmodellen. Eingebettet sind zwei kleinere musiktheoretische Traktate von Raff. Sie finden hier die gesamte Quellen (teils in Mitschriften von Rehsener, teils in Manuskripten von Raff) in digitalen Versionen. In der nächsten Zeit sollen auch einige „Highlights“ transkribiert werden. – Die Originale sind in Privatbesitz; Anfragen zur Reproduktion bitte an christoph.hust@gmx.de.