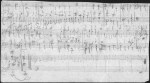Startseite » 2013 » Oktober
Archiv für den Monat Oktober 2013
August Bungert: Vorwort zu „Nausikaa“ (1885)
Im Jahre 1885 veröffentlichte August Bungert im Verlag von Friedrich Luckhardt die Erstfassung eines Librettos seiner Tetralogie „Homerische Welt“. Er wählte „Nausikaa“ als Ausgangspunkt, von dem aus sich das Konzept allerdings in den nächsten Jahren wesentlich verschieben sollte. Als die Tetralogie von 1896 bis 1903 in Dresden, Berlin und Hamburg über die Bühnen ging, handelte der erste Teil von Kirke, der zweite von Nausikaa, der dritte von Odysseus’ Heimkehr und der vierte von Odysseus’ Tod, den Homer gar nicht schilderte. Auch in der Ideenwelt hatte sich seit 1885 viel verändert; aus der Betonung des Lebens als Leiden und der Kunst als Tröstung wurde nach Bungerts Bekanntschaft mit Friedrich Nietzsche eine immer stärkere Akzentuierung des aktiven, handelnden Menschen und der selbstständigen Gestaltung des eigenen Geschicks.
Zur Einführung
Es giebt ein Wort, das so alt ist wie die Welt. Alle dahingegangenen Völker kannten und alle bestehenden Völker kennen dieses Wort. In ihren Religionen ist es niedergelegt oder es haben uns das Wort ihre Dichter und ihre Philosophen in ihren Werken ausgesprochen. In den verschiedensten Weisen ward es und wird es gesungen. Im einfachen Volksliede wie im höchsten Kunstgedicht klingt uns das Wort entgegen. Am Abend eines stillen, eingeschränkten Lebens ertönt das herbe Wort und am Ende des prometheischen Ringens eines jeglichen Helden, eines jeglichen Uebermenschen vernehmen wir es. – Dieses alte orphische Urwort heißt: „Entsagen!“ Das Wort „Entsagen“ ist der Grundgedanke unseres Daseins – es ist das Ende vom Lebensliede. Das Höchste, was der Mensch erreichen kann, ist als Heros, entsagend, au diesem Leben zu scheiden! Kein Erdenwanderer bringt es weiter, als, nach übermenschlichem Ringen und Kämpfen, ausgesöhnt mit dem mühevollen, kurzen Dasein, mit Lächeln ohne Bitterkeit auf den Lippen, verscheidend, stammeln zu können: „Ich entsage!“ Dieses Wort, das mit jedem Schritt, den wir weiter thun auf dieser Lebensbahn, uns lauter und vernehmlicher tönt, macht uns reifer, stiller und mahnt uns zu bedenken, daß Leben Sterben ist.
Wo aber ist der Lethebecher, aus dem die müde Seele Vergessen trinken kann und uns alle Qual des Daseins entfernen? – Die Kunst ist der Becher. Aus diesem Becher trinken wir jegliches Lebens-Leid fort.
Das echte Kunstwerk bietet uns das Menschenleben, oder Episoden desselben, von jenem geklärten, hohen Standpunkte aus gesehen, wo nur die bedeutungsvollen Fäden, welche die Handlung, d. h. den symbolischen Grundgedanken des Kunstwerkes bilden, licht und klar uns entgegenleuchten. Aus diesen Fäden, einem Liniensystem gleich, bauen sich die ethischen Akkorde auf, die, mögen sie nun herb oder milde klingen, doch Musik sind, und unsere Seele klärend berühren. Unsere Seele wird mit dem Dichter hellsehend – hellhörend – entrückt im Lande der Kunst. Wie vergessen in solcher Anschauung, unter dem Banne des Kunstwerkes stehend, das eigene Leid, weil wir auch dieses nun von jenem geklärten, hohen, einzig wahren Standpunkte des Weltgeistes aus ansehen und empfinden!
Das schöne erquickende der Kunst ist eben der klingende göttliche Akkord, den der Dichter, sein Kunstwerk schaffend, gehört hat, nun uns in diesem enthüllt! –
Der Grundgedanke des vorliegenden Werkes ist: die Entsagung. Es ist also dasselbe alte Lied, das in dem größten Werk unseres größten Dichters, im Faust ertönt: „Entbehren sollst du, sollst entbehren!“
Das Ideal des griechischen Helden ist neben Achilleus vor allen Odysseus. Sein Leben heißt: Kämpfen – genießen – leiden! Er ist der unermüdliche Kämpfer – der nie ermüdende Genießende – der erhabene Dulder! Kurz vor dem Ende seiner Laufbahn tritt ihm im Phäakenlande, Nausikaa die Mädchenblume entgegen. Neuer Kampf – neues Leid! Aber zugleich, und dieses habe ich in meiner Dichtung besonders betont, ist ihm das Phäakenland auch das Land der Kunst; hier hört er seine eigenen Thaten bereits durch den Mund des Sängers verherrlicht. – Die ganze Art, wie auch Homer, am Schluß seiner Irrfahrten Odysseus noch nach Phäakenland gelangen läßt, die Schilderung des Volkes, dessen Freude und Lust am Dasein, seine Pflege und Verehrung des Schönen; dann die Art und Weise, wie Odysseus Nachts von diesem Traumlande schlafend fortgefahren wird, um Morgens endlich in seiner Heimat Ithaka zu landen – all dieses hat bei Homer einen eigenen, bei ihm ganz einzig dastehenden, beinahe phantastischen Zug. Wie ein Lethebecher ist dem Helden, nach dieser Seite hin, der Aufenthalt im Phäakenland –, wie ein Becher der Erquickung vor dem letzten Kampf gegen die Freier in der Heimat! –
Und nun Nausikaa! In der Odyssee im 7. und 13. Gesange bringt Homer wenigstens äußerlich nicht das Tragische der Gestalt zum Austrag. Es war dies aus vielen Gründen im Epos nicht am Platze. Das Verhältnis zur Nausikaa mußte und konnte nur vorübergehend dargestellt werden; denn es handelt sich vor allem um die Heimkehr des Odysseus. Dem Epiker genügte hier das Tragische nur anzudeuten. Daß der Dramatiker durchaus anders den Stoff anfassen mußte, ist natürlich. Auf Nausikaa’s Gestalt ruht, nachdem sie den Helden gesehen, der ganze Zauber, der bei Tag und Sonne, voll und stolz aufblühenden Rose – und bei Odysseus Abschied – steht sie da, wie die arme Blume, auf die der Reif der Frühlingsnacht gefallen ist! – –
*
Bezüglich der Betonung Nāūsika und Nausikaá statt der bisher durchweg gebräuchlichen bin ich theilweise derselben Ansicht wie Jordan, der in seiner neuen Uebersetzung des Homer auch Folgendes sagt: „Aus irrthümlicher Analogie mit Nausīthoos hat man bisher den Namen Nausīkaa ausgesprochen. Da der Name mit dieser Aussprache unschön klingt und das griechische Nausikaá in unserm lediglich accentuierenden Hexameter unmöglich ist, bin ich für die Aussprache Nāūsika.“
In der freien Strophe der Musik-Tragödie in keiner Weise jenem Zwange unterworfen, hab’ ich beides, sowol Nausikaá wie Nāūsika gebraucht.
Daß es lange Zeit ein Lieblingsgedanke Goethes gewesen ist, seine Nausikaa zu schreiben, daß er in Palermo am Strande wandelnd eine Skizze entwarf, die allerdings nur sehr dürftig ist, ist aus seiner Italienischen Reise bekannt. Dieses war am 16. April 1787; also vor beinahe 100 Jahren. Die nach einem späteren Entwurf ausgeführten Nausikaa-Szenen sind aus seinen Werken bekannt.
Sophokles soll eine Nausikaa geschrieben haben. Es ist uns aber leider nichts übrig geblieben; von den Scholastikern wird nur der Titel mitgetheilt.
Noch will ich hinzufügen, daß diese Nausikaa der dritte Theil, d. h. der III. Abend meiner Tetralogie „Homerische Welt“ ist.
Der erste Abend betitelt sich: Achilleus und Helena, mit dem Vorspiel: das Opfer der Iphigenie in Aulis.
Der zweite Abend: Orestes und Klytemnestra.
Der dritte Abend: Nausikaa.
Der vierte Abend: Odysseus Heimkehr.
Da indeß ein jedes Drama für sich allein besteht, so gehe ich einstweilen nicht darauf ein, den Grundgedanken des ganzen Werkes, wie auch der einzelnen anderen Abende hier näher zu entwickeln. Das Erscheinen des ganzen Werkes wird in nicht ferner Zeit erfolgen.
Pegli bei Genua, 14. März 1885.
August Bungert.
[Transkription: Christoph Hust]
Cäcilien-Vereins-Katalog
Als Zwischenschritt zum Projekt der HMT einer Datenbank zu den Cäcilien-Vereins-Katalogen können wir Ihnen hier Scans der ersten Einträge dieses Katalogs präsentieren. Sie finden diese Scans auf der Homepage des Instituts für Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Theater Leipzig auch als OCR-erfasste PDF-Dokumente.
Joseph Joachim Raff als Kompositionslehrer
Im Jahre 1864 unterrichtete Joseph Joachim Raff, mittlerweile aus Weimar nach Wiesbaden übergesiedelt, seine Privatschülerin Marie Rehsener (später machte sie nicht als Musikerin Karriere, sondern als Scherenschnittkünstlerin). Der umfangreich dokumentierte Kurs führte von Generalbass- und Kontrapunktübungen bis zu einfachen Satzmodellen. Eingebettet sind zwei kleinere musiktheoretische Traktate von Raff. Sie finden hier die gesamte Quellen (teils in Mitschriften von Rehsener, teils in Manuskripten von Raff) in digitalen Versionen. In der nächsten Zeit sollen auch einige „Highlights“ transkribiert werden. – Die Originale sind in Privatbesitz; Anfragen zur Reproduktion bitte an christoph.hust@gmx.de.
August Bungert: Einführung zur „Faust“-Bühnenmusik (1903)
Nach den Aufführungen seiner Tetralogie „Homerische Welt“ wandte sich August Bungert sofort neuen Aufgaben zu. Vor dem Mysterium op. 60, einem Oratorium für Soli, Chor und Orchester, war Goethes „Faust“ sein erstes neues Projekt. Mit Bungerts Bühnenmusik wurde „Faust“ zur Tetralogie und zu einem postwagnerianischen „Bühnenweihespiel“, wie der Komponist es im umfangreichen Vorwort des Klavierauszugs darlegte.
Zur Einführung.
Im Auftrage des Rheinischen Goethe-Vereins, unter dem Protektorat Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen des deutschen Reiches und dem Vorsitze Sr. Excellenz des Ministers H. von Rheinbaben, frug im Februar dieses Jahres Max Grube, der Oberregisseur des Königl. Schauspielhauses zu Berlin, bei mir an, ob ich Zeit und Muße finden würde, bis zu Ende Mai eine neue Musik zu Goethe’s Faust zu komponieren.
Da ich eben mein Lebenswerk, die Musiktetralogie: Die Odyssee abgeschlossen hatte und längst der Plan in mir ruhte, an eine solche Arbeit heranzutreten, ohne daß indes eine Note dazu geschrieben war, so übernahm ich mit Freude und glühendster Begeisterung die Aufgabe.
In unbeschreiblicher Erregung wurde in etwa 7–8 Wochen die ganze Musik skizziert, Tag und Nacht daran geschrieben und bis zum festgesetzten Termin im Mai war die Instrumentation in der Hauptsache vollendet, die Klavierauszüge liefen in Korrekturabzügen bei den Proben ein, die Orchester- und Chorstimmen folgten bis in die letzten Tage vor den Erstaufführungen am 5., 6. und 7. Juli. [Anm. von Bungert: Allerdings rief die Überanstrengung der Augen eine starke lang andauernde Entzündung hervor.]
Manches konnte aus verschiedenen scenarisch-technischen Gründen nicht zur Aufführung kommen, doch im Ganzen wurde das Werk in 3 Abenden unter der Rollenbesetzung bedeutendster schauspielerischer Kräfte von Berlin und andern Hauptstädten Deutschlands in der von Max Grube eingerichteten Lesart, mit herrlichen Dekorationen von Georg Hacker, unter der vorzüglichen Leitung des Kapellmeister Fröhlig aufgeführt und fand in den 4maligen Cyklen der 3 Abende den begeistertsten Beifall des Publikums, das jeden Abend das Theater bis auf den letzten Platz gefüllt hatte. –
Einige Einführungsworte zu vorliegender Faust-Musik mögen gestattet sein.
Der I. Teil des Faust begann nach Vorausgang einer breiten Horn- und Trompeten-Fanfare mit dem Vorspiel auf dem Theater. Dann folgte das Ganze in der Original-Lesart bis zum Schluß mit einigen Strichen in der Walpurgisnacht; die Kürzungen mußten wegen mangelhaften scenischen Apparates stattfinden. Die Aufführung dauerte 6 Stunden, sodaß die Idee entstand, bei späteren Aufführungen den I. Teil auf 2 Abende zu verteilen; dann natürlich in breitester Weise die Walpurgisnacht zu bringen und zwar so, daß der 1. Abend mit der Hexenküche schließt und das Gretchen-Drama den 2. Abend bilden würde, während der II. Teil (auch in 2 Abende zerfallend), im 3. Abend mit der „Peneiosscene“ (Chiron, Faust, Manto) schloß, und dann im 4. Abend mit der Helena-Tragödie beginnend, bis zum Schluß des Werkes mit einigen Umstellungen und Strichen wieder möglichst die Goethesche Dichtung intakt ließ.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist das Werk, wie vorliegend, anzusehen.
Durch die Einteilung des I. Teiles in 2 Abende ist es möglich, die einzelnen, oft sehr kurzen Scenen durch musikalische Zwischenspiele, die die vorhergehende Scene ausklingen lassen und in die folgende stimmungegemäß überleiten, zu verbinden. Es wird dadurch, abgesehen von der so erleichterten Verwandlung der Decoration, möglich sein, im Gemüt des Zuschauers die früher gesehene Handlung sich vertiefen zu lassen, und ihn halb traumhaft auf der Musikwelle in die Stimmung der folgenden Scene hinüberzutragen, sein Empfindungsvermögen von neuem spannend, ihn empfänglich zu machen, die Poesie der herrlichen Sprache ganz und voll zu genießen und in sich aufzunehmen.
Grade also eine ruhige, statt einer überhasteten Verwandlung der Scene, (wie dieses letztere bisher der Fall war), dürfte das Richtige sein; eine Musiküberleitung als Brücke von einer zur andern Scene, stets dem Inhalt beider Scenen gemäß. Man sehe sich als Beispiele die Gartenscene und Gartenhäuschenscene an; darauf folgend Wald und Höhle, Gretchen am Spinnrad, in Marthen’s Garten, Gretchen und Lieschen am Brunnen, Gretchen vor der Mater dolorosa, Zwinger und Valentinscene u. s. w.
Es sei nun hier gleich bemerkt, daß bei der Komposition, wie z. B. des Liedes: Gretchen am Spinnrad, der König in Thule, u. s. w. die idealste Besetzung gedacht ist, und daß nach Möglichkeit jeder Bühne den vorhandenen Darstellern gemäß sich einrichten wird.
Daß Goethe das ganze Werk gewissermaßen in Musik getaucht sich gedacht hat, geht aus unzähligen Stellen auf das evidenteste hervor. Auch stimmen darin wol sämtliche Kommentare überein. Sagt doch sogar der Dichter im II. Teil in der Euphorionscene: „Von hier an mit vollstimmiger Musik!“ [Anm. von Bungert: Wie gewaltig diese Scene in vorliegender Form wirkte, ersehe man aus den Berichten.] Er wünscht hier (und nun gar im Schlußakt des Werkes!) tatsächlich die Form der Oper. Des Näheren darauf einzugehen und dieses zu beweisen mag einem besonderen Aufsatz vorbehalten sein.
Es möchte, nebenbei bemerkt, in der ganzen dramatischen Litteratur kaum eine Gestalt geben, wo, wie bei der des Euphorion, in der Reihenfolge von Stimmungen und Scenen, das gesprochene Wort der innern Erregung gemäß so natürlich in das gesungene Wort übergeht; wo das Wort so zur Melodie sich gestaltet, gleichsam wie selbstverständlich; und wo ebenso natürlich und von sich selbst ergebend das gesungene Wort wieder in das gesprochene zurücktreten kann.
Man mag aus den kritischen Stimmen lesen, bis zu welcher gewaltigen, ergreifenden Wirkung sich dieser Akt in den Düsseldorfer Festaufführungen aufbaute.
Zum ersten Male findet man hier auch die 4teiligen Chöre am Schluß der Helena-Tragödie komponiert, beginnend mit dem Chore „Zurückgegeben sind wir dem Tageslicht“. Goethe hat zweifellos die Scene hier, nach dem erschütternden Akt, als ein Satyrspiel ähnliches Ausklingen sich gedacht. Daß bei richtiger glänzender Ausführung dieser Schluß bei Gesang und bacchantischem Tanz von grandioser Wirkung sein würde, ist zweifellos. Soll doch „an Prospekten und an Maschienen, an groß[en] und kleinen Himmelslichtern, Sternen, an Wasser, Feuern, Felsenwänden, an Tier und Vögeln nicht gespart werden – um mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle zu schreiten.“
Ganz verkehrt aber erscheint es, die obigen Chöre in den wundervollen Poesie-Worten sprechen und dann mit etwa 16 Takten Musik, die die Scene musikalisch illustriert, jämmerlich nachhumpeln zu lassen. Dann ist es schon richtiger und dramatisch gewaltig wirksamer, gleich mit den Worten der Helena oder des Phorkias „Wir sehn uns wieder, weit gar weit von hier“, zu schließen.
In den überall eingestreuten Liedern galt es, (natürlich immer mit Berücksichtigung auf den darzustellenden Charakter und auch der betreffenden Situation), vor allen Dingen den Volkston zu treffen, den Goethe, wie auch Shakespeare in den eingelegten Liedern beabsichtigt hat [Anm. von Bungert: Daß Goethe im Lemurengesang einen andern Vers des Totengräberlieds im Hamlet (ein altes Volkslied) aufnahm, darf als bekannt vorausgesetzt werden.]. –
Wie weit nun das melodramatische Element im vorliegenden Material benutzt wird, steht dahin. Als Grundsatz stellte sich der Tondichter die Aufgabe, durchweg das Übersinnliche, Geheimnisvolle, das Spukhafte, Fantastische, das Erhabene, vielfach auch das Dämonische mit Musik zu begleiten; es wird natürlich ganz von der Regie eines jeglichen Theaters abhängen, das sich eignende aus der vorhandenen Fülle zu bringen oder auszulassen; ebenso mag an der Hand der Regie und des Kapellmeisters oft die Komposition einer Stelle (möglichst leise gespielt) melodramatisch benutzt werden.
Auf den ersten Blick wird man sehen, daß (und wol zum ersten Mal) die melodramatischen Stellen sämtlich so im Auszug eingetragen sind, daß zu jeder Zeile, ja bis aufs Wort, genau die Musik, Takt für Takt angegeben ist. Da ebenso genau der Text der Dichtung in die Partitur eingetragen ist, bleibt dem Darsteller durchaus seine völlige Freiheit eines hier und da rascheren Tempos; es liegt in der Hand des Dirigenten, dem Darsteller bis in die kleinsten Abtönungen des Ausdrucks, leicht und ihm sich schmiegend, zu folgen, seine Worte und Gebärden zu illustrieren, zu tragen und noch zu haben [Anm. von Bungert: In den Düsseldorfer Festspielen erreichte dieses Kapellmeister Fröhlig in vorzüglicher Weise.].
Es wird zuträglich sein, das Orchester nach Notwendigkeit, der Akustik des Saales gemäß, teilweise zu decken.
Im Übrigen wird das Studium des Auszuges, mit der Partitur zur Hand und bei der Vertiefung in die Dichtung alles andere ergeben.
Nur über die Besetzung der Engel im Prolog im Himmel durch männliche Darsteller noch einige Worte [Anm. von Bungert: Hierüber wird demnächst ein größerer Aufsatz vom Verfasser erscheinen.].
Die bisherige Besetzung der Engel durch Frauenstimmen erscheint ein großer Irrtum. Die drei Gestalten sind hier gewissermaßen die Verkörperung der Gott untergebenen Naturgewalten, wie auch (trotz der Anschauung der Geschlechtslosigkeit der Engel) durch ihre Namen es angedeutet ist. In den darauf bezüglichen Bibelstellen ist durchaus nicht von der Weiblichkeit der Gestalten die Rede. Es sind hier gewissermaßen die dem Throne des höchsten Herrschers der Welten unterstellten Fürstenengel (s. v. w.), sie sind seinem Throne nahegestellt, sind Ausübende seiner Macht; sie entstammen nicht der Region der himmlischen Heerscharen, von denen Mephisto sagt „die Racker sind doch gar zu appetitlich.“ So dachte sich der Verfasser dieselben etwa auf das Schwert gestützt und gewappnet. Gesprochen erscheinen die unvergleichlichen Worte, von der Scene und Situation abgesehen, ohnehin schon zu gewaltig und breit, um auch nur annähernd ihrer Bedeutung gemäß Wirkung zu geben [Anm. von Bungert: Übrigens fand meine Auffassung auch in Düsseldorf die volle Zustimmung und den Beifall der Maler Jensen, Gebhard, Achenbach u. s. w.].
Daß durchweg in der Musik die Benutzung des Leitmotiv’s herrscht, daß dadurch viele Scenen eine eindringlichere Wirkung erreichen konnten, sei dem Urteil der aufmerksamen Zuhörer überlassen.
So wurde z. B. der Ostergesang als Motiv mehrfach angewandt, in der Beschwörung des Pudels im Studierzimmer [Anm. von Bungert: „Kannst du ihn lesen? / Den nie Ausgesprochenen.“] und insbesondere in der Schlußscene, da die Worte des Mephisto: „Sie ist gerichtet!“ und der Stimme von oben „Ist gerettet!“ als Gegensatz erklingend, gesprochen fast zu rasch und nicht eindringlich genug erscheinen dürften. Hier erschien die Benutzung des Ostergesanges des Chor’s der Engel:
„Christ ist erstanden!
Freude dem Sterblichen,
Den die verderblichen
Schleichenden, erblichen
Mängel umwandeln!“
als Unterlage für die Worte Gretchens:
„Dein bin ich Vater! Rette mich!
Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen!“
mit dem Gedanken also des Opfertodes des Heilands für die sündige, reuige Menschheit, bei Gretchens Rettung, geradezu geboten. Abgesehen davon, daß dadurch im Werke, auch insbesondere in Goethe’schem Sinne glücklich „Anfang und Ende sich in Eins zusammenziehen“. Es lag nahe, daß das melodramatische Motiv zu den Worten im I. Teil:
„Werd’ ich zum Augenblicke sagen
Verweile doch, du bist schön!“
dasselbe sein mußte im II. Teil zu den Worten:
„Zum Augenblicke dürft’ ich sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!“
Als interessante, durch die Leitmotive glücklich zusammengestellte, in Parallele gebrachte Scenen seien erwähnt die Raubscene (II. Teil) des Habebald und Eilebeute in des Kaisers Zelt und die des Erzbischofs mit dem Kaiser; wo dasselbe Leitmotiv in der Verlängerung in pathetischer Fassung erscheint.
Daß die Hälfte des V. Aktes des II. Teiles ganz für Musik gedacht ist, wer wollte das verkennen!
Bisher wurden die Worte des Mephisto mehr oder weniger mit Musik unterstrichen, d. h. es wurde versucht, seine Worte durch Musik noch teuflischer im Ausdruck zu machen und dennoch war es logisch hier, vom umgekehrten Standpunkt auszugehen, da er doch meistens während der ewig-rein aus himmlischer Sphäre erklingenden Engelschöre, dann sich ihm nahend, und ihn täuschend, spricht und daß gerade dadurch, während der reinen keuschen Gesänge, des Teufels Sprache und niedrig klingendes Organ am stärksten in Gegensatz dazu treten wird.
Die Schlußscene der ganzen Tragödie, ist in zwei Lesarten komponiert. De eine wird mit dem Chorus mysticus schließen, wie angegeben. Die andere Lesart bringt nach Schließung des Vorhanges den Gedanken zur Ausführung, daß das Publikum sich erhebt und die letzten Worte des Chorus, gleichsam als Bestätigung, als Bejahung des Gesehenen, Gehörten, Erlebten, singend wiederholt. Fast möchte es nach diesem Schauspiel ohnegleichen, nach dieser Menschheitstragödie psychologisch den Zuschauern als Bedürfniss erscheinen, gleichsam als antiker Chor die Worte des Chores zu wiederholen. Goethes Faust wird in dieser Form einer Tetralogie stets mehr oder weniger ein Festspiel, ein Bühnenweihespiel bleiben, während jeder Abend, einzeln aufgeführt, die Leistungsfähigkeit eines guten Theaters nicht übersteigt.
Düsseldorf, Juli 1903.
Aug. Bungert.
[Transkription: Christoph Hust]
Johanna Steinborn: „Christoph Schaffrath und die Triosonate“
Johanna Steinborn (Bamberg / Leipzig)
Christoph Schaffrath und die Triosonate:
Ästhetik, Kompositionstechnik und Rezeption
Leben und Werk des preußischen Komponisten Christoph Schaffrath stellen trotz der in den letzten Jahren erfolgten Wissenszuwächse noch immer eine Forschungslücke dar (vgl. Hartmut Grosch, Christoph Schaffrath – Cembalist, Komponist, Lehrmeister, in: Die Rheinsberger Hofkapelle von Friedrich II., Musiker auf dem Weg zum Berliner „Capell-Bedienten“, hrsg. von Ulrike Liedtke, Rheinsberg 2005, sowie Reinhard Oestreichs Vorwort zu seinem Verzeichnis der Werke Christoph Schaffraths, Beeskow 2012, S. 7–16). Wenig ist über die Biographie des langjährigen musikalischen Untergebenen Friedrichs II. bekannt, und weite Teile seines handschriftlich überlieferten Œuvres harren noch der Erschließung. Der vorliegende Beitrag soll ein neues Detail zur Schaffrath-Forschung ergänzen und an einem Beispiel nach dem Verhältnis von Kompositionstechnik und Gattungsästhetik zur Mitte des 18. Jahrhunderts fragen. Die erst seit kurzem edierte Triosonate g-Moll für Oboe, Violine und Basso continuo CSW:E:18 macht exemplarisch deutlich, wie Schaffrath seine Musik in der Relation zu zeitgenössischen, streng kontrapunktischen Kompositionsprinzipien verortete (die Edition, hrsg. von Bernhard Päuler, ist bei Aurea Amadeus unter der Nummer 265 erschienen). Dies kann zwei miteinander verbundene Fragen klären. Erstens erhellt es, wie eng Theorie und Praxis in der Berliner Musikkultur des 18. Jahrhunderts miteinander verbunden waren, die in der öffentlichen Wahrnehmung bekanntlich nicht zuletzt aus der Überblendung dieser Bereiche definiert war. Zweitens lassen sich an diesem Beispiel Gründe dafür aufzeigen, weshalb Schaffrath, zu seiner Zeit immerhin einer der namhaftetesten Musiker Berlins, im späteren Musikleben so weitgehend vergessen wurde.
Schaffraths kompositorisches Schaffen umfasste ausschließlich Instrumentalwerke. Sie reichen in der Besetzung von Solosonaten bis zum Konzert. Die Trios bildeten darunter wahrscheinlich den größten Teil der einstmals schriftlich fixierten Kompositionen. Heute sind jedoch nur noch sieben Sonaten für verschiedene Holzbläser- und Streichinstrumentenensembles erhalten. Selbst unter diesen sieben Sonaten kann Schaffraths Autorenschaft nicht immer zweifelsfrei angenommen werden. Oestreich vermutet aufgrund zeitgenössischer Werkverzeichnisse die Existenz von ehemals 60 bis 80 Trios (Verzeichnis der Werke Christoph Schaffraths, siehe oben, S. 23). Dass sich die Triosonate in ihrer Besetzung mit zwei Oberstimmen und Basso continuo in Berlin großer Beliebtheit erfreute, zeigen neben Schaffraths Werken auch die fast aller seiner Berliner Kollegen: In so gut wie jedem Werkverzeichnis von Komponisten aus diesem kulturellen Kontext finden sich Trios, wenn auch meist in geringerer Anzahl als bei Schaffrath vermutet (beispielsweise bei Johann Gottlieb Graun, Carl Heinrich Graun oder Johann Joachim Quantz).
Grundlage der vorliegenden Untersuchung ist Schaffraths Trio CSW:E:18, D-B AmB 495/II. Grundsätzlich sind einige Autographen und Abschriften von Schaffrath seit 2006 datiert, so auch eine Abschrift dieser Komposition in der Sammlung Thulemeier (Tobias Schwinger, Die Musikaliensammlung Thulemeier und die Berliner Musiküberlieferung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (ortus studien 3), Beeskow 2012). Demnach wäre das Trio vermutlich in den 1750er Jahren (zwischen „vor 1751“ und ca. 1760) entstanden. Zu dieser Zeit war Schaffrath bereits von seiner Position als Hofcembalist Friedrichs II. an den Hof der Prinzessin Anna Amalia gewechselt. Wie ihr Bruder war auch sie eine begeisterte Musikerin. Als Dienstherrin mehrerer Musiker nahm sie auf die Geschmacksbildung Einfluss und förderte eine Schreibart, die – vor allem außerhalb Berlins – zu dieser Zeit eigentlich schon anachronistisch erschien (ebd., S. 3). Sicherlich wurde sie darin von ihrem Lehrer Johann Philipp Kirnberger und seinem Beharren auf der streng kontrapunktischen Satzlehre bestärkt (ebd., S. 86f.). Nach diesem tradierten Regelwerk stellten die Vorherrschaft des Basses über der Melodie und die Regelgerechtigkeit des Satzes die Weichen zur Vollkommenheit eines Stückes. Dass zur gleichen Zeit anderswo schon andere Modelle diskutiert wurden, nahm Kirnberger durchaus wahr, verstand dies jedoch als den Gegensatz zweier Schreibarten:
„Jene strenge Schreibart wird vornämlich in der Kirchenmusik […] gebraucht; diese [die „freye oder leichtere Schreibart“] aber ist vornehmlich der Schaubühne und den Concerten eigen, wo man mehr die Ergötzung des Gehörs, als die Erweckung ernsthafter oder feyerlicher Empfindungen zur Absicht hat. Sie wird deswegen insgemein die galante Schreibart genennt, und man gestattet ihr verschiedene zierliche Ausschweiffungen, und mancherley Abweichung von den Regeln.“ (Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Berlin 1771–1779, hrsg. von Gregor Herzfeld, Kassel 2004, S. 80.)
Zu Schaffraths Stellung im Berliner Musikleben
Grundsätzlich gliedert Schaffraths Œuvre sich fast nahtlos in das Raster seines Berliner Umfelds ein. Obwohl über seine Ausbildung fast nichts bekannt ist, lässt auch die vorliegende Triosonate im Speziellen seine Verpflichtung zur kontrapunktischen Tradition erkennen. Es sei dahingestellt, ob man Gerhard Poppes These folgen möchte, Schaffrath sei Schüler Jan Dismas Zelenkas gewesen (Gerhard Poppe, Die Schüler des Jan Dismas Zelenka, in: Musikkonzepte – Konzepte der Musikwissenschaft. Bericht über den Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung Halle (Saale) 1998, hrsg. von Kathrin Eberl und Wolfgang Ruf, Kassel 2000, Bd. 2, S. 292f.) und stünde damit direkt in der Tradition der traditionellen Kontrapunktlehre nach Johann Joseph Fux – auf jeden Fall reflektiert sein Werk diese Art der gediegenen Ausbildung, auch wenn er sich neueren Stilelementen und ungewöhnlichen melodischen Wendungen nicht grundsätzlich verschloss.
Vor allem als Mitglied des Ruppiner und später Rheinsberger Hofmusikensembles des Kronprinzen Friedrich II. hatte Schaffrath an aktuellen musikalischen Experimenten teil. Neue Besetzungsvarianten wurden ebenso erprobt wie die moderne Spielart des Solokonzerts (in seinem Fall: des Cembalokonzerts) und rezente Stilmittel (Hartmut Grosch, Christoph Schaffrath. Komponist – Cembalist – Lehrmeister, in: Die Rheinsberger Hofkapelle von Friedrich II. Musiker auf dem Weg zum Capell-Bedienten, hrsg. Ulrike Liedtke, Rheinsberg 2005, S. 217). Dabei war diese Musikpraxis alles andere als regional engstirnig. Viele Musiker dieser beiden Vorläufer der späteren königlich-preußischen Hofkapelle waren weit gereist und reisten auch zur Zeit ihrer Tätigkeit für Friedrich II. noch. Zudem ließ Friedrich sich Musik aus dem Ausland schicken (Sabine Henze-Döhring, Friedrich der Große. Musiker und Monarch, München 2012, S. 30), informierte sich also durchaus über die musikalischen Entwicklungen außerhalb Preußens, und ließ im begrenzten Rahmen einen Austausch mit anderen regionalen Musiksprachen zu.
Schaffrath war auf musikpraktischem und -theoretischem Gebiet vielfältig aktiv. Zeitgenössische Dokumente nennen ihn als engagierten, gründlichen Lehrer. Ausdruck dafür ist noch der ihm gewidmete Artikel in Gerbers Tonkünstlerlexikon:
„Schafrath […] ist einer unserer würdigsten Contrapunktisten gewesen. Mehrere der merkwürdigsten Komponisten, Virtuosen und Sänger, welche in diesem Buch vorkommen, waren seine Schüler. Überdies hat er auch verschiedene schöne und so gründliche Kompositionen, als man sie von einem Schafrath erwarten konnte, hinterlassen.“ (GerberATL, Bd. 2, S. 404.)
Das Zitat zeigt deutlich: Als Lehrer genoss Schaffrath noch zu Gerbers Zeit einen hervorragenden Ruf. Neben einer erheblichen Anzahl an heute unbekannteren Musikern hatte er auch einige Berühmtheiten seiner Zeit unterrichtet. Seinen Kompositionen wird in der Generation nach ihm dagegen schon weniger enthusiastische als vielmehr pflichtbewusste Anerkennung gezollt; sie galten lediglich als „gründlich“ und korrekt, mehr lehrreich intendiert denn inspirierend.
Zusätzlich zu dieser kompositorischen und pädagogischen Arbeit war Schaffrath sein ganzes Leben lang als Cembalist tätig. Im Einklang mit Berliner Idealen widmete er sich wenigstens sporadisch auch der musiktheoretischen Schriftstellerei; überliefert ist das Manuskript einer unvollendeten Kompositionslehre (Theorie und Praxis der Musik, D-B AMB 605/6). Schaffraths in der Summe herausgehobene Position und übergeordnete Funktion im Kreise der Hofmusiker belegt vor allem seine Lehrtätigkeit; auf König Friedrichs Wunsch unterrichtete er einige andere Kapellmitglieder ebenso wie manche Sänger. Durch seine frühere Tätigkeit in der Kapelle Augusts des Starken war er ebenso bewandert in italienischer Gesangsdiminution. (Der damals sehr berühmte Kastraten-Sopran Felice Samnini erhielt bei Schaffrath Unterricht. Hiller äußert sich darüber folgendermaßen: „Samnini war es gelungen, auf seine wohlbekannte, bewegende Weise, das Adagio mit schönen und wohlüberlegten Verzierungen zu singen. Dabei kam ihm zugute, daß er sich bestens in den Grundharmonien auskannte und daß er bei Schaffrath studiert hatte“ (zitiert nach Grosch, Christoph Schaffrath, in: Die Rheinsberger Hofkapelle, siehe oben, S. 222).) Schaffrath war also kein einfaches Capell-Mitglied, sondern ein Mentor und umfassend informierter musikalischer Ausbilder für viele der Musiker. Da Friedrich II. selbst diesen Unterricht anwies, kann dessen Bedeutung gar nicht hoch genug geschätzt werden. Der Monarch selbst erkannte Schaffrath demnach in der Musik als einen Kollegen an, der es würdig war, ihn in dieser pädagogischen Mission zu vertreten.
1741 wechselte Schaffrath von der Position als erster Cembalist der königlichen Hofkapelle an den Hof der Prinzessin Anna Amalia. Seine dortige Tätigkeit als Kammermusiker scheint eher nebenberuflicher Natur gewesen zu sein, da sich bislang keine Gehaltsnachweise finden ließen (Christoph Henzel, Agricola und andere, in: Jahrbuch des staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, hrsg. von Günther Wagner, Stuttgart 2003, S. 56). Der Brotberuf hingegen war wohl seine Lehrtätigkeit. Anna Amalia allerdings erhielt keinen Unterricht von ihm; sie hatte Kirnberger als Lehrer gewählt. Mit ihm teilte Schaffrath sich auch die Aufgabe, sich um die Bibliothek seiner Dienstherrin zu kümmern, in die nach seinem Tod auch seine eigene Musikaliensammlung eingegliedert wurde (Renate Blechschmidt, Die Amalien-Bibliothek, Berlin 1965, S. 25).
Schaffraths Trio g-Moll vor dem Hintergrund der Gattungsästhetik
Zeitzeugnisse belegen zur Genüge, dass Schaffrath als Komponist zu seinen Lebzeiten – anders als in der posthumen Rezeption – nicht nur bekannt, sondern auch geschätzt war (Grosch, Christoph Schaffrath, in: Die Rheinsberger Hofkapelle, siehe oben, S. 217). Nur ein Beispiel unter vielen ist der ihm geltende Artikel bei Ledebur, der den „Kammermusikus der Prinzessin Amalie v. Pr. zu Berlin, Geb. 1709 zu Hohenstein bei Dresden“, als „tüchtige[n] Contrapunktist[en] und […] beliebte[n] Lehrer“ ausweist (Tonkünstler-Lexicon Berlins, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, hrsg. von Karl Freiherr von Ledebur, Berlin 1861, S. 498). Trotzdem scheint eine Vorbildwirkung nicht so sehr wahrgenommen worden zu sein wie zum Beispiel bei Carl Heinrich Graun, dessen Kompositionen oft und mit großem Aufwand aufgeführt wurden – hervorgehoben sei vor allem sein Passionsoratorium Der Tod Jesu (Christoph Henzel, Das Konzertleben der preußischen Hauptstadt 1740–1786 im Spiegel der Berliner Presse (Teil I), in: Jahrbuch des staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, hrsg. von Günther Wagner, Mainz 2004, S. 216–291). In der Berichterstattung der Berliner Presse existiert aus den Jahren 1740 bis 1768 dagegen kein einziger Nachweis, in dem Schaffrath als Komponist eines aufgeführten Stückes namentlich erwähnt würde (ebd.). Ein Grund dafür könnte sein, dass bis heute innerhalb seines Œuvres keine Vokalkompositionen bekannt sind, denen durch eine Aufführung in Kirche oder Oper ein größeres Publikum vergönnt gewesen wäre. Sein instrumentalkompositorisches Schaffen betraf im wahrsten Sinne des Wortes „Kammermusik“ für einen intimen Rahmen und sperrte sich der öffentlichen und in der Folge medialen Wirksamkeit.
Das Trio in g-Moll soll nun in diesen hier nur in Umrissen skizzierten Rahmen eingebettet werden. Zu diesem Zweck wird eingangs eine Gattungsästhetik der Triosonate auf der Grundlage der Schriften von Johann Georg Sulzer, Johann Joachim Quantz und Heinrich Christoph Koch rekapituliert, also zweier Berliner und eines mitteldeutschen Musikschriftstellers der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
In Sulzers Allgemeiner Theorie der Schönen Künste aus dem Jahr 1771 stehen einige bemerkenswerte Sätze über die Kammermusik und ihren sowohl kompositionsgeschichtlichen als auch sozialen Ort. Sie werde demnach eher für Kenner zur Übung ihrer Fähigkeiten und Liebhaber mit geschulten Ohren als für Laien gemacht, und ihr Stil müsse sich folglich durch Reinheit des Satzes, durch Feinheit im Ausdruck und durch kunstvollere Wendungen auszeichnen als die Musik in der Kirche oder der Oper (Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Bd. 1, Leipzig 1771, S. 189). Gewissermaßen als Königsdisziplin der Komposition ist bei Sulzer in diesem Zusammenhang sodann die Triosonate angeführt. Gute Kammertriokompositionen werden (im Gegensatz zum formal und musikalisch strengeren Kirchentrio) als „leidenschaftliches Gespräch unter gleichen, oder gegeneinander abstechenden Charakteren in Tönen“ charakterisiert. Die größere formale Freiheit sollte der Komponist nutzen, um Abwechslung zu schaffen: Lockere Imitationen, überraschende Einsätze, aber auch korrekt angebrachte Kadenzen und muntere Zwischensätze sollten in ihrer Gesamtheit zu einem individuellen Charakterbild jedes einzelnen Triosatzes trotz der uniformen Gattungsästhetik beitragen. Höchste Erwartungen stellt Sulzer an den Komponisten: „Daher erfodert das Kammertrio eine Geschiklichkeit des Tonsezers, die Kunst hinter dem Ausdruk zu verbergen“ (ebd.).
In Quantz’ Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen gelten die ersten Paragraphen des XVIII. Hauptstücks (Wie ein Musikus und eine Musik zu beurtheilen sey) der Klage, dass die wenigsten Menschen in der Lage seien, Musik angemessen zu beurteilen:
„Nicht nur ein jeder Musikus, sondern auch ein jeder, der sich für einen Liebhaber derselben [der Musik] ausgiebt, will zugleich für einen Richter dessen, was er höret, angesehen werden“ (Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, Berlin 1752, Faksimile-Reprint, Kassel 2004, S. 275).
Im weiteren Verlauf folgen regelrechte Kataloge von Qualitätskriterien, die die unterschiedlichen Musikgattungen zu erfüllen hätten, um Quantz’ Ansprüchen zu genügen. § 44 behandelt den „Quatuor“ mit drei solistisch agierenden Instrumenten und einer Generalbassstimme. Quantz bezeichnet ihn respektvoll als den „Probierstein eines echten Contrapunctisten“ und verweist auf Telemanns Pariser Quartette als Musterbeispiele der Gattung (ebd., S. 302).
§ 45, in dem Quantz nach dem Quatuor nun seine darauf aufbauenden Qualitätskriterien für das Trio niederlegt, sei im Folgenden vollständig wiedergegeben (ebd., S. 302f.). Dabei soll zugleich versucht werden, diesen spezifisch Berliner Kriterienkatalog des Trios mit Schaffraths kompositorischem Beitrag zur Gattung zu vergleichen und übereinstimmende Momente aufzudecken.
„Ein Trio erfordert zwar nicht eine so mühsame Arbeit, als ein Quatuor; doch aber von Seiten des Komponisten fast dieselbe Wissenschaft; wenn es anders von der rechten Art seyn soll. Doch hat es dieses voraus, daß man darinne galantere und gefälligere Gedanken anbringen kann, als im Quatuor: weil eine concertirende Stimme weniger ist. Es muß also in einem Trio 1) ein solcher Gesang erfunden werden, der eine singende Nebenstimme leidet. [Selbst für das eher sperrige Anfangsthema des Adagios findet Schaffrath eine melodiöse Gegenstimme (zweiter Satz (Adagio), T. 8–14; siehe Notenbeispiel.] 2) Der Vortrag beym Anfange eines jeden Satzes, besonders aber im Adagio, darf nicht zu lang seyn: weil solches bey der Wiederholung, so die zweyte Stimme machet, es sey in der Quinte, oder in der Quarte, oder im Einklange, leichtlich einen Ueberdruß erwecken könnte. [Der solistische Beginn des Adagios erstreckt sich lediglich über 7 Takte.] 3) Keine Stimme darf etwas vormachen, welches die andere nicht nachmachen könnte. [Das trifft zu – der Tonumfang der Oboe wird nur an wenigen Stellen von der Violine unter- oder überschritten (z. B. im ersten Satz (Allegro), T. 149). Schaffrath fordert keine instrumentenspezifischen Spieltechniken wie zum Beispiel Doppelgriffe.] 4) Die Imitationen müssen kurz gefasset, [Die Imitationen beschränken sich, außer zu Beginn der Sätze, auf kleine Motive von höchstens einem Takt Länge (zum Beispiel: erster Satz (Allegro), T. 29–32; siehe Notenbeispiel.] und die Passagien brillant seyn. [Die schnellen Läufe sind melodiös und ohne große Sprünge (zum Beispiel erster Satz (Allegro), T. 109–113; siehe Notenbeispiel).] 5) In Wiederholung der gefälligsten Gedanken muß eine gute Ordnung beobachtet werden. [Dafür sprechen zum Beispiel die Anfänge der zweiten Teile der Ecksätze, die jeweils das Anfangsthema in anderer Tonart wiederholen (erster Satz (Allegro), T. 82–96 bzw. dritter Satz (Presto), T. 70–84); siehe Notenbeispiel.] 6) Beyde Hauptstimmen müssen so gesetzet seyn, daß eine natürliche und wohlklingende Grundstimme darunter statt finden könne. [Die Bassstimme schreitet melodiös fort und enthält auch kleinere motivische Bestandteile (zum Beispiel erster Satz (Allegro), T. 43/3–48/1; siehe Notenbeispiel).] 7) Soferne eine Fuge darinne angebracht wird, muß selbige, eben wie beym Quatuor, nicht nur nach den Regeln der Setzkunst richtig, sondern auch schmackhaft, in allen Stimmen ausgeführet werden. Die Zwischensätze, sie mögen aus Passagien oder anderen Rahmungen bestehen, müssen gefällig und brillant seyn. [Dies trifft auf diese Sonate allerdings nicht zu, da sie keine strenge Fuge enthält.] 8) Obwohl die Terzen- und Sextengänge in den beyden Hauptstimmen eine Zierde des Trio sind; so müssen doch dieselben nicht zum Missbrauche gemachet, noch bis zum Ekel durchgepeitschet, sondern vielmehr immer durch Passagien oder andere Nachahmungen unterbrochen werden. [In den Ecksätzen kommen kaum ausgedehnte Terz- oder Sextgänge vor. Im Mittelsatz ist dies zum Beispiel in den Takten 31 bis 38 der Fall; siehe Notenbeispiel.] Das Trio muß endlich 9) so beschaffen seyn, daß man kaum errathen könne, welche Stimme von beyden die erste sey. [Beide Oberstimmen haben ungefähr den gleichen Spielanteil und Ambitus und spielen dieselben Motive (siehe auch Anm. 20).]“
Hiermit wird in der ästhetischen Theorie ein genaues Berliner Anforderungsprofil an das instrumentale Kammertrio definiert. Der Abgleich mit Schaffraths Komposition deckt ein Ausmaß der genauen Übereinstimmung auf, das über bloße Zufälligkeiten sicherlich weit hinaus geht. Es ist selbstverständlich heute nicht nachweisbar, ob Johann Joachim Quantz auch diese spezielle Triosonate von Schaffrath kannte und wie er sie möglicherweise eingeschätzt hatte. Hält man sich aber nur an seinen Kriterienkatalog, so kann man feststellen, dass Schaffraths Triosonate diesen Anforderungen in einer der zentralen Schriften der Berliner Ästhetik der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollständig genügt: Theorie und Kompositionspraxis fallen an dieser Stelle in nahezu idealer Weise zusammen.
Rezeption
Die ungebrochene Wirkungsmächtigkeit dieses ehemals Berliner Diskurses zeigt sich noch in den 1790er Jahren, wenn Koch Sulzers Anmerkungen über das Trio wörtlich zitiert. Allerdings konstatiert Koch, dass die bei Sulzer favorisierten Trios – mit drei gleichrangigen, kontrapunktisch geführten Stimmen – zu seiner Zeit bereits aus der Mode gekommen seien (Heinrich Christoph Koch, Versuch einer Anleitung zur Composition, Leipzig 1793, Studienausgabe, hrsg. von Jo Wilhelm Siebert, Hannover 2007, S. 528). Auch Trios mit zwei Haupt- und einer begleitenden Nebenstimme würden kaum noch geschrieben oder gespielt. Koch begründet diese Tatsache mit dem Aufkommen des virtuosen Konzerts und dem zu seiner Zeit beliebteren Quartett:
„Ohngefähr die Mitte dieses Jahrhunderts war derjenige Zeitpunkt, in welchem diese Gattung der Sonate am stärksten bearbeitet wurde, und in welchem viele Tonsetzer sehr schätzbare Producte dieser Art geliefert haben, die aber größtenteils nur durch Abschriften hier und da bekannt worden sind, und die theils wegen des anjetzt beliebten Quartets, theils auch wegen des allgemeinen Hanges der jetzigen Virtuosen zum Concertspielen, ungebraucht vermodern“ (ebd.).
Außerdem erwähnt er noch eine andere Art des Trios, in der nur eine Hauptstimme vom Bass und der zweiten Oberstimme (als einer „Füllstimme“) begleitet wird. Diese Art ist ihm allerdings nur die kurze Bemerkung wert, dass sie „in der Hauptstimme einen sehr reizenden und ausdrucksvollen Gesang“ erfordert (ebd.). Aus der Kürze der Bemerkung könnte darauf zu schließen sein, dass Koch nur wenige erwähnenswerte Beispiele hierfür kannte. Doch war auch diese Kompositionsweise keineswegs neu, wie zum Beispiel der Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner in seinem ca. 1744 entstandenen Trio h-Moll GWV 219 (hrsg. von Vanessa Mayer, Edition Schott, Mainz 2007) für Flöte, Violine und Basso continuo beweist, in dem er der Violine eindeutig die Hauptstimme zuerkennt und die Flöte nur im kurzen Mittelteil des zweiten Satzes „solistisch“ in Erscheinung tritt. Graupner wirkte in Hessen – an der Diskrepanz der musikalischen Tonfälle wird deutlich, wie in sich geschlossen die Berliner und mitteldeutsche Musikwelt im 18. Jahrhundert gewirkt haben muss. Schaffraths Musik müsste für die von Koch imaginierten Zuhörer der 1790er Jahre also bereits damals in jeder Hinsicht veraltet, aber kontrapunktisch gelehrt (und insofern kompositionstechnisch auch „lehrreich“) geklungen haben.
Zweifelsohne lässt sich die Frage bejahen, ob Schaffraths g-Moll-Trio gleichsam in die Berliner Musikästhetik seiner Zeit hineinkomponiert worden sei. Der Vergleich mit allen angeführten Autorenmeinungen ergab keine Differenzen. Gerade weil wir um Christoph Schaffraths pädagogische Interessen wissen, erscheint es nicht fern, auch seinen Kompositionen wenn schon nicht einen klar belehrenden Impetus, so doch wenigstens den Wunsch nach einer gewissen Musterhaftigkeit zu attestieren. Im Nichtabweichen von vorgegebenen Formen und Mustern, im Ausreizen der durch so viele Traditionen klar definierten Grenzen liegt ein wesentlicher Reiz seiner Stücke. Es kommt zu keinem großen Ausbruch, keiner offenen Verletzung der Regeln. Also entscheiden, auch hier der Theorie der Gattung gemäß, gerade die Details über die musikalische Unverwechselbarkeit. Eben diese ästhetische Passgenauigkeit auf allen Ebenen des Tonsatzes und seiner sozialen Einbettung erklärt dann aber auch, warum Schaffrath vor allem nach dem Tode seines Dienstherren Friedrich II. im Jahr 1786, dessen Musikgeschmack schon zu Lebzeiten als überholt gegolten hatte, so schnell und bis vor kurzer Zeit in Vergessenheit geriet.
[Dieser Artikel basiert auf der 2013 geschriebenen Diplomarbeit der Verfasserin.]