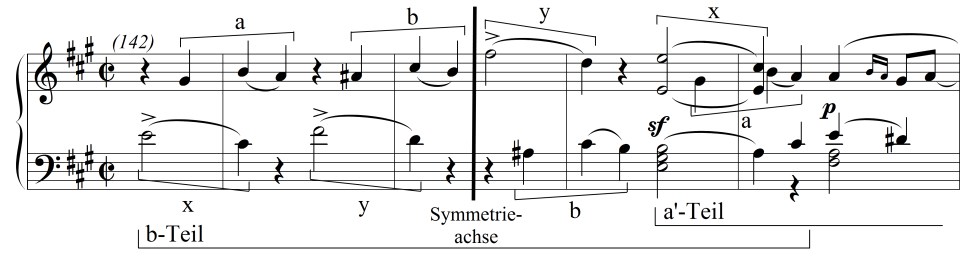Startseite » Beitrag veröffentlicht von muwileipzig (Seite 4)
Archiv des Autors: muwileipzig
Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch
Paula Jehnichen
Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch
Im Jahre 1820 veröffentlicht Johann Wolfgang von Goethe in seinen Schriften Zur Morphologie das Gedicht Urworte. Orphisch (hier in der Vertonung durch Hans Pfitzner),[1] dessen fünf Strophen er noch im selben Jahr in einer weiteren Veröffentlichung einige Erläuterungen beifügte. Goethe war zu dieser Zeit bereits 61 Jahre alt, das Gedicht ist also seinem Spätwerk zuzuordnen. Aus ihm spricht, so Jochen Schmidt, der »Ton einer erfahrungsgesättigten Welt-Weisheit«.[2]

Wie ist der Titel des Gedichts zu verstehen? Als »Orphisch« werden die der Überschrift folgenden Zeilen bezeichnet und verweisen wohl auf die orphische Dichtung, eine Gruppe antiker Texte. Diese, ebenso wie Goethes Gedicht in Hexametern verfasst, behandelt Themen wie die Entstehung der Welt und der Götter. Schon in der Antike wurden sie dem mythischen Sänger Orpheus zugeschrieben. In Kombination mit dem Begriff »Urworte« lässt Goethes Titel universelle Weisheiten über das Leben erwarten.
Das Gedicht besteht aus fünf Strophen, die der Form der Stanze (acht Elfsilbler mit dem Reimschema abababcc) entsprechen, jeweils mit einer eigenen, altgriechischen und ins Deutsche übersetzten Überschrift. Es handelt sich um die Namen von fünf verschiedenen Kräften, fünf Grundmächten, die das menschliche Leben bestimmen: ΔΑΙΜΩΝ (Daimon, Dämon), ΤΥΧΗ (Tyche, das Zufällige), ΕΡΩΣ (Eros, Liebe), ΑΝΑΓΚΗ (Ananke, Nötigung) und ΕΛΠΙΣ (Elpis, Hoffnung).
Diese Begriffe gelangten auf verschlungenem Wege zu Goethe: Als Namen von ägyptischen Gottheiten tauchen vier der Begriffe in einem Text des dänischen Archäologen Georg Zoëga (1755–1809)[3] auf, der wiederum aus den Saturnalia des spätantiken Autors Macrobius zitierte. Auch der fünfte Begriff, Elpis, fällt in Zoëgas Text. Eine deutsche Ausgabe seiner Abhandlung erschien 1820 und inspirierte Goethe zu dessen eigenem ›orphischen‹ Gedicht.[4]
Die Fülle an bedeutungsschweren und geschichtsträchtigen Begriffen schon in den Überschriften lässt erwarten, dass auch der Inhalt über eine hohe Dichte verfügt. Obwohl durchaus ein chronologischer Zusammenhang zwischen den Strophen besteht – sie behandeln nacheinander verschiedene Phasen des menschlichen Lebens, worauf schon die Beschreibung einer Geburt in den ersten Versen hindeutet –, ist es doch hinfällig, nach einer fortschreitenden Handlung zu suchen. Vielmehr werden fünf Mächte oder Kräfte beschrieben, die einerseits nacheinander auftreten und Phasen des menschlichen Lebens bestimmen, andererseits aber auch im ständigen Widerspruch stehen und gemeinsam auf das ganze Leben wirken.
Als Dämon wird die erste Kraft, die auf den Menschen wirkt, bezeichnet. Der Begriff ist mit verschiedenen Bedeutungen besetzt – hier liegt die des angeborenen Wesensgesetzes nahe, die gleichzeitig die Stärke der Individualität hervorhebt.[5] Angesprochen wird ein Individuum, das sich seit seiner Geburt weiterentwickelt und dessen Entwicklung aber doch ein »Gesetz« (Vers 4) zugrunde liegt, dem nicht entflohen werden kann. Goethe selbst erklärt den Dämon zur »unmittelbar ausgesprochene[n], begränzte[n] Individualität der Person«, zu dem also, was die Menschen voneinander unterscheidet und das nicht zerteilt werden kann.[6]
Im Anschluss daran wirkt die zweite Kraft, Tyche, das Zufällige: »ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt« (Vers 10). Es wird deutlich, dass der Mensch nicht allein ist, sondern ein geselliges Wesen, das von seiner Umwelt spielerisch hin- und hergeworfen wird. »Besonders auf die Jugend«[7] wirke die Kraft des Zufalls, schreibt Goethe: Damit wird die Begrenzung durch den Dämon ein wenig relativiert. Gleichzeitig entsteht eine Sehnsucht nach etwas Neuem, ein Warten auf eine »Flamme« (Vers 16) – die dann plötzlich erscheint:
Eros, die Liebe, »stürzt vom Himmel nieder« (Vers 17) und ist die dritte und zentrale Kraft des Gedichts. Hier treffen die beiden bisher dargestellten Gegensätze aufeinander. Einerseits wirkt sehr stark das eigene Wollen, die egoistische Kraft des Dämon, andererseits gibt es ablenkend Fremdartiges. Ebenso wie Tyche ist die Liebe etwas, das von außen auf den Menschen trifft (sogar »stürzt«) und sprunghaft und unverständlich ist (»scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder«, Vers 7). Wie in den beiden Schlussversen zu lesen ist, gibt es aber eine Lösung dieser Orientierungslosigkeit, einen Gegenvorschlag zum »Verschweben im Allgemeinen«: »Doch widmet sich das Edelste dem Einen« (Vers 24). Die Verbindung mit einer anderen Person ist es schließlich, die auch die Verbindung der beiden gegensätzlichen Kräfte Dämon und Tyche möglich macht. So »bringt die Eros-Strophe den Antagonismus von Begrenztheit und Grenzüberschreitung, der die Konstellation der beiden ersten und der beiden letzten Strophen bestimmt, zum Ausgleich. Allein in der Liebe […] gelingt die harmonische Vereinigung der gegenläufigen Tendenzen.«[8] Diese Strophe steht also in mehrfacher Hinsicht im Zentrum des Gedichts, bildet sie doch gleichzeitig dessen Mitte und fungiert außerdem als Vermittlerin zwischen den verschiedenen gegensätzlichen Kräften.
Dass diese Verbindung jedoch nicht endgültig ist, zeigt die folgende Kraft, Ananke, die Nötigung. »Wieder« (Vers 25) wirken begrenzende Zwänge (»Bedingung und Gesetz«, Vers 26) auf den Menschen. Damit beginnt eine Analogie der beiden letzten Strophen zu den ersten beiden des Gedichts: Tendenzen und Motive werden aufgegriffen und weitergeführt. Nachdem die Kräfte Dämon und Tyche einen Widerspruch zwischen Begrenzung und Freiheit eröffnet haben, der dann durch die Liebe aufgelöst wurde, wird dieser Widerspruch zwischen Nötigung und Hoffnung erneut gebildet und verstärkt. Im Gegensatz zu der schon vor der Geburt angelegten Form der Individualität, die sich durch den Dämon ausdrückt, ist die Nötigung eine von außen auf den Menschen einwirkende Kraft: ein Wille, zu dem man gewissermaßen gezwungen wird, ein »hartes Muß« (Vers 30), dem man sich unterordnet. Goethe selbst erläutert diese Strophe nur kurz, jeder kenne diese Zwänge und das Gefühl, der Gegenwart ausgeliefert zu sein.[9]
Um einiges optimistischer mutet die letzte Strophe an. Sie gilt der Hoffnung, einer auf die vorherige Eingrenzung reagierende Kraft, die »entriegelt« (Vers 34), statt zu verschließen, und »beflügelt« (Vers 38), statt einzuengen. Zuletzt steht eine Befreiung aus allen Zwängen, sowohl den räumlichen (»sie schwärmt durch alle Zonen«, Vers 39) als auch den zeitlichen (»und hinter uns Äonen!«, Vers 40). Auf die strenge Stimmung der Ananke-Strophe folgt ein euphorisches Durchbrechen aller Grenzen, das in seiner Absolutheit vielleicht schon illusionär ist.[10]
Nachdem der Betrachtung der einzelnen Strophen sollen nun noch ihre chronologischen und konzeptionellen Zusammenhänge in den Fokus rücken. Einerseits wird ein zeitlicher Verlauf dargestellt, andererseits existiert auch eine zyklische Struktur, die sich durch die Anordnung der vier äußeren Strophen um die mittlere Elpis-Strophe ausdrückt. Das menschliche Leben als Zusammenwirken verschiedener Kräfte wird mithilfe zweier zeitlicher Ordnungen beschrieben: Zum einen durchläuft man fünf aufeinander folgende Phasen, gleichzeitig aber wird der ständig wirkende Widerspruch zwischen Begrenzung und Freiheit dargestellt.
Eine Chronologie der Strophen besteht insofern, als dass jede Strophe eine Lebensphase repräsentiert und insgesamt eine ›prototypische‹ Lebensgeschichte abgebildet wird. Dies wird einerseits im Gedicht selbst deutlich (durch direkte Bezüge zu Lebensstationen wie der Geburt, Vers 1, und auch durch Verweise auf einen zeitlichen Verlauf, Verse 25 und 31). Außerdem zieht Goethe in seinem Kommentar eine Verbindung der einzelnen Strophen zu verschiedenen Lebensphasen.[11] Diese Zuordnung ist folgendermaßen: Dämon steht die Geburt und die Weiterentwicklung angeborener Eigenschaften, Tyche für die unbeständige Jugend, Eros für die Lebenswende, Ananke für die sich den Anforderungen der Gesellschaft stellende Arbeit und Elpis für das Alter.[12]
Gleichzeitig ist eine simultane Dialektik am Werk: Beschrieben wird eher ein Zustand, als dass ein Geschehen erzählt wird. Die Kräfte hängen zusammen und wirken im Zusammenspiel – dies wird vor allem durch ihre zyklische Anordnung klar. Es gibt begrenzende Kräfte (Dämon, Ananke), denen befreiende (Tyche, Elpis) gegenübergestellt werden. Im Zentrum steht Eros, die Liebe, die die gegensätzlichen Tendenzen zu verbinden versucht. Im zweiten Teil des Gedichts wiederholen sich die Motive; die Widersprüche werden nicht endgültig vereinigt oder aufgehoben, sondern sind ständig wirksam. Dieses Zusammenspiel bestimmt das Gedicht[13] und wird darüber hinaus auch als Grundthema von Goethes Werk gesehen.[14]
Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage, ob es sich hier überhaupt um ein einzelnes Gedicht und nicht viel mehr einen Gedichtzyklus handelt, zu betrachten. Die einzelnen Strophen haben spezielle Überschriften und sehr verschiedene Charaktere; somit könnten also die Urworte als Zyklus bezeichnet werden. Doch die Strophen hängen inhaltlich zusammen, ihre Anordnung hat eine ganz besondere Wirkung – gerade die oben genannte zyklische Komposition kommt nur unter Betrachtung aller Strophen zum Ausdruck. Darin unterscheidet sich das Werk auch von Zyklen wie den Römischen Elegien oder dem West-östlichen Diwan, die ungefähr zeitgleich mit den Urworten entstanden sind. Somit ist es wohl treffend, die Urworte. Orphisch als ein einzelnes Gedicht zu bezeichnen.
Was das Orpheus-Motiv betrifft, bedient Goethe sich offensichtlich nicht des Mythos von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt. Orpheus tritt weder auf noch wird seine Geschichte erzählt. Vielmehr wird eine Eigenschaft der mythischen Figur aufgegriffen, die in musikalischen Orpheus-Bearbeitungen nur selten zum Tragen kommt: nämlich die des mythischen Autors, des großen Philosophen, der tief bedeutsame Gedichte verfasst. Orpheus ist nicht nur ein sagenumwobener Sänger, sondern steht seit der Antike auch für »die Einheit von religiöser und poetischer Inspiriertheit, die Erschaffung der Welt durch den Eros und ihre Verzauberung durch Musik und Poesie«.[15] Das Orphische ist also weniger an eine Figur als an eine Art Gattungsbezeichnung gebunden – in ihrem Ton, ihrer Form und in ihrem Thema sind Goethes Worte »orphisch«.[16]
Goethe schrieb einleitend über sein Gedicht:
»Was nun von den älteren und neueren orphischen Lehren überliefert worden, hat man hier zusammendrängen, poetisch […] vorzutragen gesucht.«[17]
Verschiedene antike, mythische Motive aufgreifend, formuliert er eine Weisheitslehre, die das menschliche Leben im Spannungsfeld gegensätzlicher Kräfte beschreibt und sich so einen ganz eigenen Platz in der Reihe der Orpheus-Bearbeitungen in den verschiedenen Künsten verschafft.
Johann Wolfgang von Goethe: »Urworte. Orphisch« (1817)[18]
ΔΑΙΜΩΝ, Dämon
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.ΤΥΧΗ, Das Zufällige
Die strenge Grenze doch umgeht gefällig
Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt;
Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig,
Und handelst wohl so, wie ein andrer handelt:
Im Leben ist’s bald hin-, bald wiederfällig,
Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt.
Schon hat sich still der Jahre Kreis gezündet,
Die Lampe harrt der Flamme, die entzündet.ΕΡΩΣ, Liebe
Die bleibt nicht aus! – Er stürzt vom Himmel nieder,
Wohin er sich aus alter Öde schwang,
Er schwebt heran auf luftigem Gefieder
Und Stirn und Brust den Frühlingstag entlang,
Scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder,
Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang.
Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen,
Doch widmet sich das edelste dem EinenΑΝΑΓΚΗ, Nötigung
Da ist’s denn wieder wie die Sterne wollten:
Bedingung und Gesetz und aller Wille
Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,
Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille;
Das Liebste wird vom Herzen weggescholten,
Dem harten Muß bequemt sich Will’ und Grille.
So sind wir scheinfrei denn nach manchen Jahren
Nur enger dran als wir am Anfang waren.ΕΛΠΙΣ, Hoffnung
Doch solcher Grenze, solcher ehrnen Mauer
Höchst widerwärt’ge Pforte wird entriegelt,
Sie stehe nur mit alter Felsendauer!
Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt:
Aus Wolkendecke, Nebel, Regenschauer
Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie beflügelt,
Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen;
Ein Flügelschlag – und hinter uns Äonen!
Quellen und Literatur
Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, Bd. 2: Gedichte 1800–1832, hrsg. von Karl Eibl, Frankfurt am Main 1988.
Ders.: Ueber Kunst und Alterthum, Bd. 2/3, Stuttgart 1820, S. 66–78.
Cornelius Ludwig, Orphische Dichtung, in: Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen, hrsg. von Dieter Burdorf u. a., 3. Aufl., Stuttgart 2007, S. 599.
Gerhart Schmidt, Goethes »Urworte. Orphisch«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 11/1, 1957, S. 37–53.
Jochen Schmidt, Goethes Altersgedicht »Urworte. Orphisch«. Grenzerfahrung und Entgrenzung, Vortrag vom 26. November 2005, Heidelberg 2006.
Inge Wild, Urworte. Orphisch, in: Metzler Goethe Lexikon, hrsg. von Benedikt Jeßing, Bernd Lutz und Inge Wild, Stuttgart 1999, S. 506.
Anmerkungen
[1] Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 501f.
[2] Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 5.
[3] Georg Zoëgas Abhandlungen, hrsg. von Friedrich Gottlieb Welcker, erschienen 1817 in Göttingen; vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 8.
[4] Vgl. ebd., S. 9.
[5] Vgl. ebd., S. 17.
[6] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum; zit. nach Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 36.
[7] Ebd. S. 37.
[8] Ebd., S. 22.
[9] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 39.
[10] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 26.
[11] Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 37.
[12] Vgl. Karl Otto Conrady, Gott und Natur. Weltanschauliche Gedichte, in: Goethe, Leben und Werk, Düsseldorf 2006, S. 915.
[13] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 15.
[14] Inge Wild, Urworte. Orphisch, S. 506.
[15] Ebd.
[16] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 9.
[17] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 35.
[18] Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 501f.
Oskar Kokoschka und Ernst Krenek: Orpheus und Eurydike
Leonhard Summerer
Oskar Kokoschka und Ernst Krenek – Orpheus und Eurydike
Heute kennt man Oskar Kokoschka vor allem als Maler. Viele seiner anderen Werke – insbesondere seine literarischen – sind hingegen fast in Vergessenheit geraten, so auch sein Drama Orpheus und Eurydike, das er 1918 vollendete. Dessen Entstehung ist eng mit Kokoschkas ehemaliger Geliebter Alma Mahler verknüpft, mit der er von 1912 bis 1914 liiert war. Nach der Trennung zog er als Soldat freiwillig in den Ersten Weltkrieg und wurde schwer verwundet. Während seiner Rekonvaleszenz – quasi im Delirium – begann er 1915 mit der Arbeit an Orpheus und Eurydike und verarbeitete damit sowohl seine Kriegserlebnisse als auch die Trennung von Alma Mahler.[1]
Wieso aber schrieb der gelernte Maler Kokoschka überhaupt? Ernst Krenek gab folgende Antwort:
»Er ist Maler, und als solcher berühmt und groß geworden […] Aber er ist nicht Maler von Beruf, im ausschließlichen Sinne des Handwerks. Er ist ein künstlerischer Mensch mit visueller Hauptbetonung. Sein Beruf ist nicht, mit dem Pinsel Leinwand zu bemalen, sondern die Welt mit dem Auge zu erleben und zu gestalten. Einmal wird es ein Bild, einmal ein Drama und ein anderes Mal gelebtes Leben. […] Ich kann mir gut vorstellen, daß er etwa überhaupt aufhört zu malen, ganz etwas anderes treibt und eigentlich gar nicht richtig merkt, daß er seinen Schwerpunkt verschoben hat.«[2]
In Orpheus und Eurydike beschäftigte sich Kokoschka mit dem Orpheus-Mythos, indem er ihn psychoanalytisch, expressionistisch und autobiografisch interpretierte und neu erzählte.[3] Indem er den Mythos um Orpheus mit dem um Amor und Psyche verknüpfte, erzeugte er zwei parallele Handlungsstränge.[4] Zu Beginn der Handlung sind Orpheus und Eurydike noch glücklich vereint, ein bevorstehendes Unglück deutet sich allerdings schon an. Drei Furien locken Psyche, die Eurydikes Tür bewacht, fort, um Eurydike für sieben Jahre zu Hades in die Unterwelt zu holen. Eurydike wehrt sich, ist andererseits aber auch versucht zu gehen. Schließlich verlässt sie Orpheus. Erst drei Jahre später macht er sich auf, sie zurückzuholen. Eurydike hat ihn da jedoch schon vergessen. Hades’ Bedingung für ihre Rückkehr lautet:
»Wenn Du nicht die Augen wendest,
nicht sie ängstigst mit Vergang’nem,
kehrt zurück Bewußtsein, das Eurydike entwichen!«[5]
Das Zurückblicken, im klassischen Mythos als Umsehen verstanden, wird hier zum Rückblick auf die Vergangenheit umgedeutet.[6] Die Rückkehr ist von Orpheus’ Misstrauen bezüglich Eurydikes Aktivitäten in der Unterwelt geprägt. Während der Fahrt auf einem Schiff kann er sich nicht mehr beherrschen und befragt Eurydike nach ihrer Vergangenheit. Sie bekennt, Hades’ Geliebte gewesen und von ihm schwanger zu sein. Von Orpheus’ Umblicken verletzt, entschließt sie sich, in die Unterwelt zurückzukehren.
Jahre später, in einem Niemandsland zwischen Leben und Tod, ereignen sich Gewaltszenen und bacchantische Tänze. Mittendrin ist der inzwischen ›verrückte‹ Orpheus, der bald darauf ermordet wird. Sein Geist trifft auf den Eurydikes; in einem letzten Gespräch können beide sich nicht vergeben. Als letzten Ausweg tötet Eurydike Orpheus nochmals. Psyche hat indessen ihre Schuld gegenüber Eurydike und Amor gebüßt und ist wieder mit Amor vereint. Beide segeln Richtung Sonnenaufgang.
Kokoschkas Drama greift Motive des Orpheus-Mythos auf und interpretiert sie auf eigene Art und Weise. Anders als in vielen anderen Fassungen ist die Liebe von Orpheus und Eurydike nicht gefestigt, nicht idealtypisch, sondern eine im modernen Sinne ›realistisch‹ dargestellte Liebe mit allen Höhen und Tiefen. Orpheus und Eurydike lieben sich innig, es gibt aber auch Zweifel und schwankende Gefühle, die sich zu einer »Hassliebe«[7] entwickeln. Krenek beschreibt diese Dynamik folgendermaßen:
»In dieser Szene [vor dem Besteigen des Schiffs] wird besonders deutlich, was mir Kokoschka einmal sagte, daß nämlich in den beiden Hauptakteuren des Dramas ein ständiger Widerstreit von positiven und negativen Lebenskräften herrsche, die in ihrer Intensitätssumme wohl konstant sind, sich aber nie die Waage halten. Sobald der eine von beiden hoffnungsvoll und lebensbejahend dem anderen entgegenkommt, wicht der andere zurück, und umgekehrt. Darin liegt auch das tief Erschütternde und im neuen Sinn Tragische des Schicksals dieser zwei Menschen, die einander unbedingt zugehören und einander tief und wahrhaft lieben und trotz der aufreibendsten Anstrengungen nie zueinanderkommen, ohne daß eine Schuld im moralisch-ethischen Sinne aufzuweisen wäre.«[8]
Nur die Götter Amor und Psyche verbindet eine »reine Liebe«.[9] Der Hauptgrund für die problematische Liebesbeziehung von Orpheus und Eurydike ist die Neugierde. Sie tritt bei Orpheus als Misstrauen gegen Eurydike auf; er ist zu neugierig, um die Geschehnisse in der Unterwelt auf sich beruhen zu lassen. Sein Misstrauen kommt aber nicht von ungefähr, denn auch Eurydike ist neugierig; bei ihr tritt Neugierde als Wunsch nach Veränderung auf, als Sehnen nach dem Unbekannten, als Versuchung.[10] Das Motiv ›Leben und Tod‹ taucht auch bei Kokoschka auf: Eurydike stirbt zu Beginn aus Neugierde; nach ihrer Rettung bringt Orpheus sie um, weil sie zurück in die Unterwelt möchte. Zum Ende hin provoziert Orpheus seinen eigenen Tod, der so quasi zum Suizid wird, und wird schließlich nochmals von Eurydike getötet, weil beide keine Ruhe finden. Beide Hauptpersonen sterben also mehrere Tode aus verschiedenen Gründen – Neugierde, Wahn und Erlösung.
Wie kann man Kokoschkas Fassung des Mythos interpretieren? Neben einer autobiografischen Lesart bieten sich zwei weitere Deutungen an, eine expressionistische und eine psychoanalytische.[11] Das Drama entstand in der Blütezeit des Expressionismus; Kokoschka wird dieser Strömung sowohl als Maler als auch als Schriftsteller zugeordnet.[12] Im Drama werden ›expressionistische‹ Themen wie Liebe, Hass und Wahnsinn verarbeitet. Kernelement des Expressionismus ist, eigene Erlebnisse und Gefühle auszudrücken. Kokoschka geht dabei so weit,
»daß er ganze Sätze, die im wirklichen Leben gesprochen wurden, in sein Drama herüber nimmt, weil ihm nicht die künstlerische Vorstellung, sondern die unmittelbare Lebendigkeit in diesem Augenblick die Hauptsache ist. So ergibt das Gesamtbild des Werkes ein verwirrendes Nebeneinander von lyrischer Zartheit, grandioser Dramatik, scheinbarer Banalität, von beinahe unverständlich Persönlichem«.[13]
Kokoschkas Orpheus und Eurydike lässt sich aber auch psychoanalytisch interpretieren: als »psychologische Innenschau«,[14] bei der die Geschehnisse von unterbewussten Handlungen motiviert sind. Sie tauchen sowohl bei Eurydike (Verlangen, Versuchung, unterbewusste Erkenntnisse) als auch bei Orpheus (Neugierde, Misstrauen) auf. Wie bereits angedeutet, hat Kokoschka persönliche Erlebnisse verarbeitet; das Drama lässt sich autobiografisch interpretieren. Da sind seine Kriegserlebnisse, seine Verwundung, seine Nahtoderfahrung und seine Zeit im Delirium, die sich vor allem in Orpheus’ Existenz zwischen Leben und Tod während des dritten Aktes niederschlagen. Andererseits spiegelt sich die Trennung von Alma Mahler deutlich wider. Nach einer schlüssigen allegorischen Deutung[15] steht Orpheus hierbei für Kokoschka, Eurydike für Alma Mahler, Psyche für Kreneks zwischenzeitige Frau Anna Mahler und Hades für den übermächtigen Gustav Mahler. Kokoschka liebt Alma und verliert sie, weil sie sich nicht binden will und sich nach Veränderung sehnt. Er ist übertrieben anhänglich, fast obsessiv besitzergreifend, wodurch sie sich von ihm eingeengt fühlt.
Viele dieser Motive finden sich im Drama wieder. Ein für die Handlung bedeutsamer goldener Ring, der Orpheus und Eurydike zuerst vereint und schließlich trennt, trägt die Inschrift
ALLOS MAKAR
Das ist ein (etwas ungenaues) Anagramm von »Oskar« und »Alma« – ein weiterer Aspekt, der die autobiografische Interpretation stärkt.[16]
Insgesamt gesehen interpretiert Kokoschka den Mythos als doppelte Liebesgeschichte. Dabei ist die Liebe zwischen Orpheus und Eurydike von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil beide keine Entwicklung vollziehen und die anfangs kleinen Probleme am Schluss dieselben Probleme in groß sind. Beide verbindet keine ideale Liebe, sondern – wie sich im Laufe des Dramas herausstellt – eine Hassliebe. Die wahre, ideale Liebe bleibt den mystischen Figuren Amor und Psyche vorbehalten und wird so zum mythologischen Topos.[17]
Nach der Uraufführung von Orpheus und Eurydike im Jahre 1921 als Schauspiel ohne Musik machte sich der Autor auf die Suche nach einem Komponisten. 1922 wurde er in dem damals 22jährigen Ernst Krenek fündig. Dieser schloss die gleichnamige Oper im Jahre 1923 ab, ein Jahr vor seiner Heirat mit Anna Mahler. Die Uraufführung folgte allerdings erst 1926 in Kassel. Krenek selbst schrieb in seiner Autobiographie:
»Die Musik, mit der ich dieses Opus ausstattete, gehört zweifellos zu den bedeutendsten Werken, die ich je komponiert habe.«[18]
Trotzdem blieb der Oper der Erfolg verwehrt, woran auch Kreneks ein Jahr später uraufgeführte Jazz-Oper Jonny spielt auf mit ihrem überwältigendem Erfolg Schuld trug.[19] – Wie verarbeitet Krenek Kokoschkas Drama? Laut Krenek sei das ganze Stück ohne Musik undenkbar,[20] andererseits könne es sein, dass die Musik die ohnehin schwer zu verstehende Sprache noch schwerer verstehbar mache. Deswegen solle ihre Aufgabe sein, Sprache und Handlung gefühlsmäßig zu unterstützen, sie (im Wortsinne) selbstverständlich zu machen und dramatisch wichtige Situationen zu unterstreichen.[21] In diesem Sinne folgt Krenek Richard Wagners Konzeption der Rolle der Musik im Musikdrama.[22] Die Oper ist szenisch komponiert und durch wiederkehrende Motive verbunden. Sie sind aber keine Leitmotive im Sinne Wagners, da sie mehr architektonische als Ausdrucks-Bedeutung haben;[23] so taucht beispielsweise ein aus den Töne d, e und a geschichteter Klang an vielen entscheidenden Stellen (u. a. als erster und letzter Klang der Oper) auf. Die Oper ist in einem eklektischen Personalstil geschrieben, geprägt von Folgen des Expressionismus und der Frühzeit der ›Neuen Sachlichkeit‹, der Harmonik Claude Debussys und Gustav Mahlers sowie atonalen Passagen.[24] Krenek selbst hielt Klassifikationsversuche weder für möglich noch für sinnvoll.[25]
Kokoschkas Drama eröffnete eine neue Sichtweise auf den Orpheus-Stoff, indem es die Beziehung zwischen Orpheus und Eurydike näher betrachtet und ihre Motivationen aufdeckt. Krenek schafft es, diese Feinheiten musikalisch differenziert umzusetzen und so den Text besser verständlich zu machen. Gleichzeitig verliert sich die Oper nicht in Details, sondern spannt einen großen dramaturgischen Bogen über das Stück. Unter diesen Gesichtspunkten scheint es nicht nur verwunderlich, sondern auch bedauerlich, dass beide Werke in Vergessenheit geraten sind.
Quellen und Literatur
Christian Baier, Der ausweglose Mythos. Zu Kreneks »Orpheus und Eruydike«, in: Neue Zeitschrift für Musik 170, 2003, S. 20f.
Oskar Kokoschka, Schriften 1907–1955, hrsg. von Hans Maria Wingler, München 1956.
Ernst Krenek, Im Atem der Zeit. Erinnerungen an die Moderne, Hamburg 1998.
Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, in: Ernst Krenek Studien 1, 2005.
Anmerkungen
[1] Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 54 und S. 57.
[2] Ebd., S. 132.
[3] Vgl. Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 20.
[4] Vgl. Ernst Krenek, Im Atem der Zeit, S. 615f.
[5] Oskar Kokoschka, Schriften 1907–1955, S. 257.
[6] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 72f.
[7] Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 21.
[8] Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 135f.
[9] Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 21.
[10] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 82.
[11] Vgl. Ernst Krenek, Im Atem der Zeit, S. 386.
[12] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 109.
[13] Ebd., S. 132 f.
[14] Vgl. Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 20.
[15] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 57.
[16] Vgl. Ernst Krenek, Im Atem der Zeit, S. 386f.
[17] Vgl. Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 21.
[18] Ernst Krenek, Im Atem der Zeit, S. 387f.
[19] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 14.
[20] Vgl. ebd., S. 139.
[21] Vgl. ebd., S. 139f.
[22] Vgl. ebd., S. 18.
[23] Vgl. ebd., S. 143f.
[24] Ebd., S. 18.
[25] Vgl. ebd., S. 144.
Philip Glass: Orphée (nach Jean Cocteau)
Charlotte Tauber
Französischer Surrealismus trifft amerikanischen Minimalismus – Philip Glass’ Orphée
Was haben der 1963 verstorbene französische Surrealist Jean Cocteau und der 1937 in Baltimore geborene Mitbegründer der Minimal Music Philip Glass gemeinsam?


Glass kam früh mit Cocteaus Werken in Berührung, so auch mit dessen legendärer Verfilmung des Orpheus-Mythos von 1949/50. Im Alter von 15 Jahren sah Glass diesen Orphée, verstand aber laut eigener Aussage nichts – »Cocteau gibt einem nicht alle Antworten«, so Glass. Ein Umstand, der auf Seiten des Regisseurs und Autors auf Absicht beruhte: Teil der rätselhaften Werke Cocteaus war immer das Nicht-Verstehen, das Wundern. Der Drang, alles begreifen zu müssen, widerstrebte ihm. Cocteau meinte dazu:
»Es gibt keine schlüssige Handlung. Ich werde die Wirklichkeit von Orten, Personen, Gebärden, Worten und die der Musik benutzen, um der Abstraktion, die der Gedanke vornimmt, eine Hülle zu geben.«
Sein Film sei ohne Anfang und ohne Ende. Dennoch – ein Großteil von Glass’ Verwirrung mag seinem jugendlichen Alter zuzuschreiben sein. Später schrieb er dazu:
»Das Interessante an Cocteaus Film ist, dass er eine ganz spezifische Orpheus-Version schuf, die in Paris spielt. Der Film ist auch teilweise autobiographisch. Er geht über sein Leben als Künstler. […] Aber eigentlich geht es in dem Film um ihn selbst und auch um seine Beziehungen zu den anderen Künstlern. […] Vor 30 Jahren war meine Situation noch ganz anders. Ich denke, dies ist ein Projekt, das man erst in einem gewissen Alter in Angriff nehmen kann. Heute, mit 55, glaube ich, Orphée schreiben zu können, mit 30 hätte ich es sicherlich noch nicht gekonnt.«
Glass’ Faszination ging so weit, dass er nach Orphée (1993) zwei weitere Cocteau-Filme als Opernvorlage nutzte: den Märchenfilm La Belle et la Bête (1994) sowie Les Enfants terribles (1995/96). Von diesen drei Cocteau-Opern stellt Orphée die klassischste dar; die Oper La Belle et la Bête läuft parallel und komplett synchronisiert zur Filmvorführung ab, die Tanzoper Les Enfants terribles wird nur von drei Klavieren begleitet.
Als Libretto der Kammeroper Orphée in zwei Akten nutzte Glass beinahe unverändert Cocteaus französisches Drehbuch. Kleinere Anpassungen nahm er nur vor, wenn er aufgrund der eingeschränkteren Möglichkeiten der Opernbühne gegenüber dem Film dazu gezwungen war. Musikalisch schuf Glass einen repetitiven, tonalen Klangteppich der Instrumente, über dem sich die Solisten frei und harmonisch unabhängig bewegen. Aufgrund der großen Textmenge ließ er die Sänger größtenteils auf einem Ton rezitieren. Der Bariton Matthew Worth, der in einer Pittsburgher Inszenierung die Titelrolle sang, beschreibt Glass als »farb-fixiert«, speziell das Orchester betreffend:
»The term minimalism minimizes who [Glass] is as a composer. Other composers are more vocal-line-centric. Glass is color-centric, especially in the orchestral part.«
Cocteau weicht in seinem Orphée und in dem 1925 vorausgegangenen, gleichnamigen Theaterstück wesentlich vom antiken Mythos ab. Orphée ist kein Musiker, sondern Inspiration suchender Dichter; Euridice wird nicht von einer Schlange gebissen, sondern von der eifersüchtigen Todesprinzessin in die Unterwelt geführt, damit die Prinzessin Orphée ganz für sich hat; Orphée geht eigentlich nicht für Euridice in die Unterwelt, sondern mehr, um diese faszinierende Todesprinzessin wiederzusehen. Das Gericht der Unterwelt, das sich erschreckend irdisch gibt, bestimmt Orphées und Euridices Rückkehr auf die Erde – nicht ohne vorherige Liebesschwüre zwischen der Todesprinzessin und Orphée. Das berühmte Blickverbot wird ins Absurde verschärft: Es wird Orphée für immer verboten, Euridice anzusehen – eine deutliche Einschränkung des Ehelebens. Orphée wendet sich aber auch ohne die Prinzessin immer weiter von Euridice ab. Der Film lässt die verzweifelte Euridice den tödlichen Blick erzwingen, in der Oper wendet Orphée sich um, um dem Elend ein Ende zu setzen. So oder so stirbt Euridice ein zweites Mal und verschwindet. Orphée wird kurz darauf in einer Auseinandersetzung mit einer wütende Menschenmenge, den Bacchantinnen, erschossen. Eine leidenschaftliche Vereinigung mit der Prinzessin in der Unterwelt währt nur kurz, denn diese lässt ihren Diener Heurtebise Orphée zurück auf die Erde führen. Die Zeit ist zurückgedreht, das Schicksal ausgetrickst. Völlig unvermittelt sind Orphée und Euridice ohne jegliche Erinnerung an das Geschehene glücklich vereint in ihrem Schlafzimmer und freuen sich auf ihr gemeinsames Kind. Die Prinzessin und ihr Diener werden in der Unterwelt abgeführt und sehen einem ungewissen Schicksal entgegen.
Eine verwirrende Handlung, doch wie Cocteau schon über den dritten Teil seiner Orpheus-Trilogie (aus Le Sang d’un poète, Orphée und Le Testament d’Orphée) sagte: Es ist »ein Film für Unschuldige, die nicht vom Laster des Begreifens um jeden Preis befallen sind…« Cocteaus und damit auch Glass’ Orphée ist egoistisch, verwöhnt, sprunghaft, ungeduldig und alles andere als ein Held. Orphée ist ein imperfekter Mensch mit wenig Disziplin und schlechtem Urteilsvermögen. Das alte Verbot des Umschauens wird symbolisch weitergedeutet im Sinne von nicht versteifen auf Ruhm, Ehre und Karriere und darüber das heimische Glück vergessen. Die Trennlinie zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Leben und Tod, wird aufgehoben: »Der Tod eines Dichters muss sich opfern, um ihn unsterblich zu machen«, sagt die Prinzessin. Laut Cocteau muss ein Dichter viele Arten von »Tod« erleiden, um durch seine Kunst unsterblich zu werden.
Ein musikalisches Zitat, das schon Cocteau und sein Komponist Georges Auric verwendeten, nimmt auch Glass auf. Cocteau setzt an zahlreichen Stellen im Film die Flötenmelodie des »Reigens seliger Geister« aus Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice ein. Sie taucht sowohl in Szenen mit der Prinzessin als auch in Szenen mit Euridice auf. Glass verwendet in einem Zwischenspiel, in dem die Todesprinzessin in Orphées Zimmer kommt, um ihn beim Schlafen zu beobachten, ein Thema, das deutlich an Glucks Melodie erinnert und die gleichen charakteristischen Verzierungen enthält. In der bekannten Klaviersuite, die Peter Barnes im Jahr 2000 aus der Oper geschaffen hat, heißt diese Szene Orphée’s Bedroom.
Glass’ Oper, die Cocteaus Libretto von 1949 mit der ›minimalistischen‹ Klangsprache des amerikanischen Komponisten verbindet, wurde von Kritik und Publikum unterschiedlich aufgenommen. Von »beguiling, delicate« (Andrew Clements in Opera am 1. August 2005), »comes close to the perfect marriage of music and drama« (Jon L. Lehman in Patriot Ledger am 1. Januar 2001) bis hin zu »Dudeldu-Ostinato« (Manuel Brug in der Süddeutschen Zeitung vom 6. August 1993) und »such a bore« (Peter G. Davis in New York Magazine vom 7. Juni 1993) waren in der Presse nahezu alle Meinungen vertreten. In jedem Fall zieht Glass mit seiner Verbindung von populärer Musik und klassischen Genres ein jüngeres Publikum an. Orphée taucht bis heute hier und da auf einem Spielplan auf, in Deutschland zuletzt in München 2012.
Die Beschäftigung mit dem Orpheus-Mythos bleibt eine Faszination für Komponisten aller Generationen – jüngst vertonte ihn Anaïs Mitchell 2010 mit Hadestown. Glass wurde mitunter vorgeworfen, sich gleich an zwei unsterblichen Klassikern ›vergangen‹ zu haben: dem Orpheus-Mythos und dem legendären Cocteau-Film. Und doch treffen sich die beiden Künstler in ihrem Wunsch, durch Verwirrung und Abstraktion das Wesentliche sichtbar zu machen. Unter den vielen offenen Fragen bleibt insbesondere die nach dem Schluss. Kann man Orphées ›Rückführung‹ als Happy End bezeichnen? Ist er nicht lediglich im Unwissen glücklich mit Euridice? Oder nur, weil er durch die Aufopferung des Todes bereits dichterische Unsterblichkeit erlangt hat? Eines steht fest: Cocteaus Wunsch nach Rätseln, die dem Publikum bleiben sollen, wird erfüllt.
Literatur
Christian Baier, Poesie des Verlierens. Zum Orpheus-Komplex, in: Neue Zeitschrift für Musik 2003, Nr. 5, S. 14–19.
Peter G. Davis, Orpheus Dissenting, in: New York Magazine, 7. Juni 1993, S. 57.
Reinhard Oehlschlägel, Wandlungen der Avantgarde. Amerikanische Ansätze, in: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 4, 1975–2000, hrsg. von Helga de la Motte-Haber, Laaber 2000, S. 31f.
Philip Glass. Orphée – The Making of an Opera, hrsg. von Karen Kopp u. a., Düsseldorf 1993.
Volker Straebel, Philip Glass, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Auflage, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 7, Kassel u. a. 2002, Sp. 1052–1057.
Study Guide Season 2011/2012. Orphée by Philip Glass, hrsg. von der Virginia Opera.
Anthony Tommasini, Nipping down to hell with Philip Glass, in: The New York Times, 29. Juli 2010.
Georg Philipp Telemann: Die wunderbare Beständigkeit der Liebe, oder Orpheus
Yvonne Rohling
Georg Philipp Telemann: Die wunderbare Beständigkeit der Liebe, oder ORPHEUS (1726) – ein Orpheus-Suchbild
Als Georg Philipp Telemann am Beginn des 18. Jahrhunderts auf der Bildfläche der Opernkomponisten erschien, war von einer ›deutschen Oper‹ noch kaum zu sprechen. Die politische Zerrissenheit des deutschsprachigen Raums nach dem 30-jährigen Krieg stand auch in der Musik einem Nationalgedanken entgegen. Anders war das in Italien oder Frankreich: Hier kann schon früh von spezifischen musiktheatralen Gattungen wie der Opera seria, der Tragédie lyrique oder dem Ballett gesprochen werden. Insbesondere die Opera seria war auch an den deutschen Höfen willkommen; nach einem ›eigenen‹ Stil bestand gar keine Notwenigkeit oder Nachfrage. Wenn sich dennoch jemand an einem kleinen Hof der ›deutschen Oper‹ zuwandte, dann meist aus dem Grund, dass die finanziellen Mittel nicht ausreichten um sich anderes leisten zu können. Inhaltlich beherrschten dabei generell (noch) die antiken Mythen das Geschehen: Adonis, Herkules und natürlich Orpheus waren beliebte Sujets der Libretti.

Dass sich auch Telemann dieser Vielfalt bediente, zeigt zunächst die Wahl der Libretto-Vorlage: Er orientierte sich inhaltlich an der Tragédie Orphée von Michel Du Boullay (Libretto) und Louis Lully (Komponist). Der Bezug auf das Italienische und Französische in der Musik lässt sich hingegen an einem weiteren Faktor erkennen: Telemann komponierte in unterschiedlichen Stilen und Sprachen. Die Da-capo-Arie in italienischer Sprache als unantastbares Vorbild fügte er in ein sonst überwiegend deutschsprachiges Libretto ein. Auch fanden Tanz- und Instrumentalsätze nach französischen Vorbildern Einzug in die Oper. Insgesamt schrieb Telemann so neun Arien in italienischer Sprache bzw. mit italienischem Vorbild und sieben Arien im französischen Stil bzw. in französischer Sprache. Der Großteil der Oper ist jedoch in Deutsch verfasst, so dass sie zu den ersten Werken gehört, in denen Deutsch als Kunstsprache verwendet wurde.
Bereits der Beginn vereint die verschiedenen Stile: Nachdem die Einleitung am Vorbild der französischen Ouvertüre angelehnt ist, schließt sich eine Da-capo-Arie in deutscher Sprache an, gesungen von einem Hauptcharakter der Oper. Die Rede ist allerdings nicht von Orpheus: Vielmehr wird die Oper von der verwitweten thrakischen Königin Orasia eröffnet, die letztlich zum Motor der Handlung wird und in ihrer dramaturgischen Funktion an die Stelle des Schicksals tritt. Orasia wird aus Eifersucht zur Mörderin an Euridice und aus verschmähter Liebe zur Rächerin an Orpheus.
Durch die Nennung von Orpheus im Titel der Oper kommt der Rezipient jedoch nicht umhin, eine Erwartungshaltung zu entwickeln: Dem antiken Mythos folgend, stehen laut dem Titel Orpheus als Mensch und sein Leid, wenn er seine geliebte Euridice (sogar zweimal) verliert, im Mittelpunkt. Doch letztlich wagt Telemann einen Kunstgriff, der den Aspekt der Liebe auf eine andere Weise ins Zentrum rückt – auch aus diesem Grund nimmt das Werk eine Sonderstellung unter den Vertonungen des Orpheus-Stoffes ein: Die zentrale Figur ist nicht Orpheus, sondern Orasia. Anstatt den antiken Orpheus-Mythos zu wiederholen, wird ein neuer Weg eingeschlagen; durch die Konstruktion dieser Schlüsselrolle bekommt das Libretto eine andere Dimension.
Zwar werden die Grundzüge des Orpheus-Stoffes aufgegriffen – der Handlungsort Thrakien, Euridices Schlangenbiss, dass Orpheus nach seinem Scheitern zum Frauenfeind wird oder auch, dass er von den Mänaden zerrissen wird –, jedoch werden sie in einem anderen Kontext (um)gedeutet. Orasias Liebe zu Orpheus und ihre Eifersucht sind Ursprung und Ursache der Handlung. Seine Heirat mit Euridice ist ihr ein Dorn im Auge. So wird sie zur Initiatorin des Schlangenbisses, um Euridice aus dem Weg zu räumen und Orpheus für sich gewinnen zu können. Das zentrale Element der Handlung bleibt hingegen unangetastet: Orpheus steigt in die Unterwelt hinab und überzeugt Pluto, Euridice aus dem Hades gehen zu lassen. Doch auf dem Rückweg dreht er sich um und verliebt sich ein zweites Mal in Euridice, muss sie daraufhin jedoch zurücklassen. Allerdings erfährt Orpheus in der Unterwelt auch, wer hinter dem Schlangenbiss und Euridices Tod steckt.
Orasia sieht sich zu dieser Zeit am Ziel: Sie wartet am Eingang zur Unterwelt und ist bereit, Euridice ein zweites Mal zu töten. Es kommt aber, wie es kommen muss: Orpheus und Orasia treffen aufeinander, er weist sie im Wissen um ihre Tat erneut zurück. Aufgrund dieser Abweisung wandelt sich Orasias Liebe in Hass: Sie lässt Orpheus von den Bacchantinnen töten. Doch allzu schnell bereut sie ihre Tat und folgt Orpheus durch Selbstmord ins Reich der Toten. Dort wird ihr Kampf um Orpheus wahrscheinlich weitergehen: Ein glückliches Ende bleibt aus.
Letztlich offenbart sich ein Spiel der Gefühle und um die Liebe. Auffällig ist, dass von Beginn an eine Dreiecksbeziehung konstruiert ist, deren Intrigen- und Verwechslungsspiel durchaus auch an einen Buffa-Stoff erinnert. Doch Orasia ist die zentrale Figur. Vielleicht gibt Telemann diesen Hinweis schon im Titel mit der Nennung der »Beständigkeit der Liebe« bis in den Tod und darüber hinaus. Zehn Jahre nach der Hamburger Uraufführung benannte er die Oper jedoch zu Die Rachbegierige Liebe, oder ORASIA, Verwittwete Königin in Thracien um. Orpheus ist nun gänzlich aus dem Titel verschwunden; Telemann macht endgültig deutlich, wen er als Hauptcharakter erachtet hat. Das unterstreicht, dass in Telemanns Oper der antike Orpheus-Mythos lediglich die Grundlage einer weitergesponnenen Geschichte um Liebe und Eifersucht bildet.
Literatur
Peter Huth, Orpheus: Eine neue Lesart des Orpheus-Mythos, Booklet zur CD-Einspielung Orpheus (Akademie für Alte Musik, Rias-Kammerchor, René Jacobs), Harmonia mundi France, 1998.
Ders., Telemanns Orpheus – Ein Singe-Spiel? Booklet zur DVD-Aufnahme von Die wunderbare Beständigkeit der Liebe oder Orpheus, Oper in drei Akten von Georg Philipp Telemann, Zentrum für Telemann-Pflege und Forschung, Magdeburg 2010.
Richard Petzoldt, Georg Philipp Telemann. Leben und Werk, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1967.
Siegbert Rampe, Georg Philipp Telemann und seine Zeit, Laaber: Laaber 2017.
Igor Stravinskij: Orpheus
Franziska Schumacher
Igor Stravinskij: Orpheus (1948)
Stravinskijs etwa 30-minütige Orpheus-Ballettmusik nach Ovids Metamorphosen entstand in den Jahren 1947/48 und wurde 1948 in New York uraufgeführt. Als Charaktere treten Orpheus, Euridice, die Furien, die Bacchantinnen, Hades und Apollo auf. Anstatt Amor (wie beispielsweise bei Gluck) erscheint in Stravinskijs Fassung ein »Todesengel«.

Die Vorgeschichte um Euridices Tod wird ausgelassen; wie bei Gluck beginnt das Ballett mit ihrem Begräbnis, einem Lento sostenuto mit Orpheus’ Klage über Euridices Tod. Anmerkungen in der Partitur beschreiben die Szenerie:
»Orpheus steht reglos mit dem Rücken zum Publikum da. Freunde schreiten an ihm vorüber und grüßen voller Mitleid.«
Begleitet von der Harfe, wird der Klagegesang in Abwärtsbewegungen einer phrygischen Skala ausgedrückt. Die Spielweise »près de la table« resultiert in einem ›trockenen‹ Klang, mit dem Stravinskij an den Klang der Kithara anspielte. Der Todesengel, dessen Auftritt von dramatischen Holz- und Blechbläsern begleitet wird, führt Orpheus in die Unterwelt.[1] Dort treten die Furien ihnen mit aufgeregten Drohgebärden entgegen. Orpheus ›kontert‹ in der Air de danse, dem Herzstück des Balletts. Es gelingt ihm, die Bewohner der Unterwelt durch die Macht der Musik zu besänftigen. In der Partitur sind für dieses Stück zwar keine Handlungsanweisungen, dafür aber musikalische Hinweise notiert – quasi rezitativisch sollen Harfe und Streicher den Gesang des Orpheus abbilden. Der ›barocke‹ Gestus wird noch greifbarer, wenn ab Takt 80 die Oboen zu einem Zwiegesang ansetzen. Hier liegt ein Vergleich mit der Arie Zerfließe, mein Herze aus Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion nahe. Beide Stücke stehen in der Tonart f-Moll, die der Tonartensymbolik aus Johann Matthesons Neu-eröffnetem Orchestre zufolge tiefe Trauer auszudrücken vermag. Die duettierenden Oboen, die Stravinskij als ›obligate Instrumente‹ von der Harfe begleiten lässt, sind bei Bach ebenso vorgegeben. Auch motivisch zitiert Stravinskij aus dieser Arie. Zugleich lässt sich aber beobachten, wie er mit dem Bekannten bricht: Während die Melodie ähnlich dem barocken Vorbild erklingt, spielt die Harfe dazu ›falsche‹ Akkorde; wenn zum Beispiel im zweiten Takt eigentlich die Dominante (C-Dur) erklingen sollte, hört man immer wieder ›Störtöne‹.
Warum stellte Stravinskij diese Verbindung zu einer Passionsvertonung her? Der Orpheus-Mythos wurde seit der Spätantike auch christlich interpretiert. Schon im frühen Christentum gab es Vergleiche zwischen König David und Orpheus: Beiden wurde zugeschrieben, durch die Macht der Musik große Dinge bewirkt zu haben, beide werden mit dem gleichen Instrument porträtiert. Thomas von Aquin und Augustinus stellten auch Verbindungen zu Christus her: Wie Orpheus besiegte er durch seinen Gang in die Unterwelt den Tod und stieg aus Liebe ins Totenreich hinab – »aus Liebe will mein Heiland sterben«, heißt es etwa in Bachs Matthäus-Passion.
Im achten Bild von Stravinskijs Ballett ist nun auch Hades tief bewegt durch Orpheus’ Musik. Die Furien eilen herbei, verbinden dem Sänger die Augen und führen Euridice zu ihm. Nun kann man im neunten Bild einen Pas de deux verfolgen; der Paartanz ist musikalisch durch kontrapunktische Stimmführungen abgebildet. Nachdem sich die Musik zu einem hoffnungsvollen C-Dur aufschwingt, nimmt Orpheus seine Augenbinde ab, worauf der ›Gesang‹ abrupt abbricht und Euridice (während einer Generalpause, seit jeher einem Todessymbol der musikalischen Rhetorik) ein zweites Mal stirbt. Diese weitere Abweichung von der Stoffvorlage mag durch die Choreographie begründet sein: Euridices erneuter Tod wird nicht dadurch hervorgerufen, dass Orpheus sich zu ihr umdreht, sondern durch das Abnehmen der Augenbinde.
Im weiteren Verlauf zeigt Stravinskij den Tod des Orpheus (Pas d’action): Er wird von den Bacchantinnen oder Mänaden in Stücke zerrissen, da er nach Euridices Tod den Frauen gänzlich entsagen wollte. Doch ist damit das Ende noch nicht erreicht: In einem Epilog erscheint Apoll und nimmt die Lyra aus den Händen des Toten. Ihr Lied wird zum Himmel erhoben, was symbolisch Orpheus’ Apotheose darstellt. Stravinskij selbst beschrieb in einem Gespräch die musikalische Umsetzung des Epilogs folgendermaßen:
»›Sehen Sie die Fuge hier‹, sagte er beispielsweise und zeigte auf den Beginn des Epilogs. ›Die beiden Hörner führen sie durch, während Trompete und Violine eine langgezogene Melodie, eine Art cantus firmus vortragen. Klingt das nicht wie eine mittelalterliche Vielle?‹ […] Hier, sehen Sie, zerschnitt ich die Fuge wie mit einer Schere. Dann fahren die Hörner mit ihrer Fuge fort, als sei nichts passiert. […] Sie können diese Harfensolo-Einschübe weglassen, die Teile der Fuge zusammenfügen und werden ein vollständiges Stück haben.«[2]
Diese Harfensoli sind Rückgriffe auf die Air de danse des Orpheus. Indem sie auch nach mehrmaliger Unterbrechung immer wieder ansetzen, erhalten sie eine unaufhaltsame Wirkung: Orpheus ist zwar tot, doch geht die Musik weiter, als ob sie nicht enden wollte. Die phrygische Abwärtsbewegung des Beginns wieder zwar aufgegriffen, schon nach wenigen Takten aber zu einer dorischen Aufwärtsbewegung umgewandelt: Die Musik steigt zum Himmel und wird vergöttlicht.
Eine Vertonung des Orpheus-Mythos durch Igor Stravinskij mag eine ›moderne‹ Inszenierung erwarten lassen. Die Uraufführung war jedoch weitgehend ›klassisch‹ inszeniert und ins Mythische abstrahiert. Die Rezension von John Martin in der New York Times fiel positiv aus; auch der Bühnen- und Kostümbildner wird gelobt:
»It is an extraordinarily beautiful work, realized in a rare theatrical synthesis. […] Though his costumes are less successful than his spare and sculptural décor, he has managed to clothe the figures in just the kind of impersonality they should have. […] Once again his feeling for materials has served him well, and he has provided a sheer white silk drop curtain that is both visually and dramatically wonderful.«
Allerdings blieb Stravinskijs Orpheus weithin unbekannt. Auch dazu äußerte schon die New York Times eine Vermutung, dass nämlich das Stück zweifellos nichts für jeden sei, aber trotzdem ein bemerkenswertes Werk, reich an Schönheit für diejenigen, die sie finden könnten.[3]
Literatur
Artikel in The New York Times vom 29. April 1948 (John Martin, Stravinsky Work in World Premiere), 16. Mai 1948 (ders., The Dance: “Orpheus”) und 17. Januar 1949 (ders., City Unit Features ‘Orpheus’ Ballet).
Wolfgang Burde, Strawinsky. Leben, Werke, Dokumente, Erweiterte Neuausgabe, Mainz u. a.: Schott 1982.
Anmerkungen
[1] In diesem kurzen Zwischenspiel verwendet Stravinskij eine Tonfolge aus zehn Tönen (b–cis–e–c–b–g–as–c–a–b) über einem b-Moll-Dreiklang.
[2] Wolfgang Burde, Strawinsky, S. ##.
[3] John Martin, Stravinsky Work in World Premiere, in: The New York Times, 29. April 1948.
Jacques Offenbach: Orphée aux Enfers
Caroline Sanden
Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers (1858) – zwischen Mythentravestie und Gesellschaftskritik
»Orpheus, Direktor der Musikschule von Theben; Musikstunden pro Monat oder stundenweise.«
Diese Türinschrift ist das Erste, was dem Zuschauer ins Auge fällt, nachdem sich der Vorhang zu Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers (Orpheus in der Unterwelt) gehoben hat. Orpheus, dessen Musik der Sage nach selbst Götter und Steine erweichen kann, ist in Offenbachs Werk ein Musiklehrer, der mit seinem Geigenspiel seine Ehefrau zur Weißglut bringt. Seine Frau Eurydike fühlt sich durch seine Musik zugleich belästigt und vernachlässig, Orpheus dagegen findet, sie wisse sein Genie so gar nicht zu schätzen.
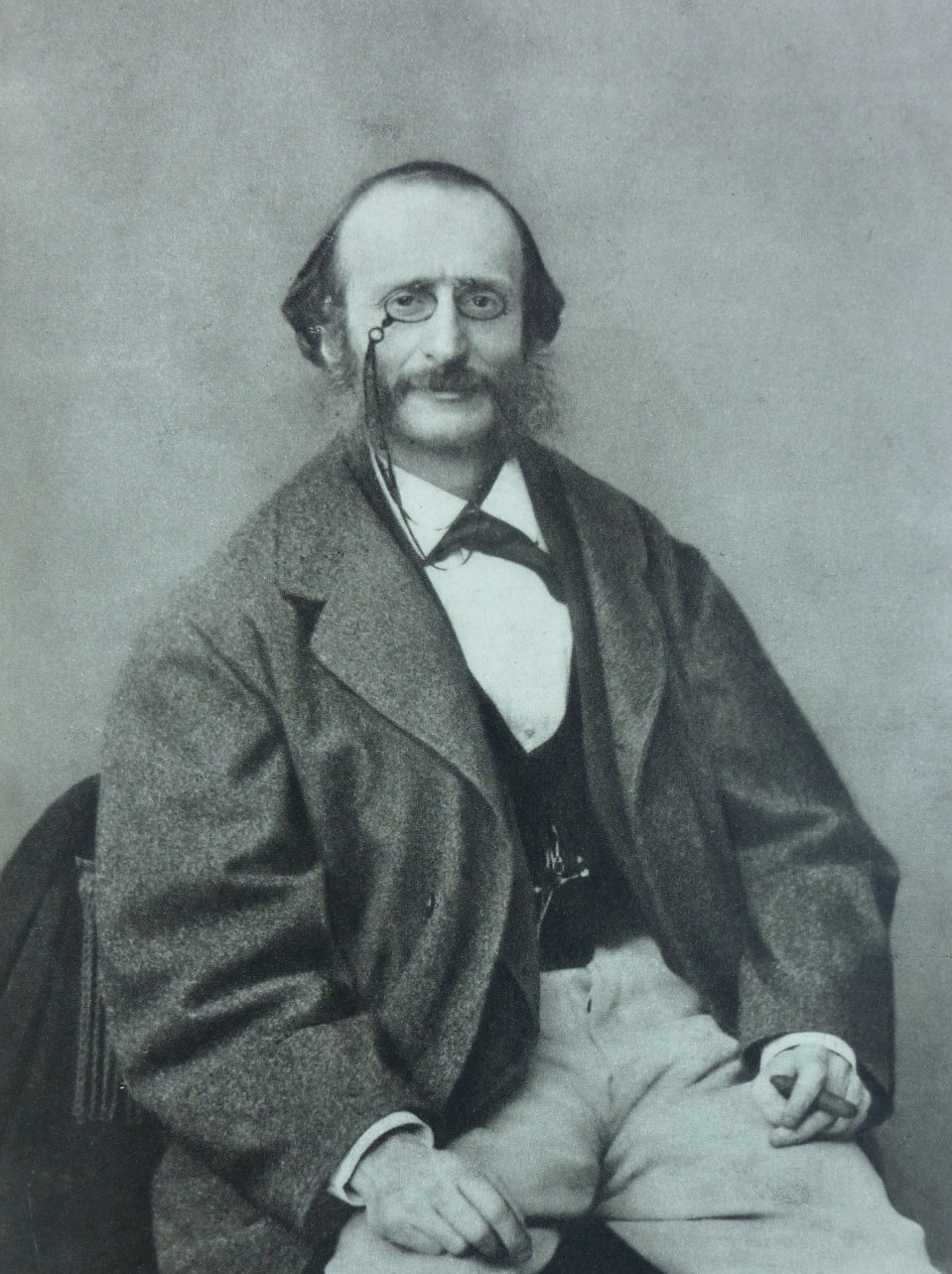
Die Idee zu dieser Parodie auf den bekannten antiken Mythos stellten Offenbachs Librettisten Hector Crémieux und Ludovic Halévy ihm schon im Jahre 1856 vor.[1] Zwei Jahre und eine Aufstockung des Personalbestandes von Offenbachs Theater später konnte Orphée aux Enfers in Paris schließlich uraufgeführt werden. Der Komponist wählte für sein Werk zwar vorerst die Bezeichnung »opéra-bouffon«, inzwischen wird es jedoch als »Operette« geführt – und Offenbach bezeichnete sein Werk später auch selbst so:[2] Während also Gluck 1762 mit seiner Oper über den Orpheus-Stoff eine Reform der Oper in Paris vorangetrieben hatte, begründete Offenbach mit Orpheé aux Enfers an gleicher Stelle die Gattung der Operette.[3]
Orpheus in der Unterwelt bescherte Offenbach finanziellen Erfolg und internationale Bekanntheit. Seine Mythenparodie erfuhr Nachahmungen in aller Welt; das Schlussstück, der Galop infernal, mit dem Offenbach den aus Algerien stammenden Cancan auf die Bühne brachte, ist eines seiner bekanntesten Stücke und erfreut sich bis heute großer Bekanntheit. Der Zusammenbruch des Kaiserreichs, dem Offenbach einen Teil seines Erfolges zu verdanken hatte, beendeten seine größten Triumphe allerdings. Er komponierte zwar unverdrossen weiter, erlebte den weltweiten Erfolg von Hoffmanns Erzählungen (1881) allerdings schon nicht mehr.[4]
Offenbachs Verarbeitung des Orpheus-Mythos bewegt sich zwischen Mythentravestie und Gesellschaftskritik. Travestie bezeichnet dabei mit Volker Klotz eine »verblüffende, heiter-bedenkliche Verkleidung«:[5] Man erlebt einen antiken Mythos also in völlig neuem Gewand. Vieles wird zwar verändert, um den Mythos in anderem Licht darstellen zu können, aber trotzdem bleiben grundsätzliche Entsprechungen: Götter wie Jupiter und Pluto, die Herrscher über Olymp und Unterwelt, und natürlich Orpheus und Eurydike. Die ›Verkleidung‹ beginnt allerdings mit der Einführung einer völlig neuen Figur, und zwar der »Öffentlichen Meinung«.
Orte des Geschehens sind die Gegend von Theben, der Olymp und die Unterwelt. Das Handlungsmuster des Mythos – Eurydikes Tod, Orpheus’ Rettungsversuch und sein Scheitern – bleibt erkennbar, wird allerdings stark verändert, vor allem ausgelöst durch die vollkommen anderen Charaktereigenschaften der Figuren. So ist Orpheus keinesfalls traurig über den Verlust seiner Frau. Im Gegenteil, er ist sogar außerordentlich froh darüber, denn das Ehepaar hat sich schon lange auseinandergelebt, und mittlerweile zeigen beide unverhohlenes Interesse an anderen Personen: Orpheus an einer schönen Nymphe, Eurydike an dem – aus Vergils Georgica entlehnten – Schäfer Aristeus. Doch hinter dem Schäfer verbirgt sich bei Offenbach und seinen Librettisten in Wahrheit Pluto, der Gott der Unterwelt, der Eurydike mit in den Hades nimmt. Orpheus hinterlässt sie immerhin eine Nachricht:
»Verlassen muß ich diese Schwelle,
denn ich bin tot ohn’ allen Zweifel,
Aristeus war der Gott der Hölle,
und jetzt holt mich der Teufel.«
Doch Orpheus’ Frohlocken über den Tod seiner Frau wird unterbrochen: Die Öffentliche Meinung fordert ihn auf, seine Gattin aus der Unterwelt zurückzufordern. Orpheus muss ihr gehorchen; schließlich hängen sein Ansehen und sein guter Ruf als Musiklehrer von der Öffentlichen Meinung ab. Im Olymp langweilen sich derweil die Götter und rebellieren gegen Jupiters Herrschaft. Sie werfen ihm vor, sie mit fadem Nektar und Ambrosia ruhigzustellen. Orpheus und die Öffentliche Meinung erscheinen, auf Geheiß der Öffentlichen Meinung bezichtigt Orpheus Pluto der Entführung. Um die Wahrheit herauszufinden, beschließt Jupiter in die Unterwelt zu reisen – die anderen Götter alle im Schlepptau.
Eurydike langweilt sich in der Unterwelt währenddessen ebenfalls. Pluto konnte seine erotischen Versprechen nicht einhalten. Auch sein stets betrunkener Diener Hans Styx hat mit seinem Werben um Eurydike keinen Erfolg. Dann jedoch taucht Jupiter in der Gestalt einer Fliege auf und kann Eurydike betören. Er verspricht ihr eine heimliche Entführung. Das finale Bild beginnt mit einem Höllenfest für die olympischen Gäste. Jupiter stellt die Bedingung, dass Orpheus Eurydike dann mitnehmen darf, wenn er sich nicht nach ihr umdreht: Da Orpheus Eurydike ja gar nicht mehr liebt, ist das eigentlich auch nicht zu erwarten. Dann aber schleudert Jupiter einen Blitz, Orpheus erschrickt und dreht sich um. Zu beiderseitiger Erleichterung erhält er Eurydike also doch nicht zurück. Um sein Ansehen zu wahren, darf Jupiter Eurydike jetzt natürlich weder sich noch Pluto zusprechen. Also bestimmt er, dass sie sich als Bacchantin dem Gefolge des Gottes des Weins anschließen soll. Von ihrer Freiheit beflügelt, stimmt Eurydike den Cancan an und die Operette endet mit einem wilden Tanz.
In antiken Heldensagen spielt das heroische Handeln die zentrale Rolle. Orpheus handelt im ursprünglichen Mythos wie ein Held: mutig und aus Liebe. Er ist bereit, alles für Eurydike zu tun. Doch in Offenbachs Operette bestimmen andere Muster das Geschehen. Das Werk stellt vor allem einen Konkurrenzkampf dar, der die Motive und Handlungsweisen der Protagonisten bestimmt. Dabei geht es sowohl um den Kampf ums Prestige als auch um den Kampf um Eurydike, zugleich um einen Kampf zwischen Olymp und Unterwelt. Nur Orpheus spielt in diesem Kampf überhaupt keine Rolle. Das Werk vollführt also im Prinzip eine »Verkehrung von antik heroischem in bourgeoises Handeln. Dem aber […] können auf der Bühne nur unberechenbar widerbürgerliche Ausbrüche in die Quere schießen: Lust auf unbegrenzte, unnütze, unvernutzbare Energieentladungen im Lieben, Trinken, Tanzen.«[6] Am Ende aber erreicht keiner der Götter das Ziel: Niemand ›besitzt‹ Eurydike am Schluss. Und sie selbst wetteifert ausschließlich mit ihren eigenen sehnsüchtigen Leidenschaften, denen kein Mann und kein Gott gewachsen ist – auch nicht in veränderter Gestalt, was sie immer nur vorübergehend beeindruckt.[7]
Die drei Duette der Operette – Orpheus und Eurydike, Öffentliche Meinung und Orpheus, Jupiter und Eurydike – zeigen diesen Kampf um Eurydike und heben sich auch musikalisch von den restlichen Stücken ab. Das erste Duett stellt die Beziehungsprobleme von Orpheus und Eurydike dar; es geht um das Verhältnis von Mann, Frau und Violine. Mit großer Geste versucht Orpheus zwar, Eurydike mit seiner Musik zu beeindrucken: Sie hingegen ist zutiefst genervt von seinem Geigenspiel. Dabei untermalt die Musik ihr Beziehungsproblem: Orpheus ist in seine Musik so versunken, dass er nicht einmal merkt, dass er Eurydike (statt seines Instruments) in ihrer Empörung dabei viel faszinierende Klänge entlockt als zuvor.[8]
Insofern lässt sich argumentieren, dass in dieser Operette eigentlich Eurydike als Hauptfigur bezeichnet werden sollte. Sie eröffnet das Werk, ist an zwei wichtigen Duetten beteiligt, der Konkurrenzkampf der Männer dreht sich einzig um sie, die Geschichte geht für sie am besten aus, sie stimmt den finalen und ausufernden Schlusstanz an und hat damit auch ›das letzte Wort‹. Das Ende erhöht sie zur Priesterin des Bacchus und gibt ihr erstmals einen eigenen Raum abseits ihrer Liebhaber.[9] Diese Schlusswendung richtet sich satirisch gegen die besitzgierigen Göttermänner Pluto und Jupiter und parodiert mit dem Cancan die typischen Finalensembles der großen Oper. Offenbach möchte aber nicht nur die Gattung Oper im Allgemeinen parodieren, er baut auch eine ganz konkrete Anspielung auf Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice ein. Die Öffentliche Meinung fordert Orpheus auf, nun um Eurydike zu bitten, woraufhin dieser Glucks Arie Ach ich habe sie verloren (Che farò senza Euridice / J’ai perdu mon Eurydice) anstimmt. Aber die Götter sind der allseits bekannten Arie längst überdrüssig: Im Gegensatz zum antiken Mythos kann Orpheus mit seiner Musik also weder Eurydike noch die Götter beeindrucken.
Orphée aux Enfers bringt nicht nur musikalische Parodien, sondern auch gesellschaftskritische Elemente. Das betrifft vor allem die Darstellung Jupiters, seines Regiments und der Langeweile bzw. des ennui der Götter. Jupiter setzt augenscheinlich »mehr auf Schein als auf Sein«:[10] »Alles für die Etikette und durch die Etikette!«, heißt es im zweiten Bild. Wenn Offenbach und seine Librettisten damit vermutlich Napoleon III. treffen wollten, reagierte dieser beim Besuch einer Vorstellung jedoch souverän und zeigte sich außerordentlich begeistert.[11] Trotzdem waren die Reaktion nicht nur positiv. Jules Janin verurteilte kurz nach der Uraufführung, was er als Missbrauch des Mythos auffasste: »Welch Profanation des glorreichen Altertums dieser Orpheus ist!«[12] Damit weckte er jedoch erst das Interesse: Die Vorstellungen der nächsten Wochen waren ausverkauft; die Librettisten kolportierten, dass die komischsten Partien eigentlich nur wörtliche Zitate von Janin seien.[13] Zutiefst amüsiert zog es das Publikum noch monatelang in die Vorstellungen, um Offenbachs Parodie des Mythos von Orpheus und Eurydike mit eigenen Augen zu sehen.
Literatur
Crémieux, Hector, und Ludovic Halévy: Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt. Opéra bouffon in zwei Akten und vier Bildern, hrsg. von Henning Mehnert, Stuttgart: Reclam 2001.
Grun, Bernhard: Kulturgeschichte der Operette, Berlin: Lied der Zeit Musikverlag 1967.
Klotz, Volker: Operette. Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst, München: Piper 1991.
Klügl, Michael: Erfolgsnummern. Modelle einer Dramaturgie der Operette, Laaber: Laaber 1992.
Kracauer, Siegfried: Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit, hrsg. von Karsten Witte, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976.
Anmerkungen
[1] Henning Mehnert, Nachwort zu Hector Crémieux’ und Ludovic Halévys Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, S. 118.
[2] Ebd., S. 116.
[3] Ebd., S. 113.
[4] Volker Klotz, Operette, S. 510.
[5] Ebd., S. 512.
[6] Ebd., S. 512.
[7] Ebd., S. 513.
[8] Ebd., S. 515.
[9] Michael Klügl, Erfolgsnummern, S. 100.
[10] Henning Mehnert, Nachwort zu Hector Crémieux’ und Ludovic Halévys Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, S. 114.
[11] Ebd.
[12] Bernhard Grun, Kulturgeschichte der Operette, S. 126.
[13] Ebd., S. 127.
Franz Liszt: Orpheus
Magdalena Engels
Die Symphonische Dichtung Orpheus (1853/54) von Franz Liszt
Als Weimarer Kapellmeister führte Franz Liszt ab 1848 nicht nur die dortige Hofkapelle aus 38 fest angestellten Musikern zu neuen Höchstleistungen:[1] Mit seinen einsätzigen »Symphonischen Dichtungen« wollte er zudem auf eine neue Weise die Dichtkunst (teils auch die Bildende Kunst) mit der Tonkunst verbinden. Diesen Kompositionen stellte er stets ein »der rein instrumentalen Musik in verständlicher Sprache beigefügtes Vorwort« voran, »mit welchem der Komponist bezweckt, die Zuhörer gegenüber seinem Werke von der Willkür poetischer Auslegung zu bewahren und die Aufmerksamkeit im voraus auf die poetische Idee des Ganzen […] hinzuweisen«.[2]
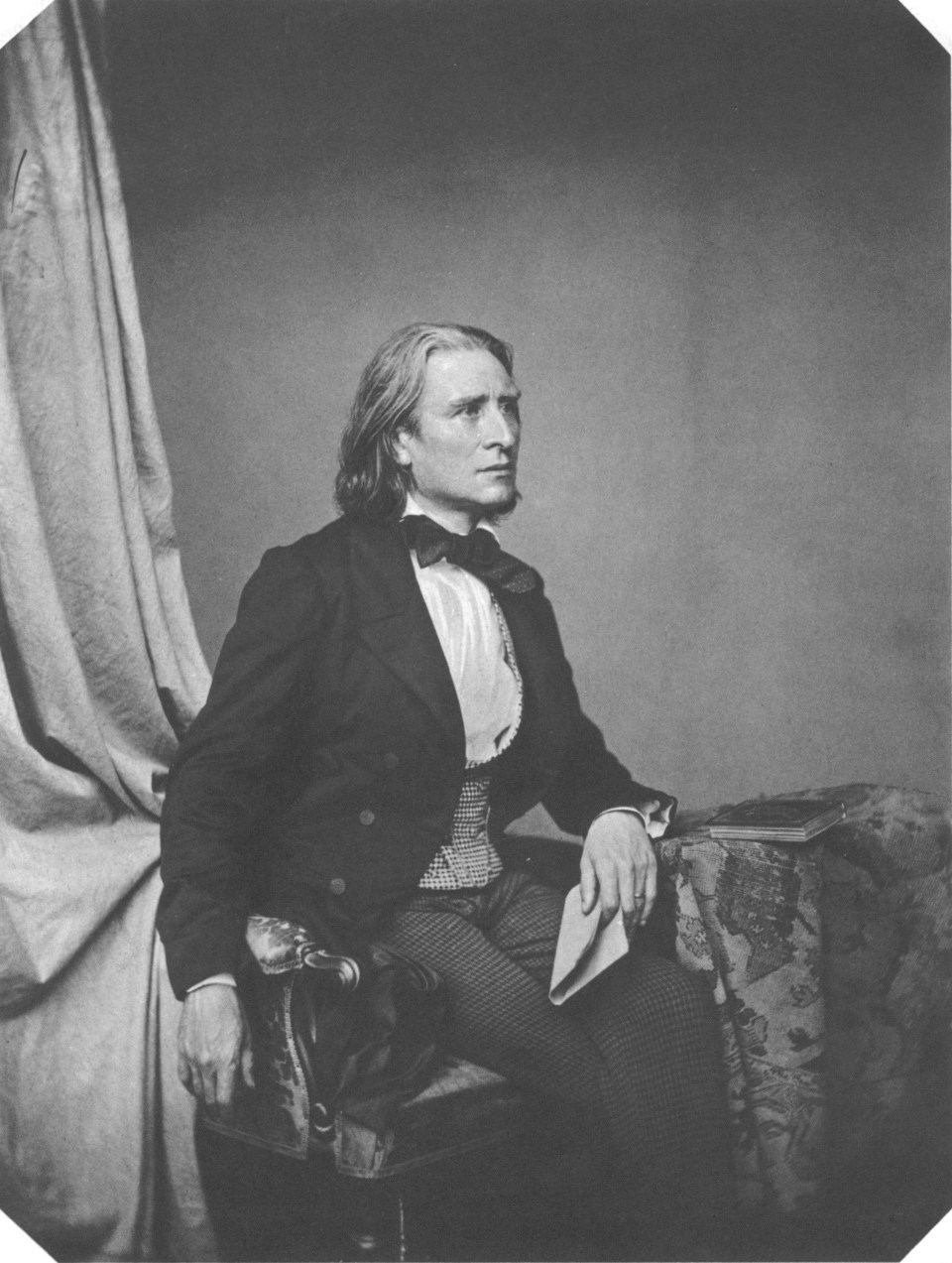
Die Aufführung von Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice unter der Leitung Liszts hatte ihn Mitte der 1850er Jahre zur Komposition seiner vierten Symphonischen Dichtung bewegt, die zugleich als Introduktion zu Glucks Oper dienen sollte. Während Gluck Orpheus nicht primär als übermenschlichen Halbgott, sondern als trauernden Gatten darstellte,[3] wollte sich Liszt von dieser Deutung wiederum distanzieren und verstand den Orpheus-Stoff stattdessen symbolisch und als Imagination des griechischen Mythos.[4]
Die Symphonische Dichtung Orpheus lässt sich im Rahmen ihrer einsätzigen Form in drei Teile untergliedern. Indem Liszt nicht nur eine, sondern sogar zwei Harfen einsetzt, verweist er schon klanglich auf Orpheus als mythischen Harfen- oder Leierspieler. Aus dem Liegeton der Hörner wird dabei in der Einleitung in C-Dur in den Violoncelli ein erstes Thema entwickelt, das mit Bezug auf Liszts Vorwort mitunter als Zeichen für den Gesang des Orpheus beschrieben worden ist:

Der Mittelteil im terzverwandten E-Dur nimmt dieses Thema dann auf und verarbeitet es im Sinne der »Themenmetamorphose« oder »Motivtransformation«. Aus dem initialen Thema entsteht durch ständige Entwicklung eine Vielzahl unterschiedlicher Gestalten. Ein zweites Motiv tritt hinzu, das sich – musikalisch mit einer über den Hörnern und über Dreiklangsbrechungen der Harfen gleichsam schwebenden Linie der Solovioline – mit der Nennung der »elysischen Lüfte« und »Weihrauchwolken« in Liszts Vorwort (siehe unten) assoziieren lässt:

Arnfried Edler beschrieb diesen Mittelteil auf Grundlage dieser Transformationen generell als ein »Bild des ständigen Umherirrens, der Verheißungen und Enttäuschungen«.[5] – Der Schlussteil, der wiederum in C-Dur steht, ist klanglich von Streichertremoli und Harfenarpeggien geprägt. Spiegelbildlich zum Beginn lösen sich die thematischen Gestalten an dieser Stelle wieder auf: Nach einem anfänglich aufbrausenden und sich allmählich beruhigenden Abschnitt sinkt, nochmals mit Edler gesprochen, Orpheus’ »Klage in […] Gestaltlosigkeit reiner Harmonien«. Die den Tonraum umgreifenden Harmonien lösen sich im Schlussklang, in der »Naturharmonie«, auf.[6] Orpheus, in Liszts Vorwort als Symbol der Kunst apostrophiert, schwebt gleichsam dahin.

Liszt legt mit dieser Symphonischen Dichtung einen Kontrast zur Gluck’schen Auffassung des Mythos vor. Orpheus und Eurydice versteht er als Symbole: Das Ideal, Eurydice, wird von Übel und Schmerz verschlungen, was der Mythos im Tod der Eurydice ausdrückt. Die (ethisch und metaphysisch wirkende) Kunst, durch Orpheus symbolisiert, bringt es zwar fertig, das Ideal aus der Finsternis der Unterwelt herauszuführen: Es gelingt ihr jedoch nicht, das Ideal auch auf Erden zu halten – die beiden Liebenden Orpheus und Eurydice werden voneinander getrennt. Liszt selbst beschrieb dies in seinem Vorwort wie folgt:
»Heute wie ehemals und immer ist es Orpheus, ist es die Kunst, welche ihre melodischen Wogen, ihre gewaltigen Akkorde wie ein mildes, unwiderstehliches Licht über die widerstrebenden Elemente ergiesst, die sich in der Seele jedes Menschen, und im Innersten jeder Gesellschaft im blutigen Kampf befehden. Orpheus beweint Eurydice, das Symbol des im Uebel und im Schmerz untergegangenen Ideals. Es ist ihm vergönnt, sie den Dämonen des Erebus zu entreissen, sie heraufzubeschwören aus den Finsternissen der Unterwelt, nicht aber sie im Leben zu erhalten«.
So tritt in Liszts Symphonischer Dichtung im 19. Jahrhunderts auch die Instrumentalmusik in die Diskussion über die Kunst und das Ideale ein: Sie stellt die Macht der Tonkunst als Gegenpol zur Barbarei dar – und fügt damit der Interpretationsgeschichte des antiken Orpheus-Mythos eine weitere Facette hinzu.
Liszts Vorwort in der Übersetzung von Peter Cornelius:
Als wir vor einigen Jahren den Orpheus von Gluck einstudirten, konnten wir während der Proben unsre Fantasie nicht verhindern, von dem in seiner Einfachheit ergreifenden Standpunkt des grossen Meisters zu abstrahiren, und sich jenem Orpheus zuzuwenden, dessen Name so majestätisch und voll Harmonie über den poetischen Mythen der Griechen schwebt. Es war dabei das Andenken an eine etrurische Vase in der Sammlung des Louvre in uns wieder lebendig, auf welcher jener erste Dichter-Musiker dargestellt ist, mit dem mystischen königlichen Reif um die Schläfe, von einem sternbesäeten Mantel umwallt, die Lippen zu göttlichen Worten und Gesängen geöffnet, und mit mächtigem Griff der feingeformten schlanken Finger die Saiten der Lyra schlagend. Da scheinen die Steine gerührt zu lauschen und aus versteinten Herzen lösen sich karge, brennende Thränen. Entzückt aufhorchend stehen die Thiere des Waldes, besiegt verstummen die rohen Triebe der Menschen. Es schweigt der Vögel Gesang, der Bach hält ein mit seinem melodischen Rauschen, das laute Lachen der Lust weicht einem zuckenden Schauer vor diesen Klängen, welche der Menschheit die milde Gewalt der Kunst, den Glanz ihrer Glorie, ihre völkererziehende Harmonie offenbaren.
Heute noch sprosst aus dem Herzen der Menschheit, wie auch die lauterste Moral ihr verkündigt ward, wie sie belehrt ist durch die erhabensten Dogmen, erhellt von Leuchten der Wissenschaft, aufgeklärt durch die philosophischen Forschungen des Geistes und umgeben von der verfeinertsten Civilisation, heute noch wie ehemals und immer sprosst aus ihrem Herzen der Trieb zur Wildheit, Begier, Sinnlichkeit, und es ist die Mission der Kunst, diesen Trieb zu besänftigen, zu veredeln. Heute wie ehemals und immer ist es Orpheus, ist es die Kunst, welche ihre melodischen Wogen, ihre gewaltigen Akkorde wie ein mildes, unwiderstehliches Licht über die widerstrebenden Elemente ergiesst, die sich in der Seele jedes Menschen, und im Innersten jeder Gesellschaft in blutigem Kampf befehden. Orpheus beweint Eurydice, das Symbol des im Uebel und im Schmerz untergegangnen Idelas. Es ist ihm vergönnt, sie den Dämonen des Erebus zu entreissen, sie heraufzubeschwören aus den Finsternissen der Unterwelt, nicht aber sie ihm Leben zu erhalten. Möchten mindestens nie jene Zeiten der Barbarei wiederkehren, wo, wie trunkne, zügellose Mänaden, wilde Leidenschaften die Kunst erliegen machen unter mörderischen Thyrusstäben, indem sie in fiebertollem Wahn sich rächen für die Verachtung, mit welcher jene auf ihre rohen Gelüste herabsieht.
Wäre es uns gelungen, unsern Gedanken vollständig zu verkörpern, so hätten wir gewünscht, den verklärten ethischen Character der Harmonien, welche von jedem Kunstwerk ausstrahlen, zu vergegenwärtigen, die Zauber und die Fülle zu schildern, womit sie die Seele überwältigen, wie sie wogen gleich elysischen Lüften, Weihrauchwolken ähnlich mälig sich verbreiten; den lichtblauen Aether, womit sie die Erde und das ganze Weltall wie mit einer Atmosphäre, wie mit einem durchsichtigen Gewand unsäglichen mysteriösen Wohllauts umgeben.
Literatur
Edler, Arnfried: Studien zur Auffassung antiker Musikmythen im 19. Jahrhundert, Kassel u. a.: Bärenreiter 1970.
Stegemann, Michael: Franz Liszt. Genie im Abseits, München: Piper 2011.
Anmerkungen
[1] Michael Stegemann, Franz Liszt, S. 170.
[2] Zitiert nach Arnfried Edler, Studien zur Auffassung antiker Musikmythen im 19. Jahrhundert, S. 160.
[3] Ebd., S. 148.
[4] Ebd., S. 149.
[5] Ebd., S. 143.
[6] Ebd., S. 146.
Marc-Antoine Charpentier: La Descente d’Orphée aux Enfers
Clarissa Renner
La Descente d’Orphée aux Enfers von Marc-Antoine Charpentier
Als eine der letzten Auftragskompositionen für das Haus de Guise vertonte Marc-Antoine Charpentier Ende 1686 / Anfang 1687 den Orpheus-Stoff – und zwar schon zum zweiten Mal. Bereits einige Jahre zuvor hatte er sich des Mythos angenommen und eine Kantate für drei Männerstimmen (mit Orpheus, Tantalus und Ixion als handelnden Personen) und Instrumentalensemble geschrieben. Orphée descendant aux Enfers (H 471) gilt heute als die erste französische Kantate.[1]

Charpentier war nach seiner Rückkehr aus Rom im »Hôtel de Guise« untergekommen und unterstand als hauseigener Komponist den Wünschen der Hausherrin, der offenbar nach einem Bühnenstück auf der Grundlage des Orpheus-Mythos zumute war.[2] Dieses Werk, La Descente d’Orphée aux Enfers (H 488; der Librettist ist unbekannt), ist autograph in den Mélanges autographes überliefert und niemals in einem zeitgenössischen Druck erschienen: Der Protektionismus und die gewollte Exklusivität der Mäzene hatten den Ausschluss der Öffentlichkeit zur Folge, sodass auch kein anderes Werk Charpentiers aus dieser Zeit gedruckt wurde.[3] Seit der letzte männliche de Guise verstorben war, experimentierte die Witwe Madame de Guise mit der Ausrichtung diverser vergnüglicher Veranstaltungen.[4] Die von ihr in Auftrag gegebenen Kammeropern wurden teils am königlichen Hof aufgeführt, wo Madame de Guise den Winter verbrachte und Charpentier Kontakte zu den Musikern des Dauphin und dem Kronprinzen selbst knüpfen konnte,[5] teils in der Pariser Residenz ihrer Schwester, der Mademoiselle de Guise.[6] Charpentiers Orpheus-Oper war also in jedem Fall einer Elite vorbehalten und wurde bis zur Wiederentdeckung vermutlich auch nur ein einziges Mal konzertant[7] aufgeführt.
Im Frankreich des 17. Jahrhunderts bestand eine Reihe von musiktheatralen Gattungen nebeneinander, was die Einordnung von Charpentiers Orphée erschwert. Eine Tragédie lyrique kann aufgrund des fehlenden allegorischen Prologs und der differierenden Zahl der Akte als Modell ausgeschlossen werden.[8] Die eingefügten Tänze, die zum Teil durch die Angaben in der Partitur eindeutig auf Affekte bezogen sind, könnten eine Comédie-ballet plausibel erscheinen lassen, in der versucht wurde, Tanz und Musik nicht abzugrenzen, sondern in der Verbindung der Künste ein intermediales Theatererlebnis zu schaffen.[9] Gilbert Blin rechnet La Descente d’Orphée aux Enfers aber der »großen französischen pastorale en musique« zu.[10] Die Merkmale einer Pastorale werden besonders im ersten Akt deutlich, wenn die Nymphen Daphne, Enone (Oinone) und Aréthuse mit Euridice auf einer Wiese die Vermählung des Brautpaares feiern und der Bach durch die Wassernymphe Aréthuse und die Vögel durch die Bergnymphe Enone angerufen werden, in den fröhlichen Gesang einzustimmen. Neben dem Chor der Nymphen tritt auch ein Chor der Hirten auf, der den pastoralen Charakter weiter verstärkt. Charpentier wählt für den Beginn die Tonart A-Dur, die er selbst später für den Ausdruck eines fröhlichen Affekts und einer ländlichen Umgebung empfahl.[11]
Die Oper bezieht sich auf die Lesart des Mythos nach Ovids Metamorphosen, die aber durch einige Elemente erweitert wird. So fällt die Rolle des Boten bei Charpentier weg. Stattdessen stößt Orphée zufällig zum Geschehen und Euridice stirbt schließlich in seinen Armen. Wie in Monteverdis L’Orfeo[12] (bei Charpentier allerdings noch im ersten Akt) hält ihn sein Vater Apoll vom Selbstmord ab. Er rät ihm, stattdessen Euridice in die Unterwelt zu folgen und um ihre Rückkehr zu bitten. Der zweite Akt erscheint als Kernstück dieser Geschichte und ist sehr ausführlich ausgearbeitet. Die erste und zweite Szene ist den drei Sündern Tantalus, Ixion und Tityos vorbehalten, die, nachdem sie ihre ewigen Qualen besungen haben, durch den Gesang des Orphée von ihren Strafen zumindest für eine kurze Zeit befreit werden: Hier wird zum ersten Mal in Charpentiers Oper die Wirkungskraft der Musik auf der Bühne dargestellt.
Wenn nun Orphée vor Pluto tritt, um mit seinem Gesang dessen Mitleid zu erwecken, gelingt ihm das zunächst allerdings nicht. Pluto bleibt über eine lange Zeit standhaft, während Proserpine und die Geister der Unterwelt schon längst zu Tränen gerührt sind. Schließlich scheint es nicht die Musik, sondern der Blick Proserpines zu sein, der Pluto umstimmen kann und Euridice unter der unheilvollen Bedingung des Blickverbots an Orphée zurückgibt. An dieser Stelle endet der zweite Akt und mit ihm die überlieferte Partitur. Der dritte Akt ist nicht erhalten.[13]
Auch mit dem kleinen Ensemble, das ihm zur Verfügung stand, gelang es Charpentier, zwischen den verschiedenen Örtlichkeiten der Szenen zu differenzieren. So sind die zwei Traversflöten die musikalischen Begleiter der Euridice. Solange Orphée auf der Erde weilt, begleiten ihn zwei Violinen, wenn er schließlich in die Unterwelt hinabsteigt, übernehmen zwei Gamben diese Funktion. Im mutmaßlich abschließenden dritten Akt hätte Orphée wohl ein zweites Mal in die Unterwelt hinabsteigen müssen, nachdem die Mänaden ihn ob seiner Absage an das weibliche Geschlecht getötet hatten. Dieser zweite Gang in die Unterwelt schwebt als Moral der Geschichte für den wissenden Zuhörer von Beginn an über dem Werk. Auch ahnt Orphée selbst das Unheil, wenn er zum Ende des zweiten Aktes sagt: »Amour, brûlant Amour, pourras tu te contraindre? Ah! Que le tendre Orphée à lui même est à craindre« (»Liebe, glühende Liebe, kannst du dich wohl beherrschen? Ach! Wie sich der liebende Orpheus vor sich selbst fürchtet«). Dennoch stellt er mit seinem zweiten Gang in die Unterwelt das Gleichgewicht zu dem zweimaligen Sterben der Euridice her.
Literatur:
Blin, Gilbert: La Descente d’Orphée aux Enfers, Booklet zur Aufnahme des Boston Early Music Festival, übersetzt von E. van den Hoogen, 2014.
Hitchcock, Hugh Wiley: La Descente d’Orphée aux Enfers H. 488, Booklet zur Aufnahme William Christie, übersetzt von I. Trautmann, 1995.
Lattarico, Jean-François: Thésée, la première des tragédies, in: L’Europe Baroque. Oper im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. von Isolde Schmid-Reiter und Dominique Meyer, Regensburg: ConBrio, S. 65–71.
La Laurencie, Lionel de: Un opéra inédit de M.-A. Charpentier: La Descente d’Orphée aux Enfers, in: Revue de Musicologie 10, 1929, Nr. 31, S. 184–193.
Ranum, Patricia M.: Charting Charpentier’s ‘Worlds’ through his Mélanges, in: New Perspectives on Marc-Antoine Charpentier, hrsg. von Shirley Thompson, Farnham: Ashgate 2010, S. 1–29.
Schroedter, Stephanie: Modelle der Interaktion von Tanz und Musik im französischen Theater des 17. und 18. Jahrhunderts: Ballet de Cour, Comédie ballet, Tragédie lyrique und Opéra ballet, in: L’Europe Baroque. Oper im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. von Isolde Schmid-Reiter und Dominique Meyer, Regensburg: ConBrio, S. 73–94.
[1] Hugh Wiley Hitchcock, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 14.
[2] Zu Anlass und Auftraggeberschaft der Komposition siehe auch Gilbert Blin, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 19f.
[3] Patricia M. Ranum, Charting Charpentier’s ‘Worlds’ through his Mélanges, S. 4.
[4] Ebd., S. 13.
[5] Es ist also anzunehmen, dass die Oper im Beisein des Dauphin aufgeführt wurde, zumal einige seiner Musiker diejenigen der Madame de Guise unterstützten: vgl. Gilbert Blin, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 20.
[6] Patricia M. Ranum, Charting Charpentier’s ‘Worlds’ through his Mélanges, S. 20.
[7] Gilbert Blin zieht sogar eine Aufführung in Zweifel und hält die Angaben in der Partitur zur Sängerbesetzung für ein Indiz, dass das Werk nur geprobt, eine szenische Aufführung aber intendiert war (La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 17).
[8] Jean-François Lattarico, Thésée, la première des tragédies, S. 66.
[9] Stephanie Schroedter, Modelle der Interaktion von Tanz und Musik im französischen Theater des 17. und 18. Jahrhunderts, S. 81.
[10] Gilbert Blin, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 15.
[11] Hugh Wiley Hitchcock, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 15.
[12] Es stellt sich die Frage, ob Charpentier diese Oper vielleicht in seiner Zeit am Jesuitenkolleg und als Schüler von Carissimi in Rom kennengelernt hatte.
[13] Es gibt keine expliziten Hinweise auf einen dritten Akt. Es könnte also auch sein, dass es nie einen gegeben hat oder dass die Oper nicht vollendet wurde. Die Literatur ist sich aber im Grunde einig, dass es einen verlorengegangenen dritten Akt gegeben haben muss. Gilbert Blin erklärt ausführlich, warum aus seiner Sicht ein Ende nach dem zweiten Akt gar nicht denkbar wäre (La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 15f.).
Claudio Monteverdi: L’Orfeo
Katharina Konrad
Einigkeit und Kontrastierung in Claudio Monteverdis L’Orfeo
Lange hielt man Claudio Monteverdis L’Orfeo für die erste Opernkomposition überhaupt. Für die Stadt Mantua stellte sie tatsächlich den Beginn der neuen Gattung dar, jedoch war der Orpheus-Stoff bereits um 1600 von Jacopo Peri und Giulio Caccini in Florenz vertont worden. Deren Versionen gelten heute überwiegend als »Opernversuche«,[1] wogegen Monteverdis L’Orfeo als erstes musikalisches Drama mit »werkhaftem Charakter«[2] angesehen wird. Innovativ gegenüber seinen Vorgängern zeigt sich Monteverdi durch die erstmals in der Partitur fixierte Akteinteilung.[3]

Die drei Komponisten sind sich zwar in der Stoffwahl einig, in der Ausarbeitung unterscheiden sie sich jedoch gänzlich. Peri und Caccini bedienten sich am Text von Ottavio Rinuccinis L’Euridice, aus Alessandro Striggios Feder stammt hingegen Monteverdis Libretto, bei dessen Gestaltung der Komponist wohl auch selbst mitgewirkt hat. Erstere stellen die arkadische Gemeinschaft in den Mittelpunkt und nutzen durchgängig Rezitation mit Generalbass, wohingegen Monteverdi den Fokus auf Orfeo als Individuum legt und ihm virtuose Soloabschnitte gibt. Besonders neu für das Publikum war auch die Tatsache, dass während des gesamten Stücks »singend gesprochen« wird. Was uns heute als völlig normal erscheint, verursachte der ersten Operngeneration Kopfzerbrechen: das Singen des dramatischen Dialogs. Es entsprach der verosimiglianza, der Wahrscheinlichkeit, dass Menschen beim Kommunizieren sprechen, nicht etwa singen.[4] Peri und Caccini bemühten sich also um einen Kompromiss zwischen Rezitation und Gesang, doch ließ sich der Widerspruch nicht einfach aus der Welt schaffen.
Es galt einen Kunstgriff einzusetzen: An welchen Ort könnte man das Geschehen versetzen, an dem das Singen nicht als unnatürlich wahrgenommen würde? Die Antwort lautet: nach Arkadien, »wo der Gesang im täglichen Leben nichts Ungewöhnliches war, wo die Poesie ihre Heimat hatte, und wo über allen Leidenschaften, edlen und bösen, der golddurchwirkte Schleier eines friedvollen Paradieses lag.«[5] Der verosimiglianza zuliebe gab es nun den Ortswechsel von Thrakien nach Arkadien, so dass Orpheus von musikbegabten Hirten und Nymphen umgeben war.
Inhaltlich setzt sich die Oper mit der Wirkung von Musik auseinander und betritt mit dieser Selbstreflexion eine metadramatische Ebene. Besonders deutlich wird das im Prolog, einem aus der Tragödie übernommenem Element, in dem die personifizierte Musica einen Teil der Handlung vorwegnimmt. Nicht die Wiedergabe der Handlung steht also im Mittelpunkt, sondern die Art der Darbietung ist entscheidend,[6] mit welchen Mitteln der Komponist und die ausführenden Künstler den Zuschauern den Stoff vermitteln wollen. Ebenso verwunderlich scheint die Anweisung an das Publikum, es solle regungslos dem Bühnenspiel folgen. Bei einer tragischen Liebesgeschichte klingt das zunächst paradox, doch soll sich der Zuhörer vielleicht seine Urteilsfähigkeit erhalten und nicht wie Orfeo an seinen unkontrollierten, übergroßen Gefühlen scheitern. Der Prolog als Formteil an sich verweist schon auf die antike Tradition, so wie die Tatsache, dass es einen Illusionsbruch durch die Ansprache des Publikums gibt, der im antiken Theater noch kein Tabu darstellte: Handlung und Aufführungssituation müssen nicht streng voneinander getrennt werden.
Passend zur Thematisierung der Wirkungsweise von Musik schließt sich die Wahl des Protagonisten an. Als Sohn von Apollon, dem Gott der Musik, gelingt es Orpheus, selbst die unbelebte Natur mit seinem Gesang zu bewegen. Auch der Komponist Monteverdi sieht den Zweck der Musik darin, die Herzen der Zuschauer zu rühren. Damit stellt er sich gegen den älteren Kunstbegriff, der den Verstand als letzte Instanz zur Beurteilung von Musik ansah.[7] Monteverdi wollte mit spontanen, überraschenden und außergewöhnlichen Wendungen in der Musik die Zuhörer bewegen (»muovere«). Die Art des Sprechens und des Vortrags folge doch schließlich dem Zustand der Seele. Mit seiner seconda pratica betont Monteverdi, dass es ihm nicht um die strikte Befolgung von Gesetzmäßigkeiten und Regeln gehe, sondern die oberste Prämisse solle sein, dem Textinhalt gerecht zu werden.[8] »Der Textvortrag ist die Herrin des musikalischen Satzes und nicht ihre Dienerin.«[9] Also spürt Monteverdi den emotionalen Gehalt in den Worten auf und bringt ihn beispielsweise in dissonanten Fortschreitungen zum Vorschein. Zudem traut er sich, Dissonanzen frei eintreten zu lassen, anstelle der satztechnisch »erlaubten« Vorhalts- und Durchgangsdissonanzen. Auch vor Moduswechsel innerhalb eines Stücks, welcher der musikalischen Einheit des Werkes widerspricht, jedoch einen Wechsel der Affekte veranschaulicht, schreckte Monteverdi nicht zurück. Die konträren Affekte im L’Orfeo stechen deutlich in Auge und Ohr: Freude im paradiesischen Arkadien, Schmerz und Klage in den Unterweltszenen. Insgesamt nutzt Monteverdi das ästhetische Prinzip des Kontrastierens häufig, um die verschiedenen Welten auszuschmücken. Auffällig ist dies zum Beispiel am Grundinstrumentarium: überwiegend Saiteninstrumente für die Oberwelt, Posaunen, Zinken und kleine Orgel für die Unterwelt.
Eine weitere Frage, die sich aufdrängt, lautet: Ist Orpheus ein Held oder ein Versager? Seine besondere Sangesgabe kann Caronte einschläfern und eröffnet dem Sänger den Zugang zur Unterwelt, doch der dortige Herrscher Plutone lässt sich mehr von den Worten seiner Frau Proserpina als von Orpheus’ Gesang überzeugen. Orpheus setzt seine Kunst nicht richtig ein, Erfolge bleiben aus, nicht einmal sich selbst kann er besänftigen.[10] Wie lässt man ein solch tragisches Spiel nun enden? Die Antwort ist nicht leicht, denn Libretto und Partitur bieten verschiedene Ausgänge. Orfeo beklagt sein Schicksal und schwört, da er seine geliebte Eurydike nicht haben kann, allen Frauen ab. Rinuccini, der seinen Text für eine Hochzeit verfasste, sah sich einem glücklichen Ende dermaßen verpflichtet, dass Orfeo seine Gattin Eurydike ohne Bedingungen aus der Unterwelt hinausführen kann und mit ihr glücklich vereint sein Leben verbringt. Die ausbleibende Katastrophe lässt den Konflikt zwischen Gefühlshingabe und Selbstbeherrschung sowie Übermut und Schicksalsfügung vermissen. Striggios Libretto distanziert sich dagegen von einem beseelten Ende: Orfeo muss vor den nach Rache dürstenden Bacchantinnen fliehen. Monteverdi schlägt versöhnliche Töne an. Orfeo ist der Liebe so hingegeben, dass er irdischem Begehren nicht entsagen kann, um sich dem überirdischen Ideal, der Tugend (»virtute«), zu verpflichten.[11] Daher kann der Sünder Orfeo zum Opernende nicht wieder mit seiner geliebten Frau zusammengeführt werden, doch wird ihm auf einem anderen Weg Erlösung zuteil. Anstelle der vergänglichen Liebe zu Lebzeiten wird Orfeo das ewige Leben an der Seite seines göttlichen Vaters Apoll geschenkt, von wo aus er Eurydikes Antlitz in den Sternen betrachten kann. Damit gelingt Monteverdi der Spagat zwischen Mythentreue und der Forderung nach einem lieto fine, er vereint zwei Forderungen in einem hoffnungsvollen Ende. Der Erfolg gibt ihm recht: Nach der Premiere folgten mehrere Aufführungen sowie ein zweifacher Druck der Partitur, als einzige Oper des 17. Jahrhunderts.
Literatur:
Leopold, Silke: Claudio Monteverdi und seine Zeit, Laaber: Laaber-Verlag 2002.
Orfeo. Orpheus und Eurydike, hrsg. von Attila Csampai und Dittmar Holland, Reinbek: Rowohlt 1988.
Osthoff, Wolfgang: Claudio Monteverdi. L’Orfeo. In: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Oper, Operette, Musical, Ballett, hrsg. von Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut Musiktheater der Universität Bayreuth, Bd. 4, München: Piper 1991, S. 241–244.
L’Orfeo. In: Lexikon der Oper, hrsg. von Elisabeth Schmierer, Laaber: Laaber-Verlag 2002, S. 293–295.
[1] Wolfgang Osthoff, L’Orfeo, S. 243.
[2] Ebd.
[3] L’Orfeo, hrsg. von Elisabeth Schmierer, S. 294.
[4] Orfeo, hrsg. von Attila Csampai und Dittmar Holland, S. 128f.
[5] Ebd., S. 129.
[6] Ebd., S. 32.
[7] Vgl. Silke Leopold, Claudio Monteverdi, S. 62.
[8] Ebd.
[9] Ebd.
[10] Orfeo, hrsg. von Attila Csampai und Dittmar Holland, S. 37f.
[11] Vgl. ebd., S. 34.
Daniel Ernst: Fantasie oder Sonate?
Daniel Ernst
Fantasie oder Sonate?
Analytische Betrachtungen zu
Felix Mendelssohn Bartholdys Fantasie op. 28
Einleitung
Eine gewisse ›Krise der Klaviersonate‹ im 19. Jahrhundert äußert sich unter anderem in der geringen Zahl der Gattungsbeiträge beispielsweise bei den Komponisten im Umkreis von Robert Schumann. Schumann selbst wandte sich nach drei Beiträgen (opp. 11, 14 und 22) von der Gattung ab, Johannes Brahms stellte die Sonatenproduktion ebenfalls nach drei Versuchen ein (opp. 1, 2 und 5), und auch Felix Mendelssohn Bartholdy beließ es bei seinen drei Jugendwerken (opp. 6, 105 und 106[1]). Jedoch stellt Mendelssohns Fantasie op. 28 eine weitere Auseinandersetzung mit der Sonate dar, die den Frühwerken folgte.[2]
In der vorliegenden Studie stehen zwei Fragen im Mittelpunkt: Gibt es in Mendelssohns op. 28 ein zyklisches Prinzip, das die attacca ineinander übergehenden Sätze[3] durch motivische Verknüpfung verbindet? Inwieweit ist unter Einbezug der motivischen Analyse sowie einem Vergleich von erstem und drittem Satz eine Sonatensatzform im Kopfsatz festzustellen? Dabei liegt der Fokus auf dem ersten Satz, da dort die Sonatensatzform eine besondere Rolle spielt. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen, was Mendelssohn zur Änderung des Titels von »Sonate écossaise« zu »Phantasie« bewogen haben könnte.[4] Außerdem stellt sich die Frage, inwieweit Mendelssohns kleiner dimensionierte Klavierwerke, speziell die Lieder ohne Worte, in die Fantasie hineingewirkt haben.
Um die Orientierung zu erleichtern, nehme ich eine dreisätzige Anlage an, deren Kopfsatz von T. 1 bis T. 135 (Con moto agitato ‒ Andante) reicht. Der zweite Satz (Allegro con moto) umfasst die Takte 136 mit Auftakt bis 231, der dritte (Presto) die Takte 232 mit Auftakt bis 468. Außerdem bedeutet die Schreibweise von beispielsweise »T. 35/2«: T. 35, Schlag 2; Taktzahlen in Klammern zeigen einen unvollständigen Takt an. Kleine Noten in den Notenbeispielen kennzeichnen strukturell weniger wichtige Töne, beispielsweise eine Dreiklangsbrechung auf leichter Zählzeit, einen Durchgang, Vorhalt und dergleichen. Auch wenn die Notenausgabe[5] den Titel »Phantasie« nennt, wird im Folgenden die Schreibweise Fantasie verwendet.
Forschungsstand
Mendelssohns Fantasie op. 28 spielte in der Literatur unter einem analytischen Gesichtspunkt bislang kaum eine Rolle. Sie steht im Schatten der 1839 veröffentlichten Fantasie op. 17 von Robert Schumann sowie anderer, größer angelegter Stücke gleichen Titels. Entsprechend dürftig nimmt sich die Zahl der Veröffentlichungen dazu aus, obwohl sie innerhalb von Publikationen zu Klavierfantasien durchaus Erwähnung findet. So führt Arnfried Edler sie im letzten Teil seines Überblickswerks Gattungen der Musik für Tasteninstrumente an, nicht ohne zu erwähnen, dass sie »eher am Rand von Mendelssohns Œuvre«[6] stehe. Dagmar Teepe erwähnt sie im Artikel Fantasie in MGG2S,[7] und Dietrich Kämper bespricht sie im Lichte von Mendelssohns Sonatenschaffen.[8] Dennoch kann von einer umfangreichen und detaillierten Darstellung keine Rede sein. Und wie sehr Mendelssohns Fantasie oft vernachlässigt wird, zeigt die Dissertation von Gudrun Fydrich,[9] die sich mit der Fantasiekomposition im 19. Jahrhundert beschäftigt: Hier werden ausschließlich Werke von Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin und Liszt berücksichtigt. So stellt Ullrich Scheidelers im Druck befindlicher Aufsatz[10] zur Fantasie op. 28 die bislang intensivste Auseinandersetzung mit diesem Werk dar.
Klaviersonate, Klavierfantasie und
Lied ohne Worte um 1830
Eine Annäherung von Sonate und Freier Fantasie fand bereits im 18. Jahrhundert statt,[11] namentlich bei Carl Philipp Emanuel Bach, der über die Freie Fantasie schrieb:
Eine Fantasie nennet man frey, wenn sie keine abgemessene Tacteintheilung enthält, und in mehrere Tonarten ausweichet, als bey andern Stücken zu geschehen pfleget, welche nach einer Tacteintheilung gesetzet sind, oder aus dem Stegreif erfunden werden.[12]
Bei Mozart findet sich die Verbindung seiner Sonate in c-Moll KV 457 mit der Fantasie in c-Moll KV 475, die andeutet, was sich weiterhin fortsetzen sollte:
Das Werk aktualisiert rückblickend die Freie Fantasie mit allen ihren Errungenschaften für die Musiksprache und für das musikalische Denken des 18. Jahrhunderts, und es deutet zugleich eine zentrale Richtung an, welche die Fantasie im 19. Jahrhundert einschlagen und die sie mit der Sonate zusammenführen wird.[13]
In der Folge wurden im ›mitteldeutschen‹ Raum wie auch in Österreich Fantasien und Capricci[14] komponiert, »in denen einzelne Abschnitte als Sonatenexpositionen, ganze Sonatenhauptsätze, Rondi, Menuette, ariose Mittelsätze, verbunden durch figurative und arpeggiert-modulierende Partien, gestaltet waren«.[15] In Werken nach 1800 erscheinen die gegenseitigen Einflüsse von Sonate und Fantasie je verschieden gewichtet: In Beethovens op. 27,1 und 2 dringen, folgt man dem Titel Sonata quasi una fantasia,[16] in die Sonate fantasieartige Elemente ein, während Schuberts sogenannte Wanderer-Fantasie in C-Dur (D 760) von 1822 Sonatenelemente aufweist, indem vier klar abgrenzbare Sätze feststellbar sind, die durch das Anfangsmotiv eine zyklische Verbindung aufweisen.[17]
Ferdinand Gotthelf Hand äußerte sich in seiner Aesthetik der Tonkunst[18] sowohl zur Fantasie als auch zur Sonate. Zum Kopfsatz einer Sonate führte er bezüglich der »Gemüthsstimmung« aus:
Das erste Allegro macht die Grundlage des Ganzen aus. Sein Inhalt läßt keine theoretische Voraussetzung zu; er selbst ist Product origineller Erfindung.[19]
Ist der ästhetische Gehalt des ersten Satzes demnach der Intuition des Komponisten überlassen, so folgt Hand in der formalen Gestaltung dem Prinzip der Dreiteiligkeit, das wohl Heinrich Birnbach mit seiner Aufsatzserie in der Berliner AmZ konstituierte, nachdem bereits im 18. Jahrhundert beispielsweise Johann Friedrich Anton Fleischmann[20] eine dreiteilige Satzanlage entworfen hatte.[21] Im ersten Teil ist der Ablauf von Erstem Thema, Modulation, Zweitem Thema und Koda[22] vorgesehen, wobei das Zweite Thema in Dursonaten auf der Dominante stehe und ihm eine »Passage« folgen könne. In Moll-Stücken sei innerhalb der Exposition die Modulation in die parallele Durtonart üblich.[23]
Zur Fantasie äußerte sich Hand ebenso sowohl zu ästhetischen Belangen, die unter anderem die »unmittelbarste Darstellung eines individuellen Seelenlebens« im »Scheine der Zufälligkeit«[24] fordern, als auch zu formalen Gesichtspunkten, für die er als gängige Gestaltung alternierende Allegro- und Adagio-Passagen sah.[25] In der Nähe der Fantasie zur Sonate macht Hand einen Widerspruch aus, da das Ungeplante und Skizzenhafte der Fantasie dem planvollen Ablauf einer Sonate entgegenstehe, und wirft solchen Fantasie-Kompositionen vor, sie seien »oft nur eine freiere Behandlung der Sonate«.[26]
Ein Grund für die zunehmende Dominanz der Fantasie liegt möglicherweise im sukzessiv abnehmenden Interesse an der Gattung Klaviersonate ab 1810, das sich bis 1830 noch verstärkte.[27] So konstatierte Robert Schumann:
Einzelne schöne Erscheinungen dieser Gattung [der Sonate für Klavier] werden sicherlich hier und da zum Vorschein kommen und sind es schon; im Übrigen aber, scheint es, hat die Form ihren Lebenskreis durchlaufen, und dies ist ja in der Ordnung der Dinge, und wir sollten nicht jahrhundertelang dasselbe wiederholen und auch auf Neues bedacht sein. Also schreibe man Sonaten oder Phantasien (was liegt am Namen!), nur vergesse man dabei die Musik nicht, und das andere erfleht von eurem guten Genius.[28]
Einerseits wird hier der Unterschied zwischen Sonate und Fantasie gleichsam aufgehoben, andererseits deutet sich an, wie paralysiert die Sonatenproduktion dem beethovenschen Erbe gegenüber stand. So überrascht es nicht, dass Schumann an den Sonaten der Zeit kurz vor 1840 kritisierte, sie seien »nur als eine Art Specimina, als Formstudien zu betrachten; aus innerem starken Drang werden sie schwerlich geboren.«[29] An anderer Stelle ergänzte er:
Und hätte denn Beethoven umsonst gelebt? Wer lesen kann, der hält sich nicht mehr bei dem Buchstabiren auf; wer Shakespeare versteht, ist über den Robinson hinüber; kurz der Sonatenstyl von 1790 ist nicht mehr der von 1840: Die Ansprüche an Form und Inhalt sind überall gestiegen.[30]
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewann das Lyrische Klavierstück[31] an Bedeutung und trat in der Folge in Konkurrenz zur in die Krise geratenen Klaviersonate.[32] In Mendelssohns Klavierschaffen spielen insbesondere die Lieder ohne Worte eine große Rolle. Im August 1832 erschien als Opus 19b ein erster Band unter dem Titel Original Melodies for the Pianoforte bei Novello in London, für die Mendelssohn vom deutschen Verleger Simrock den Titel Sechs Lieder ohne Worte für Pianoforte allein[33] wünschte. Schon bald fand diese Art von Klavierminiaturen zahlreiche Nachahmer.[34] Die später im Zusammenhang mit der Fantasie thematisierten opp. 19,4, 30,3 und 38,4 spielen in ihren akkordischen Sätzen laut Christa Jost auf einen Chorsatz an, zudem handelt es sich bei op. 19,4 um das erste Lied ohne Worte überhaupt.[35] Diese drei Stücke weisen einen Rahmen aus Arpeggien in ‒ im Vergleich zum choralhaften Satz ‒ kleineren Notenwerten auf, und ihnen allen ist »Symmetrie und Geschlossenheit der Melodik, akkordisch-homophoner Satz und Klarheit im Aufbau«[36] gemein. Die Liedsätze tragen die Tempobezeichnungen Moderato, Adagio non troppo und Andante. In der Fantasie ist der denkbar schlicht gehaltene ›Chorsatz‹ im Andante dagegen von den Akkordbrechungen durch das bewegtere Con moto agitato abgesetzt. Die Eröffnungsgeste der Lieder ohne Worte bringt Jost mit einer Musizierpraxis im 19. Jahrhundert in Verbindung, »beim Konzertvortrag einzelne Klavierstücke […] improvisierend einzuleiten und durch freie Zwischenspiele möglichst ungezwungen miteinander zu verbinden«.[37] Die Arpeggien, mit denen die Fantasie op. 28 beginnt und schließt, resultieren womöglich aus derselben improvisatorischen Tradition und nehmen zugleich ein Charakteristikum der Fantasie auf.
Entstehung und Einordnung
Bereits in den Jahren 1829 und 1830 begegnet in Mendelssohns Korrespondenz der Ausdruck »Schottische Sonate«[38]. Ob es dabei schon um die erstmals 1834 bei Simrock und Mori & Lavenu gedruckte Fantasie op. 28 geht, muss allerdings offen bleiben. Jedenfalls trägt das mit »Berlin d. 29. Januar | 1833« datierte Autograph die Überschrift »Sonate écossaise«[39] und weist somit gleichfalls einen verbalen Bezug zu Schottland auf. Von Mai 1830 bis Juni 1832 befand sich Mendelssohn auf einer Bildungsreise, auf der er unter anderem London besuchte; 1833 kehrte er noch zweimal auf die Insel zurück.[40] Schon zuvor hatte sich Mendelssohn mit der Gattung Klaviersonate beschäftigt, entsprechende Jugendwerke entstanden zwischen 1821 und 1827.[41] Spätestens die Fantasie setzte den endgültigen Schlusspunkt unter seine Auseinandersetzung mit dieser Gattung.
Für die Stichvorlage änderte Mendelssohn den Titel von »Sonate« zu »Phantasie« und versah dieses undatierte Autograph zusätzlich mit einer Widmung an Ignaz Moscheles.[42] Was Mendelssohn zur Änderung des Titels bewog, ist schwer nachzuvollziehen, jedoch finden sich Hinweise, dass er mit dem Titel zum Jahresende 1833 noch unsicher war: »Die fismoll Sonate oder Phantasie ist nun in Ordnung gebracht, und erscheint hier bei Simrock«.[43] Möglicherweise fiel auch die Revision und damit die Titeländerung in den Dezember 1833.[44] Gegenüber Simrock äußerte er sich am 7. Dezember 1833, indem er »eine größere Phantasie für Pianoforte allein«[45] zum Druck anbot. Am 11. Mai 1834 nannte Mendelssohns Schwester Fanny jedoch nochmals die andere Gattungsbezeichnung: »Deine Sonate aus Fis gefällt mir sehr, u. ich spiele sie fleißig, denn sie ist à la Felix sehr schwer.«[46]
Analyse
Der Kopfsatz von Mendelssohns Opus 28 scheint zunächst sehr disparate Teile zu vereinigen; seine Form wirkt ungewöhnlich. Für die folgende Analyse spielen zunächst die motivischen Bausteine aller Sätze eine Rolle, um sie anschließend in der Betrachtung der formalen Gestaltung des ersten Satzes zu integrieren.
Motivik
Während Ullrich Scheideler keine gemeinsamen Motive oder Themen in den einzelnen Sätzen sieht,[47] verhält sich dies für Dagmar Teepe anders: »Mendelssohn Bartholdys Fantasie in fis-Moll op. 28 […] stellt einen Einzelsatz mit lockerer Folge unterschiedlicher Teile dar, die durch motivische Bezüge zusammengehalten werden.«[48] Ähnlich sieht es Dietrich Kämper:
Es besteht Grund zu der Annahme, dass der Verzicht auf den Namen »Sonate« zugunsten der Bezeichnung »Phantasie« mehr bedeutet als eine bloße Zurücknahme des gattungsmäßigen Anspruchs. Auch hier, wie schon in Schuberts Wandererfantasie, verbindet sich der Terminus »Fantasie« offenbar mit Experimenten der Monothematik und der zyklischen Satzverbindung.[49]
Dagegen erwähnt Arnfried Edler motivische Beziehungen zwischen den Außensätzen: »Das in lockerer Sonatenhauptsatzform gehaltene Presto-Finale verweist mit versteckten motivischen Anspielungen auf den Kopfsatz zurück.«[50] Bleibt bei Kämper offen, ob sich die erwähnte Monothematik ausschließlich auf den ersten Satz oder auf das gesamte Werk bezieht und welches Motiv bzw. welches Thema beherrschend ist, so drücken sich auch die anderen Autoren kaum spezifischer aus. Dennoch ist der Widerspruch offensichtlich, entsprechend scheint eine genauere Analyse angemessen. Sie nimmt relevante Motive des ersten Satzes sowie Ableitungen in den Fokus und zeigt, wie engmaschig das motivische Netz geknüpft ist. Dabei müssen harmonische Aspekte zunächst zurücktreten.
Erster Satz
Der erste Satz wird durch athematisches Material in Form von Akkordbrechungen in Zweiunddreißigstel-Noten über einem Orgelpunkt eröffnet (T. 1‒8, Abb. 1a). Harmonisch ergibt sich die Folge T – DD – D – T, wobei es sich bei DD und D jeweils um Septnonenakkorde ohne Grundton handelt (Abb. 1b). Diese ›rauschende‹ Gestaltung der rechten Hand erscheint an verschiedenen Positionen des ersten Satzes; ihre formale Funktion wird im folgenden Kapitel genauer untersucht. Neben dem improvisatorischen Charakter lässt sich das Taktmaß und das Metrum in den ersten acht Takten hörend kaum deutlich bestimmen.
Abb. 1: a) Mendelssohn, Fantasie op. 28, T. 1–4, Ausschnitte rechte Hand
b) Schematische Darstellung der Harmonik T. 1–9
Abbildung 2 zeigt weiteres motivisches Material des ersten Satzes. In 1a–c sind die Motive in ihrer vordergründigen Erscheinung gezeigt, während 2a–c die jeweils zugrunde liegende intervallische Struktur ersichtlich macht. Den acht Eröffnungstakten folgt eine regelmäßig gebaute sechzehntaktige Periode, die in Phrase und Gegenphrase zwei unterschiedliche melodische Bausteine ausprägt (Abb. 2, 1a, T. 9 bzw. 1b, T. 11).
Die Dreiklangsmotivik am Beginn der Periode (T. 9–24) könnte als Ableitung der eröffnenden Akkordbrechung interpretiert werden. Allerdings erscheint das Satzbild zu different, und wie erwähnt ist die Akkordbrechung im Gegensatz zur Motivik des Anfangs der Periode athematisch. Die Periode bildet die Grundlage für Derivate. Für den ersten Satz sind auch die beiden Takte der Gegenphrase (T. 11f.) prägend, die in Abb. 2, 1b und 2b dargestellt sind. Eine Diminution von T. 11f. erscheint erstmals in T. 43f. – nun in A-Dur statt fis-Moll – und ist Ausgangspunkt für die Abspaltung der mittleren beiden Sechzehntel in T. 50f. Auf abstrakterer Ebene besteht dieses Motiv der Periode aus einem Sekundschritt nach unten (obere Klammer), der vordergründig im Terzrahmen (untere Klammer) umspielt wird. Bemerkenswert ist der Vorhalt, der auch in anderen Bildungen eine Rolle spielen wird. Die Figur in T. 25f. und die entsprechenden folgenden Takte bis einschließlich T. 33 unterscheiden sich zwar in der Intervallstruktur (siehe Abb. 2, 2b) von den restlichen Bildungen von 1b, bei denen der Terzrahmen wesentlich ist. Jedoch bleiben sowohl der nach unten bogenförmige Melodieverlauf sowie der untere Vorhalt im zweiten Takt erhalten.
Abb. 2: 1) Wesentliche Motive des ersten Satzes
2) Strukturelle Analyse (a–c ist jeweils zusammengehörig zu betrachten)
* = Vorhalt
Unter Abb. 2, 1c bzw. 2c fällt die Erscheinung ab T. 35/2, die ein Tetrachord abwärts zeigt, das durch angesprungene Vorhalte verziert ist und anschließend durch ein aufwärts gerichtetes Tetrachord rückwärts abgeschritten wird. Wie die Klammern zeigen, ist die abwärts gerichtete Bildung entfernt mit 2b verwandt, da auch sie sich aus Terzsprüngen und Sekundschritten zusammensetzt. Insgesamt steht zwar dem fallenden Tetrachord ein steigendes gegenüber, jedoch ist das gis von T. 37/1 durch veränderte Dynamik (plötzliches Piano in T. 37 nach vorhergehendem Crescendo) sowie die abgeänderte Intervallstruktur der ersten Takthälfte von T. 37 (Quart- statt Terzsprung) von der vorhergehenden melodischen Sequenz verschieden. Zudem setzt sich dieses letzte Glied von der vorhergehenden harmonischen Quintfallsequenz[51] ab, da diese dort keine Fortsetzung findet. Auch in der steigenden Tonleiter und der damit gekoppelten Aufwärtssequenz (steigender Parallelismus[52]) weicht das letzte Glied von der harmonischen Sequenz ab: Das cis“ in T. 39 ist mit einem zwischendominantischen Septakkord harmonisiert, der in die Subdominantregion (D-Dur) der lokalen Tonika A-Dur weist. Zwar erscheint anschließend ein d“, das den Tonleiterausschnitt fortsetzt, das aber durch das fis“ in die Mittelstimme verlagert und außerdem nicht mehr unter den Phrasierungsbogen gefasst ist. Dieser durch fis“ zustande kommende Wechsel in ein höheres Register ist womöglich durch das Wiederaufnehmen des zuvor in T. 29 erreichten und durch Oktavgriffe verstärkten fis“ sowie durch den Spitzenton des Abschnitts, d“‘, motiviert, der in den Takten 34 und 35 nochmals erscheint und damit der dargestellten Abwärtssequenz ab T. 35/2 vorausgeht. Diese Sequenz schließt sich dem über die Basslinie (T. 32f.) d–dis–e–fis–gis und auf a erreichten A-Dur unmittelbar an. Insofern mangelt es den Takten 35ff. an tonartlicher bzw. harmonischer Stabilität und thematischer Prägnanz, die hier ein eindeutiges Zweites Thema annehmen ließen. Auch die folgenden Takte (T. 37‒43) sind durch eine trugschlüssige Wendung in T. 41 harmonisch instabil, jedoch durch die melodische Linie ab T. 39/2, welcher der genannte Parallelismus aufwärts vorausgeht und mit ihr durch die Zwischendominante verbunden ist, thematisch eindeutiger gefasst. Melodisch bestehen die Bildungen der beschriebenen Stelle von T. 35/2ff. aus Tonleiterausschnitten, die an ihren Rändern die Verbindung zu ihrer Umgebung herstellen.
Zweiter Satz
Die folgenden beiden Sätze werden auf die bereits dargestellten Motive im ersten Satz untersucht. Der zweite Satz beginnt syntaktisch in der Art eines Satzes, der sich allerdings dergestalt fortsetzt, dass er lediglich sieben Takte umfasst.
Abb. 3: 2. Satz: 1a, 2a und 3a jeweils Melodik
1b, 2b und 3b jeweils strukturelle Analyse
* = Vorhalt
Bereits in diesem Notenbeispiel werden die Bezüge zur Motivik des ersten Satzes offensichtlich. Sogar die Abfolge der Motive der ersten sieben Takte ist der Periode des ersten Satzes ähnlich. Auf die Dreiklangsmotivik, die in den Halbe-Auftakten von T. 135 und 137 auftritt, folgt eine Kombination aus Terzsprung und Sekundschritt. In T. 140 erscheint eine ähnliche Situation wie im ersten Satz: Auch hier ist ein Tonleiterausschnitt wie von Abb. 2, 1c bzw. 2c erkennbar, wobei – artikulatorisch verdeutlicht – das e‘ noch dem unmittelbar vorhergehenden a‘ zuzuordnen ist, während die akkordisch gehaltene Fortsetzung ein Tetrachord bis zum h‘ weiterführt. Die Kadenzformulierung von T. 141/2f. (Alla breve) besteht wiederum aus einer Terz-Sekund-Struktur. Die Vorhaltsmotivik setzt sich in den Takten 143 bis 146 mit Auftakt kontrapunktisch fort. Und schließlich findet sich in T. 149/2‒152/1 in der Oberstimme eine in Terzen abwärts geführte Tonleiter, die insgesamt einen Tritonusrahmen (a‘ bis dis‘), also einen nun abwärts gerichteten Tonleiterausschnitt, ergibt.
Ab T. 153/2 (Abb. 3, 2a und 2b) geht die Satzstruktur in eine von Viertelnoten dominierte Melodik über, welche durchlaufende Achtelnoten begleiten. Auch hier wird, wie in Abb. 2, 1b bzw. 2b, die Struktur von Terz und Sekunde offenbar. Zusätzlich zeigt der obere Vorhalt den Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten Formteil. Eine erwähnenswerte Abwandlung bildet die Fortspinnung ab T. 169/2. Auch sie lässt sich auf die Dreiklangsstruktur beziehen, die in Abb. 2, 1a bzw. 2a gezeigt wurde.[53]
Dritter Satz
Der dritte Satz verweist noch eindeutiger auf den ersten zurück. Schon der Beginn (T. 231) nimmt die Dreiklangsbrechung der ersten beiden Takte der Periode im Kopfsatz auf und leitet davon die Formulierung von T. 241 mit Auftakt (T. 240) ab, die ebenso Ähnlichkeit zu Abb. 3, 3a bzw. 3b aufweist. In T. 293 erscheint hiervon eine Umkehrung.
Abb. 4: 1) Wesentliche Motive des dritten Satzes
2) Strukturelle Analyse (a–c ist jeweils zusammengehörig zu betrachten)
* = Vorhalt
Ab T. 248 sind die Läufe von T. 232f. mit Auftakt der rechten Hand in abgewandelter Form in die linke Hand verlagert und werden vom Motiv in Abb. 4, 1b (T. 248) kontrapunktiert. Auffälligstes Merkmal ist hier der obere Vorhalt, der schon im zweiten Satz wesentlich war, während im ersten Satz der untere Vorhalt eine wichtige Rolle spielte. Die sich anschließende Gestaltung (T. 257) verläuft schrittweise abwärts, wobei die im Terzabstand auf schwerer Zählzeit befindlichen Töne mittels Durchgängen erreicht werden. Die Mittelstimme nimmt dabei die Töne auf, die im ersten Satz T. 25f. eine Oktave tiefer erscheinen.[54]
Schließlich tritt ab T. 270/3 eine kantable Melodie mit einem charakteristischen oberen Vorhalt auf, wie dies bereits im zweiten (Abb. 3, 2a und 2b) und in Ansätzen auch im ersten Satz (Abb. 2, 1c bzw. 2c) der Fall war. Bezüglich der weiteren Ableitungen, speziell in der Durchführung (T. 304b–362), sei noch darauf verwiesen, dass hier neben Sechzehntel-Läufen (vgl. T. 231/5ff.) eine Variation des Motivs aus T. 293 prägend ist.
Die dargestellten Motive leiten sich von gebrochenen Dreiklängen bzw. von Kombinationen aus Terzsprung und Sekundschritt ab. Hinzu kommen längere Tonleiterausschnitte sowie Vorhalte, die sich besonders auf den letzten Ton eines Motivs konzentrieren. Die motivischen Bausteine lassen sich in allen Sätzen der Fantasie nachweisen und offenbaren deren dichte Arbeit.
Form
Bezüge zur Sonatensatzform
Inwiefern der erste Satz von Mendelssohns Fantasie op. 28 einer Sonatensatzform nach dem Schema Erstes Thema – Modulation [Überleitung] – Zweites Thema – Koda [Schlussgruppe][55] in der Exposition entspricht und damit den ursprünglichen Titel von »Sonate écossaise« stützt, wird im Folgenden untersucht. Fraglich ist vor allem, wo die Durchführung beginnt, ob ein Zweites Thema angenommen werden kann und wie die Anlage der Reprise zu erklären ist. Während sich der dritte Satz in der Bestimmung seiner Form weit unproblematischer als Sonatensatzform ausnimmt und die Teile Exposition (mit der genannten typischen Untergliederung), Durchführung und Reprise dort klar bestimmbar sind, weist der erste Satz Elemente auf, deren Einordnung in die Schematik Schwierigkeiten bereitet.[56]
Ullrich Scheideler interpretiert den Kopfsatz der Fantasie als A – B – A‘ – B‘ – A“, wobei es sich bei den A-Teilen um die ›rauschenden‹, mit der Tempovorschrift Con moto agitato versehenen Akkordbrechungen in Zweiunddreißigstel-Noten handelt. Der B-Teil (Andante) umfasst die Takte 9 bis 51, denn in T. 52 kehrt eine abgewandelte Form des Con moto agitato als A‘ wieder, deren Zweiunddreißigstel sich bis zum Wiedererscheinen der Periode (B‘) in T. 84 (ab T. 85 Tempovorschrift Andante) erstrecken. Der Bogen zum Beginn wird mit dem Teil A“ (ab T. 115) gespannt, der die Arpeggien vom Anfang aufnimmt und wiederum Con moto agitato gespielt werden soll.[57] Die Gliederung scheint hier vorrangig an Tempoaspekten orientiert zu sein. Diese Bogenform wird gleichzeitig durch eine Sonatensatzform überlagert, deren Teile Scheideler wie folgt bestimmt: Exposition (T. 1–43), Durchführung (T. 43–84) sowie Reprise (ab T. 84).[58]
Dieser Erklärung sei eine in Teilen abweichende Interpretation entgegengestellt. Der Frage nach der Rolle der anfänglichen Zweiunddreißigstel-Arpeggien lässt sich über die Betrachtung der Lieder ohne Worte nachgehen. Zwar ist die Annahme einer konkreten Auswirkung der Lieder ohne Worte auf die Fantasie und auch umgekehrt spekulativ,[59] doch erscheinen in op. 19,4, op. 30,3 und op. 38,4 Akkordbrechungen in kleinen Notenwerten, die das sonst homophone und choralartige musikalische Geschehen rahmen.[60] Diese Kombination von Arpeggien und ›Choralsatz‹ findet sich in der Fantasie in T. 1–24; der ›Choralsatz‹ löst sich danach sukzessive auf. Die Parallelen der genannten Lieder ohne Worte zur Fantasie gehen aber noch weiter: Opus 19,4 weist ab T. 13 einen gleichmäßigen Achtelpuls in der linken Hand auf, wie er in der Fantasie ab T. 25 zu finden ist, und Opus 30,3 zeigt eine melodische wie auch rhythmische Ähnlichkeit ab T. 3/3 zu T. 9f. der Fantasie. Die von Scheideler in der Fantasie mit A und A“ bezeichneten, eröffnenden bzw. schließenden Abschnitte liegen eigentlich außerhalb des dazwischenliegenden Teils, jedoch erscheinen die Zweiungddreißigstel-Arpeggien auch innerhalb der umrahmten Form. Sie treten in T. 34f. auf, wo, wie zu zeigen sein wird, Platz für ein Zweites Thema wäre, und prägen außerdem den musikalischen Ablauf der Takte 52 bis 59. Dennoch unterscheiden sich diese beiden Einschübe von den rahmenden Arpeggien: In T. 34f. ist die Dominante zur parallelen Durtonart (E-Dur –> A-Dur) durch die Figuration und zusätzlich durch das plötzliche Pianissimo herausgehoben. Die Takte 52 bis 59 erstrecken sich nicht über einen Orgelpunkt wie T. 1‒8 bzw. T. 115ff., sondern über ein absteigendes Tonleitersegment (ohne e), das von a und einer Wandlung von A-Dur zu a-Moll in T. 51 ausgeht. Der Ton fis in T. 52 ist zwischendominantisch zum Sextakkord von H-Dur in T. 54 harmonisiert, ebenso wie die Harmonik über gis zwischendominantisch auf den folgenden Sextakkord von cis-Moll bezogen ist.
Abb. 5: 1) Ausschnitte aus dem Durchführungsteil
(erster Satz, im Original alle Noten groß gedruckt)
2) Schematische Darstellung
* = Vorhalt
Dass der Durchführungsteil seine Oberflächengestaltung von der einleitenden und entsprechend von den direkt vorausgehenden Akkordbrechungen in Zweiungddreißigsteln erhält, ist offensichtlich. Allerdings zeigen sich auch motivische Bezüge der Takte 60ff. (Abb. 5, 1a bzw. 2a) zu Abb. 4, 1c bzw. 2c im Schluss- sowie Abb. 3, 2a bzw. 2b im Mittelsatz. Diese wären im Kopfsatz wegen des oberen Vorhalts vermutlich von Abb. 2, 1c bzw. 2c abzuleiten. Eindeutiger zuzuordnen sind die Takte 71f. (Abb. 5, 1b bzw. 2b), deren Vorhaltsbildung auf T. 11 (Abb. 2, 1b bzw. 2b) verweist. Die Arpeggien erfüllen weniger eine thematische Funktion, sondern dienen vielmehr als Folie, vor der die motivisch-thematische Arbeit stattfindet. Auf dem Höhepunkt der Durchführung (T. 73) erscheinen kurz nach der Hälfte des ersten Satzes die Akkordbrechungen nochmals an sehr exponierter Stelle. Dort findet die steigende, größtenteils chromatische Basslinie, die zusammen mit der figurativ immer wieder veränderten rechten Hand den Wechsel des Basstons der Takte 60‒72 sukzessive beschleunigt (Abb. 6), ihren Zielpunkt im dis. Gleichzeitig setzt in T. 73 mit dem oktavierten Gis eine steigende Basslinie ein, die zunächst zum cis in T. 81 führt und in T. 82 bei fis ansetzt. Sie führt wiederum chromatisch steigend in die Wiederaufnahme der Periode in der rechten Hand und damit in die Reprise, während in der linken Hand die Basslinie noch fortgeführt wird. Quasi im Schnelldurchgang sind in den Takten 73 bis 83 wesentliche Bestandteile des ersten Satzes rekapituliert: Die Arpeggien (T. 73‒76), die Phrase der Periode (T. 77‒80, vgl. Abb. 2, 1a, T. 9) sowie ein Ausschnitt der Gegenphrase der Periode (T. 81f., vgl. Abb. 2, 1b, T. 50).
Abb. 6: Schema der Durchführung des ersten Satzes
(Bässe jeweils mit unterer Oktav,
ohne Rücksicht auf den realen Oberstimmenverlauf)
Die Durchführung setze ich von T. 52 bis T. 84 an, wobei die Ränder jeweils mit Exposition und Reprise überlappen. Die Takte 52 bis 59 dienen, wie schon am Beginn, als Eröffnungssignal, jedoch nun als Vorbereitung der Durchführung. Der Grund dieser Annahme liegt in der Vermeidung kadenzieller Einschnitte und stabiler, grundstelliger Akkorde, die selbst im Eintritt der Reprise mittels eines Sextakkords in T. 85 umgangen werden.
Um eine vergleichende Perspektive zu eröffnen, kann der dritte Satz der Fantasie als Bezugspunkt dienen.[61] Der dritte Satz ist dabei, wie oben dargestellt, weit eindeutiger als Sonatensatzform einzuordnen als der erste Satz; er veranschaulicht, wie Mendelssohn verschiedene Elemente innerhalb der Sonatensatzform behandelt. Wie die Aufstellung der Motive zeigt, weisen sowohl die Periode des ersten Satzes in T. 9f. als auch der Beginn des dritten Satzes eine Dreiklangsmotivik auf.[62] Während im Kopfsatz das Erste Thema als sechzehntaktige Periode verläuft, ist für den Beginn des Schlusssatzes eine Einordnung in die Kategorien Satz bzw. Periode nicht möglich: Die Takte 232 mit Auftakt bis 239 könnten als Vordersatz gedeutet werden, jedoch würden Fortspinnung und Kadenz in T. 247 zunächst trugschlüssig enden, um dann mit neuer Motivik in der rechten Hand (Abb. 4, 1b, T. 248), die von einer abgewandelten Variante des Beginns des dritten Satzes in der linken Hand kontrapunktiert ist, fortgesetzt zu werden. Eine syntaktische Interpretation als Satz wäre damit wenig einleuchtend. In T. 254 mit Auftakt wird der Satzanfang wieder aufgenommen und führt auf einen Ganzschluss in der Ausgangstonart (fis-Moll). Letzteres geschieht im Kopfsatz in T. 24.
Abb. 7: Schematische Darstellung der Harmonik der Überleitungen
im ersten Satz (a) und im dritten Satz (b)
Kreuznotenköpfe = nicht real erklingend.
Umringte Kreuznotenköpfe = nur sehr kurz real erklingend.
Große Notenköpfe = Besonders hier werden Übereinstimmungen deutlich.
Der reale Oberstimmenverlauf wurde nicht berücksichtigt.
Beiden Sätzen gemeinsam ist in der Fortsetzung[63] das durchgehend pulsierende cis, das im weiteren Verlauf dieses Überleitungsabschnitts, der schematisch in Abb. 7 dargestellt ist, zu fis (erster Satz: T. 28; dritter Satz: T. 263) wechselt. Die Takte 258 mit Auftakt bis 261 verbleiben zunächst in fis-Moll, erst die Wiederholung dieser Takte weist nach zwei Takten eine Abweichung (ab T. 263/6) auf, die gleichsam als Ausgangspunkt für den anschließenden Weg in die parallele Durtonart gesehen werden kann. Die Modulation wird dabei über beinahe dieselben Harmonien vollzogen wie in T. 31–34; selbst die Basslinie lässt Ähnlichkeiten erkennen.
Für den dritten Satz lässt sich ein Zweites Thema ab T. 270 feststellen. Dort ist die parallele Durtonart A-Dur jedoch nicht grundstellig und stabil erreicht, sondern die Dominante E-Dur als vergleichsweise labiler Sextakkord.[64] Ein a im Bass wird erst in T. 272 nachgereicht. Dadurch ist A-Dur ebenso nur angedeutet wie im ersten Satz (T. 35/3), wo das a im Bass stufenweise und nicht durch einen Quintfall angesteuert sowie der Fokus durch Figuration und Dehnung über eineinhalb Takte auf den E-Dur-Septakkord in erster Umkehrung von T. 34f. gelegt wird. Das kurze, insgesamt zweitaktige Motiv im dritten Satz (Abb. 4, 1c bzw. 2c) erscheint in den folgenden Takten aufwärts sequenziert und setzt sich, relativ frei gestaltet sowie nach cis-Moll modulierend, fort. Diese Modulation findet sich im ersten Satz an entsprechender Stelle nicht,[65] die Sequenzierung aber sehr wohl, wenn auch in anderer Gestalt zunächst abwärts und anschließend aufwärts (Abb. 2, 1c und 2c). Zudem sei auf die Ähnlichkeit der Motive mit Terz-Sekund-Strukturen und dem oberen Vorhalt hingewiesen. Damit liegt die Interpretation der Takte 35/3 bis 43 als Bereich des Zweiten Themas sehr nahe.
Diese Annahme wird außerdem durch die Interpretation der Takte 43 bis 51 bzw. 290 bis 304 als Schlussgruppen bestätigt, die durch den relativen harmonischen Stillstand und die Konzentration auf die Bestätigung der Tonart geprägt sind. Im ersten Satz pendelt die Harmonik zwischen A- und E-Dur; auf das Motiv (Abb. 2, 1b bzw. 2b, T. 43) folgt eine variierte Wiederholung mit Kadenz (T. 41–47).[66] Dieses Schema tritt direkt anschließend nochmals auf, wird jedoch nach der variierten Motivwiederholung durch eine Abspaltung (T. 49ff.) ersetzt, die in die Durchführung leitet. Im dritten Satz ist die Schlussgruppe trugschlüssig eingeführt, indem in T. 290 die Tonart A-Dur statt cis-Moll erscheint. Über dem Orgelpunkt a wird durch das Pendel einer E7– und einer A-Dur-Harmonie an diesem Trugschluss festgehalten und nach zweimaligem Anlauf beim dritten Mal eine Kadenzierung eingeleitet, der wiederum trugschlüssig im vorhergehenden Pendel mündet. Bei dieser Wiederholung setzt sich der Kadenzablauf jedoch weiter wiederholend bzw. variativ fort und endet in einer Oktavpassage mit dem Zielton cis.
Die Reprise des ersten Satzes ist im Vergleich zur Exposition verkürzt und leicht abgeändert: Die Gegenphrase in T. 93/2ff. erscheint sequenziert und mündet in T. 100 in die Oberstimmengestaltung von T. 41ff., allerdings nach Fis-Dur anstelle von A-Dur transponiert. Diese Fis-Dur-Kadenz in T. 102 ist die erste schlusskräftige Kadenz seit T. 47. Ihr folgt in Fis-Dur die zur Exposition (T. 43–48) parallele Stelle, um in T. 108, bis zu dem der Grundton fis vorenthalten bleibt, den in T. 92ff. suspendierten Nachsatz beinahe wörtlich von T. 17 bis T. 24 zu übernehmen. Dies bereitet gleichsam den Bogen vor, der den ersten Satz umspannt. Werden die hier abgewandelt wieder aufgenommenen Arpeggien des Con moto agitato – wie bei Ullrich Scheideler angedeutet – als ein eigenständiges Thema interpretiert, so wären in der Reprise die Themen vertauscht (erst B‘, dann A“).[67] Das ist zwar kein ganz ungewöhnliches Vorgehen, doch ist auch denkbar, dass die Wiederholung des Bereichs des Zweiten Themas aufgrund seiner relativen Undefiniertheit in der Reprise vermieden wird. So bliebe die Interpretation der Arpeggien als Rahmen unangetastet.
Die Analyse der Expositionen des ersten und des dritten Satzes hat gezeigt, dass dort großflächig Parallelen feststellbar sind, die eine Interpretation des Kopfsatzes als Sonatensatzform mit dem Bereich eines Zweiten Themas zulassen. Außerdem bestätigt sich die Vermutung, dass die Arpeggien des Anfangs und Schlusses im ersten Satz innerhalb der sie umschließenden Form einen neuen Abschnitt ankündigen bzw. damit gleichzeitig den vorhergehenden abschließen. Die charakteristischen Zweiunddreißigstel erscheinen als Eröffnung des Satzes – und damit noch vor dem Ersten Thema –, danach vor dem Bereich des Zweiten Themas, vor der Durchführung sowie auf dem Höhepunkt des Satzes, der über die diminuierte Rekapitulation des Ersten Themas und die Motivabspaltung aus der Schlussgruppe in die Reprise führt. Schließlich läuft der Satz in den Arpeggien – nun in Fis-Dur – aus, nicht ohne zuletzt vier Takte der Periode (T. 130–133) erklingen zu lassen.
Weitere Besonderheiten
Über die Verschleierung der Sonatensatzform hinaus führen auch weitere Aspekte – darunter beispielsweise die Taktgruppengestaltung – zu einer Anlage, die regelmäßige Strukturen verunklart. Die Besonderheiten des ersten Satzes mit seinen Verschränkungen von Exposition, Durchführung und Reprise wurde ausführlich dargestellt, weshalb an dieser Stelle noch kurz der Mittelsatz sowie der ebenso relativ ausführlich behandelte Schlusssatz betrachtet werden.
Insgesamt stellt der zweite Satz eine A–B–A‘-Form dar, wobei sich die A-Teile nochmals in eine für Menuette typische a–b–a‘-Form unterteilen lassen.[68] Im Gegensatz zu den A-Teilen ist der B-Teil sehr regelmäßig gestaltet, weshalb nicht weiter auf ihn eingegangen wird. Die Takte 135/2 (Alla breve) bis 142 (a-Teil) wurden bereits untersucht (siehe Abb. 3, 1a bzw. 1b). Das auf die Dominanttonart modulierende, siebentaktige und satzartige Gebilde weist auch bei seiner Wiederkehr ab T. 145/2 Eigenheiten auf, welche die nun reguläre Achttaktigkeit weiterhin unterwandern. Ein regulärer Satz wird im a‘-Teil durch die Abspaltung des Motivkopfs in der Phrasenwiederholung verhindert (ab T. 148/2), allerdings bleibt die Gliederung von 2 + 2 + 4 Takten erhalten. Besonders erwähnenswert sind die Takte 145f., da hier die vorhergehenden Takte des kontrapunktischen b-Teils mit dem a‘-Teil überlappen (Abb. 8). Diese Technik findet allerdings im A‘-Teil an entsprechender Stelle (T. 211f.) keine Anwendung. Stattdessen wird dort ab T. 219/2 das Tetrachord a‘ – gis‘ – fis‘ – e‘ separiert, transponiert und nach der Kadenz in T. 227 nochmals durch Viertelnoten, die durch regelmäßige Pausen unterbrochen sind, variiert. Während Mendelssohn im B-Teil des zweiten Satzes also vorrangig mittels Kontrapunkt und Motiventwicklung bzw. Fortspinnung Abwechslung erreicht, tritt in den A-Teilen ein stetiges Spiel mit der Syntax bzw. mit Taktgruppen hinzu.
Abb. 8: b-Teil des zweiten Satzes mit Überlappen des a‘-Teils.
Die Kleinbuchstaben a und b bzw. x und y beziehen sich nur auf die Motivik.
An der Symmetrieachse zeigt sich die beinahe punktsymmetrische Spiegelung.
Der dritte Satz bereitet zwar keine Schwierigkeiten, die sonatensatztypischen Formteile zu lokalisieren, doch treten hier andere Besonderheiten auf. Neben dem ungewöhnlichen, trugschlüssigen Eintritt der Schlussgruppe (T. 290) ist der Anfang der Reprise (T. 362) wie im ersten Satz (T. 84 bzw. 85) eigentümlich verschleiert und wird in beiden Fällen durch eine ansteigende Basslinie[69] vorbereitet. Über dem pulsierenden cis als Orgelpunkt im Bass beginnt die Reprise im Schlusssatz als Quartsextakkord von fis-Moll, der in T. 369 nur unzureichend aufgelöst wird: Dort erscheint zwar ein fis im Bass, aber die Töne e und g bewirken Spannungen, die sich im Nachhinein als Vorhalte zum Fis7-Akkord in T. 370 herausstellen. Auch hier erfolgt in T. 371 nur eine instabile Auflösung in den Sextakkord von h-Moll. Eine schlusskräftige Kadenz steht erst in T. 411.[70]
Fazit
Sonaten oder Phantasien (was liegt am Namen!)[71]
Robert Schumanns Diktum lässt sich auf Felix Mendelssohn Bartholdys Fantasie op. 28 übertragen. Formal steht der Kopfsatz der Fantasie einer Sonatensatzform nahe, die jedoch zugleich von Elementen eines Liedes ohne Worte durchdrungen ist. Besonders der erste Satz trägt Züge, die auch dem Genre der Fantasie zugeordnet werden können. Dabei sind vor allem die Arpeggien wesentlich, wie sie auch in Mendelssohns opp. 19,4, 30,3 und 38,4 einen »Chorsatz ohne Worte«[72] einrahmen. Ihr improvisatorischer Charakter, der am Beginn metrisch kaum greifbar ist, trägt damit der Beschreibung der »Freyen Phantasie« nach Carl Philipp Emanuel Bach Rechnung, der für dieses Genre die fehlende Takteinteilung postulierte. Darüber hinaus erfüllen die Arpeggien eine formale Funktion, da sie den Anfang eines neuen Formteils bzw. das Ende des vorhergehenden signalisieren, jedoch kommt gerade durch sie gleichzeitig der von Ferdinand Gotthelf Hand für die Fantasie geforderte ›Anschein der Zufälligkeit‹ zustande.
Auch in den anderen Sätzen lassen sich ähnlich wie im Kopfsatz mit seinem relativ undefinierten Bereich des Zweiten Themas sowie dem ›Ineinanderschieben‹ von Durchführung und Reprise Verkürzungen und Überlappungen feststellen, die den Eindruck einer formalen Unschärfe fördern. Hinzu tritt oftmals eine durch Sequenzen hervorgerufene harmonische Instabilität und Unbestimmtheit. Dennoch schafft Mendelssohn durch ein satzübergreifendes Netz von motivischen Bezügen Zusammenhalt.
All diese Parameter und auch die Kürze des Werks[73] mögen Mendelssohn bewogen haben, die Umbenennung des Opus 28 von »Sonate« zu »Fantasie« vorzunehmen. Was sich formal in den gezeigten Verschleierungstechniken von Ineinanderschieben und Verwischen klarer Grenzen andeutet, vollzieht sich letztlich auch auf der Ebene der Gattung, wenn Mendelssohn in seiner Komposition Elemente von Sonate, Fantasie und Lied ohne Worte verbindet.
Anmerkungen
[1] Die hohen Opuszahlen resultieren aus der posthumen Herausgabe der Werke durch Julius Rietz; vgl. Dietrich Kämper, Die Klaviersonate nach Beethoven. Von Schubert bis Skrjabin, Darmstadt 1987, S. 65f. sowie S. 69.
[2] Vgl. ebd., S. 70f.
[3] Auch in Mendelssohns ›Schottischer Sinfonie‹ op. 56 sollen die Sätze ohne größere Unterbrechung gespielt werden.
[4] Vgl. Ullrich Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise) fis-Moll für Klavier op. 28, in: Mendelssohn-Interpretationen, Laaber, im Druck.
[5] Felix Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, in: Klavierwerke, Bd. 1, hrsg. von Rudolf Elvers, Ernst Herttrich und Ullrich Scheideler, München 2009, S. 163–185.
[6] Arnfried Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 3: Von 1830 bis zur Gegenwart, Laaber 2004 (Handbuch der musikalischen Gattungen 7,3), S. 54.
[7] Dagmar Teepe, 18. Jahrhundert / 19. und 20. Jahrhundert, in: Fantasie (Sp. 316–345), in: MGG2S, Bd. 3, Sp. 339.
[8] Kämper, Klaviersonate, S. 70f.
[9] Gudrun Fydrich, Fantasien für Klavier nach 1800, Diss. Frankfurt am Main 1990.
[10] Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise), im Druck.
[11] Vgl. Arnfried Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2: Von 1750 bis 1830, Laaber 2003 (Handbuch der musikalischen Gattungen 7,2), S. 70.
[12] Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, hrsg. von Wolfgang Horn, Kassel u. a. ²2003, Teil II, S. 325.
[13] Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2, S. 80.
[14] Zum Zusammenhang von Fantasie und Capriccio vgl. Daniel Gottlob Türk, Klavierschule, Leipzig u. a. 1789, S. 396: »Das Kapriccio […] ist ebenfalls eine Art Fantasie ohne festgesetzten Plan u. dgl.« Damit dürfte die Freie Fantasie gemeint sein, denn Türk stellt fest: »Gebunden heißen diejenigen Fantasien, in welchen eine Taktart zum Grunde liegt, wobey man sich mehr an die Gesetze der Modulation bindet, worin mehr Einheit beobachtet wird u.s.w.« (ebd.).
[15] Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2, S. 80.
[16] Die Beschleunigung des Tempos vom ersten zum dritten Satz in Beethovens op. 27,2 lässt sich in Mendelssohns op. 28 wiederfinden. Dass Beethovens Sonate aber als Vorbild für Mendelssohns Fantasie gedient hätte, wäre nicht nachzuweisen; vgl. Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise).
[17] Zu Schubert vgl. auch Fydrich, Fantasien für Klavier, S. 174 und vor allem S. 268.
[18] Ferdinand Gotthelf Hand, Aesthetik der Tonkunst, 2 Bde., Leipzig 1837 (Bd. 1) und Jena 1841 (Bd. 2).
[19] Hand, Aesthetik, Bd. 2, S. 377f.
[20] Johann Friedrich Anton Fleischmann, Wie muss ein Tonstück beschaffen seyn, um gut genannt werden zu können?, in: AmZ 1 (1798/99), Nr. 14, Sp. 209–213, und Nr. 15, Sp. 225–228.
[21] Vgl. Alfred Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform« im musiktheoretischen Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1968 (Neue musikgeschichtliche Forschungen 1), S. 218. Die üblichen Bezeichnungen »Exposition«, »Durchführung« und »Reprise« für die drei Teile des Kopfsatzes einer Sonate hat im deutschsprachigen Gebiet Alfred Richter (Lehre von der musikalischen Form, Leipzig 1904) zusammengeführt und Hugo Leichtentritt (Musikalische Formenlehre, ebd. 1911) im heutigen Sinne geprägt. Vgl. Markus Bandur, Sonatenform, in: MGG2S, Bd. 8, Sp. 1609.
[22] Vgl. Heinrich Birnbach, Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke aller Art und deren Bearbeitung, in: BAmZ 4 (1827), Nr. 34, S. 269–272, hier S. 270–272, sowie S. 277–281, hier S. 277f. Vgl. Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform«, S. 213–221. Der Einfluss von Birnbachs Ideen auf Adolf Bernhard Marx’ Lehre von der musikalischen Komposition (1838) war enorm, wenn auch Birnbach für das Erste und Zweite Thema noch forderte, dass sie »in karakteristischer Hinsicht übereinstimmen«: Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke, S. 277; vgl. auch Ritzel, Die Entwicklung der »Sonatenform«, S. 223.
[23] Ebd., S. 379f.; siehe auch Heinrich Birnbach, Ueber die Form des ersten Tonstücks einer Sonate, Symphonie, eines Quartetts, Quintetts u. s. w. in der weichen Tonart, in: BAmZ 5 (1828), Nr. 14, S. 105.
[24] Hand, Aesthetik, Bd. 2, S. 298.
[25] Vgl. ebd., S. 300.
[26] Vgl. ebd., S. 299.
[27] Vgl. Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 3, S. 34f.
[28] Robert Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Bd. 3, Leipzig 1854, S. 80. Schumann selbst überlegte zeitweise, seine Fantasie op. 17 »Sonate für Beethoven« zu nennen. Vgl. Nicholas Marston, Schumann: Fantasie, Op. 17, Cambridge 1992 (Cambridge Music Handbooks), S. 23.
[29] Ebd., S. 79. Schumanns Artikel Sonaten für das Clavier, aus dem auch voriges Zitat stammt, erschien am 26. April 1839 in der NZfM 10 (1839), Nr. 34, S. 134f.
[30] Schumann, Gesammelte Schriften, Bd. 4, S. 19.
[31] Zur Problematik, das Lyrische Klavierstück bzw. das Lied ohne Worte als eigene Gattung zu bezeichnen, siehe Edler, Gattungen der Musik: Teil 3, S. 161.
[32] Vgl. Edler, Gattungen der Musik: Teil 2, S. 257.
[33] Brief vom 15. Juni 1832, zitiert nach: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe, Bd. 2 (Juli 1830‒Juli 1832), hrsg. von Anja Morgenstern und Uta Wald, Kassel u. a. 2009, S. 559.
[34] Vgl. Christa Jost, Mendelssohns Lieder ohne Worte, Tutzing 1988 (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft 14), S. 11 und S. 20.
[35] Ebd., S. 72.
[36] Ebd., S. 81.
[37] Ebd., S. 74.
[38] Zum Beispiel in einem Brief an Abraham Mendelssohn Bartholdy vom 25./26. Mai 1830: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe, Bd. 1 (1816‒Juni 1830), hrsg. von Juliette Appold und Regina Back, Kassel u. a. 2008, S. 532.
[39] Vgl. Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise). Scheideler weist darauf hin, dass die Überschrift »Sonate écossaise« eventuell nachträglich hinzugefügt wurde. Vgl. außerdem: Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, Kritischer Bericht von Ullrich Scheideler, S. 244.
[40] Vgl. Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, Vorwort von Ullrich Scheideler, S. IX.
[41] Kämper, Die Klaviersonate nach Beethoven, S. 64.
[42] Vgl. Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, Kritischer Bericht von Ullrich Scheideler, S. 244, sowie Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise).
[43] Brief vom 28./29. Dezember 1833: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe, Bd. 3 (August 1832‒Juli 1834), hrsg. von Uta Wald, Kassel u. a. 2010, S. 317.
[44] Mendelssohn Bartholdy, Phantasie op. 28, Vorwort von Ullrich Scheideler, S. IX.
[45] Mendelssohn Bartholdy, Briefe, Bd. 3, S. 311.
[46] »Die Musik will gar nicht rutschen ohne Dich«. Briefwechsel 1821 bis 1846 zwischen Fanny und Felix Mendelssohn, hrsg. von Eva Weissweiler, Berlin 1997, S. 164.
[47] Vgl. Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise): »Die Form […] lässt zumindest im Großen eine Nähe zur Sonate erkennen, ist das Werk doch in drei Sätze untergliedert, die zwar attacca aneinander anschließen, aber weder durch Überleitungen noch durch gemeinsame Themen oder Motive miteinander verbunden sind.«
[48] Dagmar Teepe, im Artikel Fantasie in MGG2S, Sp. 339.
[49] Kämper, Die Klaviersonate nach Beethoven, S. 71.
[50] Arnfried Edler, Gattungen der Musik: Teil 3, S. 54.
[51] Innerhalb der harmonischen Quintfallsequenz ist nur jede zweite Station grundstellig.
[52] Damit ist die Umkehrung des üblicherweise fallenden Parallelismus gemeint. In A-Dur ergäbe das fallende Modell die Harmoniefolge: A – E – fis – cis. In T. 37–39 verkehrt sich dies zu cis – fis – E – A. Der »steigende Parallelismus« bietet zudem eine einfache und gängige Möglichkeit, von einer Molltonart in die parallele Durtonart zu modulieren. Entsprechend wäre sie bereits in T. 32f. zu erwarten gewesen, wo er aber zugunsten eines ansteigen Fauxbourdon in der linken und einer entgegenlaufenden Linie mit Vorhalten in der rechten Hand nicht erscheint.
[53] Zur Form des zweiten Satzes siehe Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise).
[54] In Abb. 4, 2b ist dies mittels Kreuznotenköpfen dargestellt.
[55] Vgl. Birnbach, Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke, S. 270ff. und S. 277f.
[56] Ullrich Scheideler (Fantasie (Sonate écossaise)) gliedert den dritten Satz in Exposition: T. 232‒304; Durchführung: T. 304‒363; Reprise: T. 363‒430; Koda: T. 431‒468.
[57] Zu dieser formalen Interpretation vgl. ebd.
[58] Vgl. ebd.
[59] In Bezug auf Schumann und die Verbindung von Einzelsätzen schreibt Gudrun Fydrich: »Da Schumann sich die Gestaltung größerer Formen über das kurze Klavier- und Charakterstück erarbeitet, finden wir während seiner Klavierdekade nur in den Intermezzi op. 4 ›Attacca‹-Vorschriften«: Fantasien für Klavier, S. 176f. Es ist möglich, dass beim Auffinden individueller Formlösungen kleiner dimensionierte Formate auch bei Mendelssohn für größer angelegte Formen Vorbild waren.
[60] Eine Dreiklangsbrechung eröffnet auch Mendelssohns Fantasie über das irländische Lied »The Last Rose of Summer« op. 15. Zudem findet sich dort ebenfalls das Thema in akkordischer Begleitung und in der rechten Hand z. B. in T. 29ff. eine Motivik, die der von Abb. 2, 1b, T. 11 nahe steht.
[61] In den Durchführungen sind Ähnlichkeiten weit weniger ausgeprägt, wenn auch beispielsweise dem Bereich um Gis-Dur und damit der Doppeldominante in beiden Sätzen breiter Raum eingeräumt wird (erster Satz: T. 73‒76; dritter Satz: T. 339‒345). Zudem führt die Dominante Cis-Dur zurück in die Ausgangstonart fis-Moll. Auch dies ist einerseits eine Gemeinsamkeit zwischen den Durchführungen des ersten und dritten Satzes, andererseits entspricht dies der Harmoniefolge, wie sie in den Takten 1 bis 9 (vgl. Abb. 1b) erscheint.
[62] Gleichfalls besteht die »rauschende« Einleitung von Abb. 1, wie erwähnt, aus Akkordbrechungen. Auch sie könnte mit den Sechzehnteln, die allerdings den gesamten dritten Satz prägen, in Verbindung gebracht werden.
[63] Auf eine Ähnlichkeit des motivischen Materials sei nochmals verwiesen: Vgl. Abb. 2, 2b, T. 25 und Abb. 4, 2b.
[64] Dies entspricht einem Halbschluss in der Nebentonart; vgl. auch Birnbach, Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke, S. 271.
[65] Cis-Dur wird in T. 37 lediglich peripher berührt.
[66] Birnbach fordert für den »Koda«-Teil (bei mir: »Schlussgruppe«), »das Gehör in Ruhe zu bringen« und Modulationen zu vermeiden: Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke, S. 278. Mendelssohn setzt dies durch die Pendelharmonik um.
[67] Vgl. Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise), im Druck.
[68] Joseph Riepel schreibt, »ein Menuet« sei »der Ausführung nach, nichts anders […] als ein Concert, eine Arie oder Simpfonie«: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst, Regensburg und Wien 1752, S. 1. Formal entsprechen die A-Teile des zweiten Satzes mit ihrer Gliederung a–b–a‘ einem Menuett. Ist nun a die Exposition, b die Durchführung und a‘ die Reprise, so entsteht, wie Abb. 8 zeigt, eine Verknüpfung von b und a‘, also von Durchführung und Reprise. Genau dies findet sich an entsprechenden Stellen im ersten und dritten Satz.
[69] Im ersten Satz ab T. 83, im dritten Satz ab T. 357.
[70] An dieser Stelle ist in der Exposition des dritten Satzes der trugschlüssige Einsatz der Schlussgruppe zu finden.
[71] Schumann, Gesammelte Schriften, Bd. 3, S. 80.
[72] Christa Jost gebraucht für die genannten Stücke den Begriff »Chorlied ohne Worte«: Mendelssohns Lieder ohne Worte, S. 81.
[73] Scheideler, Fantasie (Sonate écossaise), im Druck.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Edition
Mendelssohn Bartholdy, Felix: Phantasie op. 28, in: Klavierwerke, Bd. 1, hrsg. von Rudolf Elvers, Ernst Herttrich und Ullrich Scheideler, München 2009, S. 163–185.
Quellen
Bach, Carl Philipp Emanuel: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Faksimile-Reprint der Ausgaben Teil I, Berlin 1753 und Teil II, Berlin 1762, hrsg. von Wolfgang Horn, Kassel u. a. ²2003.
Birnbach, Heinrich: Über die verschiedene Form größerer Instrumentaltonstücke aller Art und deren Bearbeitung, in: Berliner allgemeine musikalische Zeitung 4 (1827), Nr. 34, S. 269–272, und Nr. 35, S. 277–281.
Ders.: Ueber die Form des ersten Tonstücks einer Sonate, Symphonie, eines Quartetts, Quintetts u. s. w. in der weichen Tonart, in: dass. 5 (1828), Nr. 14, S. 105–108.
Fleischmann, Johann Friedrich Anton: Wie muss ein Tonstück beschaffen seyn, um gut genannt werden zu können?, in: AmZ 1 (1798/99), Nr. 14, Sp. 209–213, und Nr. 15, Sp. 225–228.
Hand, Ferdinand Gotthelf: Aesthetik der Tonkunst, 2 Bde., Leipzig 1837 (Bd. 1) und Jena 1841 (Bd. 2).
Mendelssohn Bartholdy, Felix: Sämtliche Briefe, Bd. 1 (1816‒Juni 1830), hrsg. von Juliette Appold und Regina Back, Kassel u. a. 2008.
Ders., Sämtliche Briefe, Bd. 2 (Juli 1830‒Juli 1832), hrsg. von Anja Morgenstern und Uta Wald, ebd. 2009.
Ders.: Sämtliche Briefe, Bd. 3 (August 1832‒Juli 1834), hrsg. von Uta Wald, ebd. 2010.
Ders.: »Die Musik will gar nicht rutschen ohne Dich«. Briefwechsel 1821 bis 1846 zwischen Fanny und Felix Mendelssohn, hrsg. von Eva Weissweiler, Berlin 1997.
Riepel, Joseph: Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst, Bd. 1, Regensburg und Wien 1752.
Schumann, Robert: Sonaten für das Clavier, in: NZfM Bd. 10 (1839), Nr. 34, S. 134f.
Ders.: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, 4 Bde., Leipzig 1854.
Türk, Daniel Gottlob: Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende, Leipzig u. a. 1789.
Literatur
Bandur, Markus: Sonatenform, in: MGG2S, Bd. 8, Sp. 1607–1615.
Edler, Arnfried: Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2: Von 1750 bis 1830, Laaber 2003 (Handbuch der musikalischen Gattungen 7,2).
Ders.: Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 3: Von 1830 bis zur Gegenwart, Laaber 2004 (dass. 7,3).
Fydrich, Gudrun: Fantasien für Klavier nach 1800, Diss. Frankfurt am Main 1990.
Jost, Christa: Mendelssohns Lieder ohne Worte, Tutzing 1988 (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft 14).
Kämper, Dietrich: Die Klaviersonate nach Beethoven. Von Schubert bis Skrjabin, Darmstadt 1987.
Marston, Nicholas: Schumann: Fantasie, Op. 17, Cambridge 1992 (Cambridge Music Handbooks).
Ritzel, Alfred: Die Entwicklung der »Sonatenform« im musiktheoretischen Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1968 (Neue musikgeschichtliche Forschungen 1).
Scheideler, Ullrich: Fantasie (Sonate écossaise) fis-Moll für Klavier op. 28, in: Mendelssohn-Interpretationen, Laaber, im Druck.
Teepe, Dagmar: 18. Jahrhundert und 19. und 20. Jahrhundert, im Artikel Fantasie (Sp. 316–345), in: MGG2S, Bd. 3, hier Sp. 336–341.