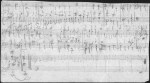Startseite » 2013
Archiv für das Jahr 2013
August Bungert: Vorwort zu „Nausikaa“ (1885)
Im Jahre 1885 veröffentlichte August Bungert im Verlag von Friedrich Luckhardt die Erstfassung eines Librettos seiner Tetralogie „Homerische Welt“. Er wählte „Nausikaa“ als Ausgangspunkt, von dem aus sich das Konzept allerdings in den nächsten Jahren wesentlich verschieben sollte. Als die Tetralogie von 1896 bis 1903 in Dresden, Berlin und Hamburg über die Bühnen ging, handelte der erste Teil von Kirke, der zweite von Nausikaa, der dritte von Odysseus’ Heimkehr und der vierte von Odysseus’ Tod, den Homer gar nicht schilderte. Auch in der Ideenwelt hatte sich seit 1885 viel verändert; aus der Betonung des Lebens als Leiden und der Kunst als Tröstung wurde nach Bungerts Bekanntschaft mit Friedrich Nietzsche eine immer stärkere Akzentuierung des aktiven, handelnden Menschen und der selbstständigen Gestaltung des eigenen Geschicks.
Zur Einführung
Es giebt ein Wort, das so alt ist wie die Welt. Alle dahingegangenen Völker kannten und alle bestehenden Völker kennen dieses Wort. In ihren Religionen ist es niedergelegt oder es haben uns das Wort ihre Dichter und ihre Philosophen in ihren Werken ausgesprochen. In den verschiedensten Weisen ward es und wird es gesungen. Im einfachen Volksliede wie im höchsten Kunstgedicht klingt uns das Wort entgegen. Am Abend eines stillen, eingeschränkten Lebens ertönt das herbe Wort und am Ende des prometheischen Ringens eines jeglichen Helden, eines jeglichen Uebermenschen vernehmen wir es. – Dieses alte orphische Urwort heißt: „Entsagen!“ Das Wort „Entsagen“ ist der Grundgedanke unseres Daseins – es ist das Ende vom Lebensliede. Das Höchste, was der Mensch erreichen kann, ist als Heros, entsagend, au diesem Leben zu scheiden! Kein Erdenwanderer bringt es weiter, als, nach übermenschlichem Ringen und Kämpfen, ausgesöhnt mit dem mühevollen, kurzen Dasein, mit Lächeln ohne Bitterkeit auf den Lippen, verscheidend, stammeln zu können: „Ich entsage!“ Dieses Wort, das mit jedem Schritt, den wir weiter thun auf dieser Lebensbahn, uns lauter und vernehmlicher tönt, macht uns reifer, stiller und mahnt uns zu bedenken, daß Leben Sterben ist.
Wo aber ist der Lethebecher, aus dem die müde Seele Vergessen trinken kann und uns alle Qual des Daseins entfernen? – Die Kunst ist der Becher. Aus diesem Becher trinken wir jegliches Lebens-Leid fort.
Das echte Kunstwerk bietet uns das Menschenleben, oder Episoden desselben, von jenem geklärten, hohen Standpunkte aus gesehen, wo nur die bedeutungsvollen Fäden, welche die Handlung, d. h. den symbolischen Grundgedanken des Kunstwerkes bilden, licht und klar uns entgegenleuchten. Aus diesen Fäden, einem Liniensystem gleich, bauen sich die ethischen Akkorde auf, die, mögen sie nun herb oder milde klingen, doch Musik sind, und unsere Seele klärend berühren. Unsere Seele wird mit dem Dichter hellsehend – hellhörend – entrückt im Lande der Kunst. Wie vergessen in solcher Anschauung, unter dem Banne des Kunstwerkes stehend, das eigene Leid, weil wir auch dieses nun von jenem geklärten, hohen, einzig wahren Standpunkte des Weltgeistes aus ansehen und empfinden!
Das schöne erquickende der Kunst ist eben der klingende göttliche Akkord, den der Dichter, sein Kunstwerk schaffend, gehört hat, nun uns in diesem enthüllt! –
Der Grundgedanke des vorliegenden Werkes ist: die Entsagung. Es ist also dasselbe alte Lied, das in dem größten Werk unseres größten Dichters, im Faust ertönt: „Entbehren sollst du, sollst entbehren!“
Das Ideal des griechischen Helden ist neben Achilleus vor allen Odysseus. Sein Leben heißt: Kämpfen – genießen – leiden! Er ist der unermüdliche Kämpfer – der nie ermüdende Genießende – der erhabene Dulder! Kurz vor dem Ende seiner Laufbahn tritt ihm im Phäakenlande, Nausikaa die Mädchenblume entgegen. Neuer Kampf – neues Leid! Aber zugleich, und dieses habe ich in meiner Dichtung besonders betont, ist ihm das Phäakenland auch das Land der Kunst; hier hört er seine eigenen Thaten bereits durch den Mund des Sängers verherrlicht. – Die ganze Art, wie auch Homer, am Schluß seiner Irrfahrten Odysseus noch nach Phäakenland gelangen läßt, die Schilderung des Volkes, dessen Freude und Lust am Dasein, seine Pflege und Verehrung des Schönen; dann die Art und Weise, wie Odysseus Nachts von diesem Traumlande schlafend fortgefahren wird, um Morgens endlich in seiner Heimat Ithaka zu landen – all dieses hat bei Homer einen eigenen, bei ihm ganz einzig dastehenden, beinahe phantastischen Zug. Wie ein Lethebecher ist dem Helden, nach dieser Seite hin, der Aufenthalt im Phäakenland –, wie ein Becher der Erquickung vor dem letzten Kampf gegen die Freier in der Heimat! –
Und nun Nausikaa! In der Odyssee im 7. und 13. Gesange bringt Homer wenigstens äußerlich nicht das Tragische der Gestalt zum Austrag. Es war dies aus vielen Gründen im Epos nicht am Platze. Das Verhältnis zur Nausikaa mußte und konnte nur vorübergehend dargestellt werden; denn es handelt sich vor allem um die Heimkehr des Odysseus. Dem Epiker genügte hier das Tragische nur anzudeuten. Daß der Dramatiker durchaus anders den Stoff anfassen mußte, ist natürlich. Auf Nausikaa’s Gestalt ruht, nachdem sie den Helden gesehen, der ganze Zauber, der bei Tag und Sonne, voll und stolz aufblühenden Rose – und bei Odysseus Abschied – steht sie da, wie die arme Blume, auf die der Reif der Frühlingsnacht gefallen ist! – –
*
Bezüglich der Betonung Nāūsika und Nausikaá statt der bisher durchweg gebräuchlichen bin ich theilweise derselben Ansicht wie Jordan, der in seiner neuen Uebersetzung des Homer auch Folgendes sagt: „Aus irrthümlicher Analogie mit Nausīthoos hat man bisher den Namen Nausīkaa ausgesprochen. Da der Name mit dieser Aussprache unschön klingt und das griechische Nausikaá in unserm lediglich accentuierenden Hexameter unmöglich ist, bin ich für die Aussprache Nāūsika.“
In der freien Strophe der Musik-Tragödie in keiner Weise jenem Zwange unterworfen, hab’ ich beides, sowol Nausikaá wie Nāūsika gebraucht.
Daß es lange Zeit ein Lieblingsgedanke Goethes gewesen ist, seine Nausikaa zu schreiben, daß er in Palermo am Strande wandelnd eine Skizze entwarf, die allerdings nur sehr dürftig ist, ist aus seiner Italienischen Reise bekannt. Dieses war am 16. April 1787; also vor beinahe 100 Jahren. Die nach einem späteren Entwurf ausgeführten Nausikaa-Szenen sind aus seinen Werken bekannt.
Sophokles soll eine Nausikaa geschrieben haben. Es ist uns aber leider nichts übrig geblieben; von den Scholastikern wird nur der Titel mitgetheilt.
Noch will ich hinzufügen, daß diese Nausikaa der dritte Theil, d. h. der III. Abend meiner Tetralogie „Homerische Welt“ ist.
Der erste Abend betitelt sich: Achilleus und Helena, mit dem Vorspiel: das Opfer der Iphigenie in Aulis.
Der zweite Abend: Orestes und Klytemnestra.
Der dritte Abend: Nausikaa.
Der vierte Abend: Odysseus Heimkehr.
Da indeß ein jedes Drama für sich allein besteht, so gehe ich einstweilen nicht darauf ein, den Grundgedanken des ganzen Werkes, wie auch der einzelnen anderen Abende hier näher zu entwickeln. Das Erscheinen des ganzen Werkes wird in nicht ferner Zeit erfolgen.
Pegli bei Genua, 14. März 1885.
August Bungert.
[Transkription: Christoph Hust]
Cäcilien-Vereins-Katalog
Als Zwischenschritt zum Projekt der HMT einer Datenbank zu den Cäcilien-Vereins-Katalogen können wir Ihnen hier Scans der ersten Einträge dieses Katalogs präsentieren. Sie finden diese Scans auf der Homepage des Instituts für Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Theater Leipzig auch als OCR-erfasste PDF-Dokumente.
Joseph Joachim Raff als Kompositionslehrer
Im Jahre 1864 unterrichtete Joseph Joachim Raff, mittlerweile aus Weimar nach Wiesbaden übergesiedelt, seine Privatschülerin Marie Rehsener (später machte sie nicht als Musikerin Karriere, sondern als Scherenschnittkünstlerin). Der umfangreich dokumentierte Kurs führte von Generalbass- und Kontrapunktübungen bis zu einfachen Satzmodellen. Eingebettet sind zwei kleinere musiktheoretische Traktate von Raff. Sie finden hier die gesamte Quellen (teils in Mitschriften von Rehsener, teils in Manuskripten von Raff) in digitalen Versionen. In der nächsten Zeit sollen auch einige „Highlights“ transkribiert werden. – Die Originale sind in Privatbesitz; Anfragen zur Reproduktion bitte an christoph.hust@gmx.de.
August Bungert: Einführung zur „Faust“-Bühnenmusik (1903)
Nach den Aufführungen seiner Tetralogie „Homerische Welt“ wandte sich August Bungert sofort neuen Aufgaben zu. Vor dem Mysterium op. 60, einem Oratorium für Soli, Chor und Orchester, war Goethes „Faust“ sein erstes neues Projekt. Mit Bungerts Bühnenmusik wurde „Faust“ zur Tetralogie und zu einem postwagnerianischen „Bühnenweihespiel“, wie der Komponist es im umfangreichen Vorwort des Klavierauszugs darlegte.
Zur Einführung.
Im Auftrage des Rheinischen Goethe-Vereins, unter dem Protektorat Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen des deutschen Reiches und dem Vorsitze Sr. Excellenz des Ministers H. von Rheinbaben, frug im Februar dieses Jahres Max Grube, der Oberregisseur des Königl. Schauspielhauses zu Berlin, bei mir an, ob ich Zeit und Muße finden würde, bis zu Ende Mai eine neue Musik zu Goethe’s Faust zu komponieren.
Da ich eben mein Lebenswerk, die Musiktetralogie: Die Odyssee abgeschlossen hatte und längst der Plan in mir ruhte, an eine solche Arbeit heranzutreten, ohne daß indes eine Note dazu geschrieben war, so übernahm ich mit Freude und glühendster Begeisterung die Aufgabe.
In unbeschreiblicher Erregung wurde in etwa 7–8 Wochen die ganze Musik skizziert, Tag und Nacht daran geschrieben und bis zum festgesetzten Termin im Mai war die Instrumentation in der Hauptsache vollendet, die Klavierauszüge liefen in Korrekturabzügen bei den Proben ein, die Orchester- und Chorstimmen folgten bis in die letzten Tage vor den Erstaufführungen am 5., 6. und 7. Juli. [Anm. von Bungert: Allerdings rief die Überanstrengung der Augen eine starke lang andauernde Entzündung hervor.]
Manches konnte aus verschiedenen scenarisch-technischen Gründen nicht zur Aufführung kommen, doch im Ganzen wurde das Werk in 3 Abenden unter der Rollenbesetzung bedeutendster schauspielerischer Kräfte von Berlin und andern Hauptstädten Deutschlands in der von Max Grube eingerichteten Lesart, mit herrlichen Dekorationen von Georg Hacker, unter der vorzüglichen Leitung des Kapellmeister Fröhlig aufgeführt und fand in den 4maligen Cyklen der 3 Abende den begeistertsten Beifall des Publikums, das jeden Abend das Theater bis auf den letzten Platz gefüllt hatte. –
Einige Einführungsworte zu vorliegender Faust-Musik mögen gestattet sein.
Der I. Teil des Faust begann nach Vorausgang einer breiten Horn- und Trompeten-Fanfare mit dem Vorspiel auf dem Theater. Dann folgte das Ganze in der Original-Lesart bis zum Schluß mit einigen Strichen in der Walpurgisnacht; die Kürzungen mußten wegen mangelhaften scenischen Apparates stattfinden. Die Aufführung dauerte 6 Stunden, sodaß die Idee entstand, bei späteren Aufführungen den I. Teil auf 2 Abende zu verteilen; dann natürlich in breitester Weise die Walpurgisnacht zu bringen und zwar so, daß der 1. Abend mit der Hexenküche schließt und das Gretchen-Drama den 2. Abend bilden würde, während der II. Teil (auch in 2 Abende zerfallend), im 3. Abend mit der „Peneiosscene“ (Chiron, Faust, Manto) schloß, und dann im 4. Abend mit der Helena-Tragödie beginnend, bis zum Schluß des Werkes mit einigen Umstellungen und Strichen wieder möglichst die Goethesche Dichtung intakt ließ.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist das Werk, wie vorliegend, anzusehen.
Durch die Einteilung des I. Teiles in 2 Abende ist es möglich, die einzelnen, oft sehr kurzen Scenen durch musikalische Zwischenspiele, die die vorhergehende Scene ausklingen lassen und in die folgende stimmungegemäß überleiten, zu verbinden. Es wird dadurch, abgesehen von der so erleichterten Verwandlung der Decoration, möglich sein, im Gemüt des Zuschauers die früher gesehene Handlung sich vertiefen zu lassen, und ihn halb traumhaft auf der Musikwelle in die Stimmung der folgenden Scene hinüberzutragen, sein Empfindungsvermögen von neuem spannend, ihn empfänglich zu machen, die Poesie der herrlichen Sprache ganz und voll zu genießen und in sich aufzunehmen.
Grade also eine ruhige, statt einer überhasteten Verwandlung der Scene, (wie dieses letztere bisher der Fall war), dürfte das Richtige sein; eine Musiküberleitung als Brücke von einer zur andern Scene, stets dem Inhalt beider Scenen gemäß. Man sehe sich als Beispiele die Gartenscene und Gartenhäuschenscene an; darauf folgend Wald und Höhle, Gretchen am Spinnrad, in Marthen’s Garten, Gretchen und Lieschen am Brunnen, Gretchen vor der Mater dolorosa, Zwinger und Valentinscene u. s. w.
Es sei nun hier gleich bemerkt, daß bei der Komposition, wie z. B. des Liedes: Gretchen am Spinnrad, der König in Thule, u. s. w. die idealste Besetzung gedacht ist, und daß nach Möglichkeit jeder Bühne den vorhandenen Darstellern gemäß sich einrichten wird.
Daß Goethe das ganze Werk gewissermaßen in Musik getaucht sich gedacht hat, geht aus unzähligen Stellen auf das evidenteste hervor. Auch stimmen darin wol sämtliche Kommentare überein. Sagt doch sogar der Dichter im II. Teil in der Euphorionscene: „Von hier an mit vollstimmiger Musik!“ [Anm. von Bungert: Wie gewaltig diese Scene in vorliegender Form wirkte, ersehe man aus den Berichten.] Er wünscht hier (und nun gar im Schlußakt des Werkes!) tatsächlich die Form der Oper. Des Näheren darauf einzugehen und dieses zu beweisen mag einem besonderen Aufsatz vorbehalten sein.
Es möchte, nebenbei bemerkt, in der ganzen dramatischen Litteratur kaum eine Gestalt geben, wo, wie bei der des Euphorion, in der Reihenfolge von Stimmungen und Scenen, das gesprochene Wort der innern Erregung gemäß so natürlich in das gesungene Wort übergeht; wo das Wort so zur Melodie sich gestaltet, gleichsam wie selbstverständlich; und wo ebenso natürlich und von sich selbst ergebend das gesungene Wort wieder in das gesprochene zurücktreten kann.
Man mag aus den kritischen Stimmen lesen, bis zu welcher gewaltigen, ergreifenden Wirkung sich dieser Akt in den Düsseldorfer Festaufführungen aufbaute.
Zum ersten Male findet man hier auch die 4teiligen Chöre am Schluß der Helena-Tragödie komponiert, beginnend mit dem Chore „Zurückgegeben sind wir dem Tageslicht“. Goethe hat zweifellos die Scene hier, nach dem erschütternden Akt, als ein Satyrspiel ähnliches Ausklingen sich gedacht. Daß bei richtiger glänzender Ausführung dieser Schluß bei Gesang und bacchantischem Tanz von grandioser Wirkung sein würde, ist zweifellos. Soll doch „an Prospekten und an Maschienen, an groß[en] und kleinen Himmelslichtern, Sternen, an Wasser, Feuern, Felsenwänden, an Tier und Vögeln nicht gespart werden – um mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle zu schreiten.“
Ganz verkehrt aber erscheint es, die obigen Chöre in den wundervollen Poesie-Worten sprechen und dann mit etwa 16 Takten Musik, die die Scene musikalisch illustriert, jämmerlich nachhumpeln zu lassen. Dann ist es schon richtiger und dramatisch gewaltig wirksamer, gleich mit den Worten der Helena oder des Phorkias „Wir sehn uns wieder, weit gar weit von hier“, zu schließen.
In den überall eingestreuten Liedern galt es, (natürlich immer mit Berücksichtigung auf den darzustellenden Charakter und auch der betreffenden Situation), vor allen Dingen den Volkston zu treffen, den Goethe, wie auch Shakespeare in den eingelegten Liedern beabsichtigt hat [Anm. von Bungert: Daß Goethe im Lemurengesang einen andern Vers des Totengräberlieds im Hamlet (ein altes Volkslied) aufnahm, darf als bekannt vorausgesetzt werden.]. –
Wie weit nun das melodramatische Element im vorliegenden Material benutzt wird, steht dahin. Als Grundsatz stellte sich der Tondichter die Aufgabe, durchweg das Übersinnliche, Geheimnisvolle, das Spukhafte, Fantastische, das Erhabene, vielfach auch das Dämonische mit Musik zu begleiten; es wird natürlich ganz von der Regie eines jeglichen Theaters abhängen, das sich eignende aus der vorhandenen Fülle zu bringen oder auszulassen; ebenso mag an der Hand der Regie und des Kapellmeisters oft die Komposition einer Stelle (möglichst leise gespielt) melodramatisch benutzt werden.
Auf den ersten Blick wird man sehen, daß (und wol zum ersten Mal) die melodramatischen Stellen sämtlich so im Auszug eingetragen sind, daß zu jeder Zeile, ja bis aufs Wort, genau die Musik, Takt für Takt angegeben ist. Da ebenso genau der Text der Dichtung in die Partitur eingetragen ist, bleibt dem Darsteller durchaus seine völlige Freiheit eines hier und da rascheren Tempos; es liegt in der Hand des Dirigenten, dem Darsteller bis in die kleinsten Abtönungen des Ausdrucks, leicht und ihm sich schmiegend, zu folgen, seine Worte und Gebärden zu illustrieren, zu tragen und noch zu haben [Anm. von Bungert: In den Düsseldorfer Festspielen erreichte dieses Kapellmeister Fröhlig in vorzüglicher Weise.].
Es wird zuträglich sein, das Orchester nach Notwendigkeit, der Akustik des Saales gemäß, teilweise zu decken.
Im Übrigen wird das Studium des Auszuges, mit der Partitur zur Hand und bei der Vertiefung in die Dichtung alles andere ergeben.
Nur über die Besetzung der Engel im Prolog im Himmel durch männliche Darsteller noch einige Worte [Anm. von Bungert: Hierüber wird demnächst ein größerer Aufsatz vom Verfasser erscheinen.].
Die bisherige Besetzung der Engel durch Frauenstimmen erscheint ein großer Irrtum. Die drei Gestalten sind hier gewissermaßen die Verkörperung der Gott untergebenen Naturgewalten, wie auch (trotz der Anschauung der Geschlechtslosigkeit der Engel) durch ihre Namen es angedeutet ist. In den darauf bezüglichen Bibelstellen ist durchaus nicht von der Weiblichkeit der Gestalten die Rede. Es sind hier gewissermaßen die dem Throne des höchsten Herrschers der Welten unterstellten Fürstenengel (s. v. w.), sie sind seinem Throne nahegestellt, sind Ausübende seiner Macht; sie entstammen nicht der Region der himmlischen Heerscharen, von denen Mephisto sagt „die Racker sind doch gar zu appetitlich.“ So dachte sich der Verfasser dieselben etwa auf das Schwert gestützt und gewappnet. Gesprochen erscheinen die unvergleichlichen Worte, von der Scene und Situation abgesehen, ohnehin schon zu gewaltig und breit, um auch nur annähernd ihrer Bedeutung gemäß Wirkung zu geben [Anm. von Bungert: Übrigens fand meine Auffassung auch in Düsseldorf die volle Zustimmung und den Beifall der Maler Jensen, Gebhard, Achenbach u. s. w.].
Daß durchweg in der Musik die Benutzung des Leitmotiv’s herrscht, daß dadurch viele Scenen eine eindringlichere Wirkung erreichen konnten, sei dem Urteil der aufmerksamen Zuhörer überlassen.
So wurde z. B. der Ostergesang als Motiv mehrfach angewandt, in der Beschwörung des Pudels im Studierzimmer [Anm. von Bungert: „Kannst du ihn lesen? / Den nie Ausgesprochenen.“] und insbesondere in der Schlußscene, da die Worte des Mephisto: „Sie ist gerichtet!“ und der Stimme von oben „Ist gerettet!“ als Gegensatz erklingend, gesprochen fast zu rasch und nicht eindringlich genug erscheinen dürften. Hier erschien die Benutzung des Ostergesanges des Chor’s der Engel:
„Christ ist erstanden!
Freude dem Sterblichen,
Den die verderblichen
Schleichenden, erblichen
Mängel umwandeln!“
als Unterlage für die Worte Gretchens:
„Dein bin ich Vater! Rette mich!
Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen!“
mit dem Gedanken also des Opfertodes des Heilands für die sündige, reuige Menschheit, bei Gretchens Rettung, geradezu geboten. Abgesehen davon, daß dadurch im Werke, auch insbesondere in Goethe’schem Sinne glücklich „Anfang und Ende sich in Eins zusammenziehen“. Es lag nahe, daß das melodramatische Motiv zu den Worten im I. Teil:
„Werd’ ich zum Augenblicke sagen
Verweile doch, du bist schön!“
dasselbe sein mußte im II. Teil zu den Worten:
„Zum Augenblicke dürft’ ich sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!“
Als interessante, durch die Leitmotive glücklich zusammengestellte, in Parallele gebrachte Scenen seien erwähnt die Raubscene (II. Teil) des Habebald und Eilebeute in des Kaisers Zelt und die des Erzbischofs mit dem Kaiser; wo dasselbe Leitmotiv in der Verlängerung in pathetischer Fassung erscheint.
Daß die Hälfte des V. Aktes des II. Teiles ganz für Musik gedacht ist, wer wollte das verkennen!
Bisher wurden die Worte des Mephisto mehr oder weniger mit Musik unterstrichen, d. h. es wurde versucht, seine Worte durch Musik noch teuflischer im Ausdruck zu machen und dennoch war es logisch hier, vom umgekehrten Standpunkt auszugehen, da er doch meistens während der ewig-rein aus himmlischer Sphäre erklingenden Engelschöre, dann sich ihm nahend, und ihn täuschend, spricht und daß gerade dadurch, während der reinen keuschen Gesänge, des Teufels Sprache und niedrig klingendes Organ am stärksten in Gegensatz dazu treten wird.
Die Schlußscene der ganzen Tragödie, ist in zwei Lesarten komponiert. De eine wird mit dem Chorus mysticus schließen, wie angegeben. Die andere Lesart bringt nach Schließung des Vorhanges den Gedanken zur Ausführung, daß das Publikum sich erhebt und die letzten Worte des Chorus, gleichsam als Bestätigung, als Bejahung des Gesehenen, Gehörten, Erlebten, singend wiederholt. Fast möchte es nach diesem Schauspiel ohnegleichen, nach dieser Menschheitstragödie psychologisch den Zuschauern als Bedürfniss erscheinen, gleichsam als antiker Chor die Worte des Chores zu wiederholen. Goethes Faust wird in dieser Form einer Tetralogie stets mehr oder weniger ein Festspiel, ein Bühnenweihespiel bleiben, während jeder Abend, einzeln aufgeführt, die Leistungsfähigkeit eines guten Theaters nicht übersteigt.
Düsseldorf, Juli 1903.
Aug. Bungert.
[Transkription: Christoph Hust]
Johanna Steinborn: „Christoph Schaffrath und die Triosonate“
Johanna Steinborn (Bamberg / Leipzig)
Christoph Schaffrath und die Triosonate:
Ästhetik, Kompositionstechnik und Rezeption
Leben und Werk des preußischen Komponisten Christoph Schaffrath stellen trotz der in den letzten Jahren erfolgten Wissenszuwächse noch immer eine Forschungslücke dar (vgl. Hartmut Grosch, Christoph Schaffrath – Cembalist, Komponist, Lehrmeister, in: Die Rheinsberger Hofkapelle von Friedrich II., Musiker auf dem Weg zum Berliner „Capell-Bedienten“, hrsg. von Ulrike Liedtke, Rheinsberg 2005, sowie Reinhard Oestreichs Vorwort zu seinem Verzeichnis der Werke Christoph Schaffraths, Beeskow 2012, S. 7–16). Wenig ist über die Biographie des langjährigen musikalischen Untergebenen Friedrichs II. bekannt, und weite Teile seines handschriftlich überlieferten Œuvres harren noch der Erschließung. Der vorliegende Beitrag soll ein neues Detail zur Schaffrath-Forschung ergänzen und an einem Beispiel nach dem Verhältnis von Kompositionstechnik und Gattungsästhetik zur Mitte des 18. Jahrhunderts fragen. Die erst seit kurzem edierte Triosonate g-Moll für Oboe, Violine und Basso continuo CSW:E:18 macht exemplarisch deutlich, wie Schaffrath seine Musik in der Relation zu zeitgenössischen, streng kontrapunktischen Kompositionsprinzipien verortete (die Edition, hrsg. von Bernhard Päuler, ist bei Aurea Amadeus unter der Nummer 265 erschienen). Dies kann zwei miteinander verbundene Fragen klären. Erstens erhellt es, wie eng Theorie und Praxis in der Berliner Musikkultur des 18. Jahrhunderts miteinander verbunden waren, die in der öffentlichen Wahrnehmung bekanntlich nicht zuletzt aus der Überblendung dieser Bereiche definiert war. Zweitens lassen sich an diesem Beispiel Gründe dafür aufzeigen, weshalb Schaffrath, zu seiner Zeit immerhin einer der namhaftetesten Musiker Berlins, im späteren Musikleben so weitgehend vergessen wurde.
Schaffraths kompositorisches Schaffen umfasste ausschließlich Instrumentalwerke. Sie reichen in der Besetzung von Solosonaten bis zum Konzert. Die Trios bildeten darunter wahrscheinlich den größten Teil der einstmals schriftlich fixierten Kompositionen. Heute sind jedoch nur noch sieben Sonaten für verschiedene Holzbläser- und Streichinstrumentenensembles erhalten. Selbst unter diesen sieben Sonaten kann Schaffraths Autorenschaft nicht immer zweifelsfrei angenommen werden. Oestreich vermutet aufgrund zeitgenössischer Werkverzeichnisse die Existenz von ehemals 60 bis 80 Trios (Verzeichnis der Werke Christoph Schaffraths, siehe oben, S. 23). Dass sich die Triosonate in ihrer Besetzung mit zwei Oberstimmen und Basso continuo in Berlin großer Beliebtheit erfreute, zeigen neben Schaffraths Werken auch die fast aller seiner Berliner Kollegen: In so gut wie jedem Werkverzeichnis von Komponisten aus diesem kulturellen Kontext finden sich Trios, wenn auch meist in geringerer Anzahl als bei Schaffrath vermutet (beispielsweise bei Johann Gottlieb Graun, Carl Heinrich Graun oder Johann Joachim Quantz).
Grundlage der vorliegenden Untersuchung ist Schaffraths Trio CSW:E:18, D-B AmB 495/II. Grundsätzlich sind einige Autographen und Abschriften von Schaffrath seit 2006 datiert, so auch eine Abschrift dieser Komposition in der Sammlung Thulemeier (Tobias Schwinger, Die Musikaliensammlung Thulemeier und die Berliner Musiküberlieferung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (ortus studien 3), Beeskow 2012). Demnach wäre das Trio vermutlich in den 1750er Jahren (zwischen „vor 1751“ und ca. 1760) entstanden. Zu dieser Zeit war Schaffrath bereits von seiner Position als Hofcembalist Friedrichs II. an den Hof der Prinzessin Anna Amalia gewechselt. Wie ihr Bruder war auch sie eine begeisterte Musikerin. Als Dienstherrin mehrerer Musiker nahm sie auf die Geschmacksbildung Einfluss und förderte eine Schreibart, die – vor allem außerhalb Berlins – zu dieser Zeit eigentlich schon anachronistisch erschien (ebd., S. 3). Sicherlich wurde sie darin von ihrem Lehrer Johann Philipp Kirnberger und seinem Beharren auf der streng kontrapunktischen Satzlehre bestärkt (ebd., S. 86f.). Nach diesem tradierten Regelwerk stellten die Vorherrschaft des Basses über der Melodie und die Regelgerechtigkeit des Satzes die Weichen zur Vollkommenheit eines Stückes. Dass zur gleichen Zeit anderswo schon andere Modelle diskutiert wurden, nahm Kirnberger durchaus wahr, verstand dies jedoch als den Gegensatz zweier Schreibarten:
„Jene strenge Schreibart wird vornämlich in der Kirchenmusik […] gebraucht; diese [die „freye oder leichtere Schreibart“] aber ist vornehmlich der Schaubühne und den Concerten eigen, wo man mehr die Ergötzung des Gehörs, als die Erweckung ernsthafter oder feyerlicher Empfindungen zur Absicht hat. Sie wird deswegen insgemein die galante Schreibart genennt, und man gestattet ihr verschiedene zierliche Ausschweiffungen, und mancherley Abweichung von den Regeln.“ (Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Berlin 1771–1779, hrsg. von Gregor Herzfeld, Kassel 2004, S. 80.)
Zu Schaffraths Stellung im Berliner Musikleben
Grundsätzlich gliedert Schaffraths Œuvre sich fast nahtlos in das Raster seines Berliner Umfelds ein. Obwohl über seine Ausbildung fast nichts bekannt ist, lässt auch die vorliegende Triosonate im Speziellen seine Verpflichtung zur kontrapunktischen Tradition erkennen. Es sei dahingestellt, ob man Gerhard Poppes These folgen möchte, Schaffrath sei Schüler Jan Dismas Zelenkas gewesen (Gerhard Poppe, Die Schüler des Jan Dismas Zelenka, in: Musikkonzepte – Konzepte der Musikwissenschaft. Bericht über den Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung Halle (Saale) 1998, hrsg. von Kathrin Eberl und Wolfgang Ruf, Kassel 2000, Bd. 2, S. 292f.) und stünde damit direkt in der Tradition der traditionellen Kontrapunktlehre nach Johann Joseph Fux – auf jeden Fall reflektiert sein Werk diese Art der gediegenen Ausbildung, auch wenn er sich neueren Stilelementen und ungewöhnlichen melodischen Wendungen nicht grundsätzlich verschloss.
Vor allem als Mitglied des Ruppiner und später Rheinsberger Hofmusikensembles des Kronprinzen Friedrich II. hatte Schaffrath an aktuellen musikalischen Experimenten teil. Neue Besetzungsvarianten wurden ebenso erprobt wie die moderne Spielart des Solokonzerts (in seinem Fall: des Cembalokonzerts) und rezente Stilmittel (Hartmut Grosch, Christoph Schaffrath. Komponist – Cembalist – Lehrmeister, in: Die Rheinsberger Hofkapelle von Friedrich II. Musiker auf dem Weg zum Capell-Bedienten, hrsg. Ulrike Liedtke, Rheinsberg 2005, S. 217). Dabei war diese Musikpraxis alles andere als regional engstirnig. Viele Musiker dieser beiden Vorläufer der späteren königlich-preußischen Hofkapelle waren weit gereist und reisten auch zur Zeit ihrer Tätigkeit für Friedrich II. noch. Zudem ließ Friedrich sich Musik aus dem Ausland schicken (Sabine Henze-Döhring, Friedrich der Große. Musiker und Monarch, München 2012, S. 30), informierte sich also durchaus über die musikalischen Entwicklungen außerhalb Preußens, und ließ im begrenzten Rahmen einen Austausch mit anderen regionalen Musiksprachen zu.
Schaffrath war auf musikpraktischem und -theoretischem Gebiet vielfältig aktiv. Zeitgenössische Dokumente nennen ihn als engagierten, gründlichen Lehrer. Ausdruck dafür ist noch der ihm gewidmete Artikel in Gerbers Tonkünstlerlexikon:
„Schafrath […] ist einer unserer würdigsten Contrapunktisten gewesen. Mehrere der merkwürdigsten Komponisten, Virtuosen und Sänger, welche in diesem Buch vorkommen, waren seine Schüler. Überdies hat er auch verschiedene schöne und so gründliche Kompositionen, als man sie von einem Schafrath erwarten konnte, hinterlassen.“ (GerberATL, Bd. 2, S. 404.)
Das Zitat zeigt deutlich: Als Lehrer genoss Schaffrath noch zu Gerbers Zeit einen hervorragenden Ruf. Neben einer erheblichen Anzahl an heute unbekannteren Musikern hatte er auch einige Berühmtheiten seiner Zeit unterrichtet. Seinen Kompositionen wird in der Generation nach ihm dagegen schon weniger enthusiastische als vielmehr pflichtbewusste Anerkennung gezollt; sie galten lediglich als „gründlich“ und korrekt, mehr lehrreich intendiert denn inspirierend.
Zusätzlich zu dieser kompositorischen und pädagogischen Arbeit war Schaffrath sein ganzes Leben lang als Cembalist tätig. Im Einklang mit Berliner Idealen widmete er sich wenigstens sporadisch auch der musiktheoretischen Schriftstellerei; überliefert ist das Manuskript einer unvollendeten Kompositionslehre (Theorie und Praxis der Musik, D-B AMB 605/6). Schaffraths in der Summe herausgehobene Position und übergeordnete Funktion im Kreise der Hofmusiker belegt vor allem seine Lehrtätigkeit; auf König Friedrichs Wunsch unterrichtete er einige andere Kapellmitglieder ebenso wie manche Sänger. Durch seine frühere Tätigkeit in der Kapelle Augusts des Starken war er ebenso bewandert in italienischer Gesangsdiminution. (Der damals sehr berühmte Kastraten-Sopran Felice Samnini erhielt bei Schaffrath Unterricht. Hiller äußert sich darüber folgendermaßen: „Samnini war es gelungen, auf seine wohlbekannte, bewegende Weise, das Adagio mit schönen und wohlüberlegten Verzierungen zu singen. Dabei kam ihm zugute, daß er sich bestens in den Grundharmonien auskannte und daß er bei Schaffrath studiert hatte“ (zitiert nach Grosch, Christoph Schaffrath, in: Die Rheinsberger Hofkapelle, siehe oben, S. 222).) Schaffrath war also kein einfaches Capell-Mitglied, sondern ein Mentor und umfassend informierter musikalischer Ausbilder für viele der Musiker. Da Friedrich II. selbst diesen Unterricht anwies, kann dessen Bedeutung gar nicht hoch genug geschätzt werden. Der Monarch selbst erkannte Schaffrath demnach in der Musik als einen Kollegen an, der es würdig war, ihn in dieser pädagogischen Mission zu vertreten.
1741 wechselte Schaffrath von der Position als erster Cembalist der königlichen Hofkapelle an den Hof der Prinzessin Anna Amalia. Seine dortige Tätigkeit als Kammermusiker scheint eher nebenberuflicher Natur gewesen zu sein, da sich bislang keine Gehaltsnachweise finden ließen (Christoph Henzel, Agricola und andere, in: Jahrbuch des staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, hrsg. von Günther Wagner, Stuttgart 2003, S. 56). Der Brotberuf hingegen war wohl seine Lehrtätigkeit. Anna Amalia allerdings erhielt keinen Unterricht von ihm; sie hatte Kirnberger als Lehrer gewählt. Mit ihm teilte Schaffrath sich auch die Aufgabe, sich um die Bibliothek seiner Dienstherrin zu kümmern, in die nach seinem Tod auch seine eigene Musikaliensammlung eingegliedert wurde (Renate Blechschmidt, Die Amalien-Bibliothek, Berlin 1965, S. 25).
Schaffraths Trio g-Moll vor dem Hintergrund der Gattungsästhetik
Zeitzeugnisse belegen zur Genüge, dass Schaffrath als Komponist zu seinen Lebzeiten – anders als in der posthumen Rezeption – nicht nur bekannt, sondern auch geschätzt war (Grosch, Christoph Schaffrath, in: Die Rheinsberger Hofkapelle, siehe oben, S. 217). Nur ein Beispiel unter vielen ist der ihm geltende Artikel bei Ledebur, der den „Kammermusikus der Prinzessin Amalie v. Pr. zu Berlin, Geb. 1709 zu Hohenstein bei Dresden“, als „tüchtige[n] Contrapunktist[en] und […] beliebte[n] Lehrer“ ausweist (Tonkünstler-Lexicon Berlins, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, hrsg. von Karl Freiherr von Ledebur, Berlin 1861, S. 498). Trotzdem scheint eine Vorbildwirkung nicht so sehr wahrgenommen worden zu sein wie zum Beispiel bei Carl Heinrich Graun, dessen Kompositionen oft und mit großem Aufwand aufgeführt wurden – hervorgehoben sei vor allem sein Passionsoratorium Der Tod Jesu (Christoph Henzel, Das Konzertleben der preußischen Hauptstadt 1740–1786 im Spiegel der Berliner Presse (Teil I), in: Jahrbuch des staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, hrsg. von Günther Wagner, Mainz 2004, S. 216–291). In der Berichterstattung der Berliner Presse existiert aus den Jahren 1740 bis 1768 dagegen kein einziger Nachweis, in dem Schaffrath als Komponist eines aufgeführten Stückes namentlich erwähnt würde (ebd.). Ein Grund dafür könnte sein, dass bis heute innerhalb seines Œuvres keine Vokalkompositionen bekannt sind, denen durch eine Aufführung in Kirche oder Oper ein größeres Publikum vergönnt gewesen wäre. Sein instrumentalkompositorisches Schaffen betraf im wahrsten Sinne des Wortes „Kammermusik“ für einen intimen Rahmen und sperrte sich der öffentlichen und in der Folge medialen Wirksamkeit.
Das Trio in g-Moll soll nun in diesen hier nur in Umrissen skizzierten Rahmen eingebettet werden. Zu diesem Zweck wird eingangs eine Gattungsästhetik der Triosonate auf der Grundlage der Schriften von Johann Georg Sulzer, Johann Joachim Quantz und Heinrich Christoph Koch rekapituliert, also zweier Berliner und eines mitteldeutschen Musikschriftstellers der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
In Sulzers Allgemeiner Theorie der Schönen Künste aus dem Jahr 1771 stehen einige bemerkenswerte Sätze über die Kammermusik und ihren sowohl kompositionsgeschichtlichen als auch sozialen Ort. Sie werde demnach eher für Kenner zur Übung ihrer Fähigkeiten und Liebhaber mit geschulten Ohren als für Laien gemacht, und ihr Stil müsse sich folglich durch Reinheit des Satzes, durch Feinheit im Ausdruck und durch kunstvollere Wendungen auszeichnen als die Musik in der Kirche oder der Oper (Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Bd. 1, Leipzig 1771, S. 189). Gewissermaßen als Königsdisziplin der Komposition ist bei Sulzer in diesem Zusammenhang sodann die Triosonate angeführt. Gute Kammertriokompositionen werden (im Gegensatz zum formal und musikalisch strengeren Kirchentrio) als „leidenschaftliches Gespräch unter gleichen, oder gegeneinander abstechenden Charakteren in Tönen“ charakterisiert. Die größere formale Freiheit sollte der Komponist nutzen, um Abwechslung zu schaffen: Lockere Imitationen, überraschende Einsätze, aber auch korrekt angebrachte Kadenzen und muntere Zwischensätze sollten in ihrer Gesamtheit zu einem individuellen Charakterbild jedes einzelnen Triosatzes trotz der uniformen Gattungsästhetik beitragen. Höchste Erwartungen stellt Sulzer an den Komponisten: „Daher erfodert das Kammertrio eine Geschiklichkeit des Tonsezers, die Kunst hinter dem Ausdruk zu verbergen“ (ebd.).
In Quantz’ Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen gelten die ersten Paragraphen des XVIII. Hauptstücks (Wie ein Musikus und eine Musik zu beurtheilen sey) der Klage, dass die wenigsten Menschen in der Lage seien, Musik angemessen zu beurteilen:
„Nicht nur ein jeder Musikus, sondern auch ein jeder, der sich für einen Liebhaber derselben [der Musik] ausgiebt, will zugleich für einen Richter dessen, was er höret, angesehen werden“ (Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, Berlin 1752, Faksimile-Reprint, Kassel 2004, S. 275).
Im weiteren Verlauf folgen regelrechte Kataloge von Qualitätskriterien, die die unterschiedlichen Musikgattungen zu erfüllen hätten, um Quantz’ Ansprüchen zu genügen. § 44 behandelt den „Quatuor“ mit drei solistisch agierenden Instrumenten und einer Generalbassstimme. Quantz bezeichnet ihn respektvoll als den „Probierstein eines echten Contrapunctisten“ und verweist auf Telemanns Pariser Quartette als Musterbeispiele der Gattung (ebd., S. 302).
§ 45, in dem Quantz nach dem Quatuor nun seine darauf aufbauenden Qualitätskriterien für das Trio niederlegt, sei im Folgenden vollständig wiedergegeben (ebd., S. 302f.). Dabei soll zugleich versucht werden, diesen spezifisch Berliner Kriterienkatalog des Trios mit Schaffraths kompositorischem Beitrag zur Gattung zu vergleichen und übereinstimmende Momente aufzudecken.
„Ein Trio erfordert zwar nicht eine so mühsame Arbeit, als ein Quatuor; doch aber von Seiten des Komponisten fast dieselbe Wissenschaft; wenn es anders von der rechten Art seyn soll. Doch hat es dieses voraus, daß man darinne galantere und gefälligere Gedanken anbringen kann, als im Quatuor: weil eine concertirende Stimme weniger ist. Es muß also in einem Trio 1) ein solcher Gesang erfunden werden, der eine singende Nebenstimme leidet. [Selbst für das eher sperrige Anfangsthema des Adagios findet Schaffrath eine melodiöse Gegenstimme (zweiter Satz (Adagio), T. 8–14; siehe Notenbeispiel.] 2) Der Vortrag beym Anfange eines jeden Satzes, besonders aber im Adagio, darf nicht zu lang seyn: weil solches bey der Wiederholung, so die zweyte Stimme machet, es sey in der Quinte, oder in der Quarte, oder im Einklange, leichtlich einen Ueberdruß erwecken könnte. [Der solistische Beginn des Adagios erstreckt sich lediglich über 7 Takte.] 3) Keine Stimme darf etwas vormachen, welches die andere nicht nachmachen könnte. [Das trifft zu – der Tonumfang der Oboe wird nur an wenigen Stellen von der Violine unter- oder überschritten (z. B. im ersten Satz (Allegro), T. 149). Schaffrath fordert keine instrumentenspezifischen Spieltechniken wie zum Beispiel Doppelgriffe.] 4) Die Imitationen müssen kurz gefasset, [Die Imitationen beschränken sich, außer zu Beginn der Sätze, auf kleine Motive von höchstens einem Takt Länge (zum Beispiel: erster Satz (Allegro), T. 29–32; siehe Notenbeispiel.] und die Passagien brillant seyn. [Die schnellen Läufe sind melodiös und ohne große Sprünge (zum Beispiel erster Satz (Allegro), T. 109–113; siehe Notenbeispiel).] 5) In Wiederholung der gefälligsten Gedanken muß eine gute Ordnung beobachtet werden. [Dafür sprechen zum Beispiel die Anfänge der zweiten Teile der Ecksätze, die jeweils das Anfangsthema in anderer Tonart wiederholen (erster Satz (Allegro), T. 82–96 bzw. dritter Satz (Presto), T. 70–84); siehe Notenbeispiel.] 6) Beyde Hauptstimmen müssen so gesetzet seyn, daß eine natürliche und wohlklingende Grundstimme darunter statt finden könne. [Die Bassstimme schreitet melodiös fort und enthält auch kleinere motivische Bestandteile (zum Beispiel erster Satz (Allegro), T. 43/3–48/1; siehe Notenbeispiel).] 7) Soferne eine Fuge darinne angebracht wird, muß selbige, eben wie beym Quatuor, nicht nur nach den Regeln der Setzkunst richtig, sondern auch schmackhaft, in allen Stimmen ausgeführet werden. Die Zwischensätze, sie mögen aus Passagien oder anderen Rahmungen bestehen, müssen gefällig und brillant seyn. [Dies trifft auf diese Sonate allerdings nicht zu, da sie keine strenge Fuge enthält.] 8) Obwohl die Terzen- und Sextengänge in den beyden Hauptstimmen eine Zierde des Trio sind; so müssen doch dieselben nicht zum Missbrauche gemachet, noch bis zum Ekel durchgepeitschet, sondern vielmehr immer durch Passagien oder andere Nachahmungen unterbrochen werden. [In den Ecksätzen kommen kaum ausgedehnte Terz- oder Sextgänge vor. Im Mittelsatz ist dies zum Beispiel in den Takten 31 bis 38 der Fall; siehe Notenbeispiel.] Das Trio muß endlich 9) so beschaffen seyn, daß man kaum errathen könne, welche Stimme von beyden die erste sey. [Beide Oberstimmen haben ungefähr den gleichen Spielanteil und Ambitus und spielen dieselben Motive (siehe auch Anm. 20).]“
Hiermit wird in der ästhetischen Theorie ein genaues Berliner Anforderungsprofil an das instrumentale Kammertrio definiert. Der Abgleich mit Schaffraths Komposition deckt ein Ausmaß der genauen Übereinstimmung auf, das über bloße Zufälligkeiten sicherlich weit hinaus geht. Es ist selbstverständlich heute nicht nachweisbar, ob Johann Joachim Quantz auch diese spezielle Triosonate von Schaffrath kannte und wie er sie möglicherweise eingeschätzt hatte. Hält man sich aber nur an seinen Kriterienkatalog, so kann man feststellen, dass Schaffraths Triosonate diesen Anforderungen in einer der zentralen Schriften der Berliner Ästhetik der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollständig genügt: Theorie und Kompositionspraxis fallen an dieser Stelle in nahezu idealer Weise zusammen.
Rezeption
Die ungebrochene Wirkungsmächtigkeit dieses ehemals Berliner Diskurses zeigt sich noch in den 1790er Jahren, wenn Koch Sulzers Anmerkungen über das Trio wörtlich zitiert. Allerdings konstatiert Koch, dass die bei Sulzer favorisierten Trios – mit drei gleichrangigen, kontrapunktisch geführten Stimmen – zu seiner Zeit bereits aus der Mode gekommen seien (Heinrich Christoph Koch, Versuch einer Anleitung zur Composition, Leipzig 1793, Studienausgabe, hrsg. von Jo Wilhelm Siebert, Hannover 2007, S. 528). Auch Trios mit zwei Haupt- und einer begleitenden Nebenstimme würden kaum noch geschrieben oder gespielt. Koch begründet diese Tatsache mit dem Aufkommen des virtuosen Konzerts und dem zu seiner Zeit beliebteren Quartett:
„Ohngefähr die Mitte dieses Jahrhunderts war derjenige Zeitpunkt, in welchem diese Gattung der Sonate am stärksten bearbeitet wurde, und in welchem viele Tonsetzer sehr schätzbare Producte dieser Art geliefert haben, die aber größtenteils nur durch Abschriften hier und da bekannt worden sind, und die theils wegen des anjetzt beliebten Quartets, theils auch wegen des allgemeinen Hanges der jetzigen Virtuosen zum Concertspielen, ungebraucht vermodern“ (ebd.).
Außerdem erwähnt er noch eine andere Art des Trios, in der nur eine Hauptstimme vom Bass und der zweiten Oberstimme (als einer „Füllstimme“) begleitet wird. Diese Art ist ihm allerdings nur die kurze Bemerkung wert, dass sie „in der Hauptstimme einen sehr reizenden und ausdrucksvollen Gesang“ erfordert (ebd.). Aus der Kürze der Bemerkung könnte darauf zu schließen sein, dass Koch nur wenige erwähnenswerte Beispiele hierfür kannte. Doch war auch diese Kompositionsweise keineswegs neu, wie zum Beispiel der Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner in seinem ca. 1744 entstandenen Trio h-Moll GWV 219 (hrsg. von Vanessa Mayer, Edition Schott, Mainz 2007) für Flöte, Violine und Basso continuo beweist, in dem er der Violine eindeutig die Hauptstimme zuerkennt und die Flöte nur im kurzen Mittelteil des zweiten Satzes „solistisch“ in Erscheinung tritt. Graupner wirkte in Hessen – an der Diskrepanz der musikalischen Tonfälle wird deutlich, wie in sich geschlossen die Berliner und mitteldeutsche Musikwelt im 18. Jahrhundert gewirkt haben muss. Schaffraths Musik müsste für die von Koch imaginierten Zuhörer der 1790er Jahre also bereits damals in jeder Hinsicht veraltet, aber kontrapunktisch gelehrt (und insofern kompositionstechnisch auch „lehrreich“) geklungen haben.
Zweifelsohne lässt sich die Frage bejahen, ob Schaffraths g-Moll-Trio gleichsam in die Berliner Musikästhetik seiner Zeit hineinkomponiert worden sei. Der Vergleich mit allen angeführten Autorenmeinungen ergab keine Differenzen. Gerade weil wir um Christoph Schaffraths pädagogische Interessen wissen, erscheint es nicht fern, auch seinen Kompositionen wenn schon nicht einen klar belehrenden Impetus, so doch wenigstens den Wunsch nach einer gewissen Musterhaftigkeit zu attestieren. Im Nichtabweichen von vorgegebenen Formen und Mustern, im Ausreizen der durch so viele Traditionen klar definierten Grenzen liegt ein wesentlicher Reiz seiner Stücke. Es kommt zu keinem großen Ausbruch, keiner offenen Verletzung der Regeln. Also entscheiden, auch hier der Theorie der Gattung gemäß, gerade die Details über die musikalische Unverwechselbarkeit. Eben diese ästhetische Passgenauigkeit auf allen Ebenen des Tonsatzes und seiner sozialen Einbettung erklärt dann aber auch, warum Schaffrath vor allem nach dem Tode seines Dienstherren Friedrich II. im Jahr 1786, dessen Musikgeschmack schon zu Lebzeiten als überholt gegolten hatte, so schnell und bis vor kurzer Zeit in Vergessenheit geriet.
[Dieser Artikel basiert auf der 2013 geschriebenen Diplomarbeit der Verfasserin.]
Über die Deklamation im 18. Jahrhundert
Anlässlich der Aufführung des Melodrams “Ariadne auf Naxos” von Johann Christian Brandes und Georg Anton Benda an der HMT Leipzig im April 2013 entstand dieser Programmhefttext von Marie Kuijken.
Heutzutage wird in der deutschen Prosodie, also auch beim Vortag oder der Deklamation eines Textes, nicht mehr mit Längen und Kürzen der Silben gerechnet, sondern lediglich mit betonten und unbetonten Silben. Deutsch wird als eine Sprache aufgefasst, in der nur das akzentuierende Prinzip gilt, nicht das quantitierende wie im Altgriechischen und Lateinischen. Im 18. Jahrhundert dachte man anders darüber. Man hat beide Prinzipien im Deutschen klar empfunden und bewusst gelten lassen und in einem speziellen Wissensgebiet, der Metrik, Regeln dazu zusammengestellt. Man wollte verstehen, welche Silben beim Sprechen (eher) lang und welche (eher) kurz seien und welche Verhältnisse zwischen der Dauer und dem Ton einer Silbe wirkten (Betonung oder Tonlosigkeit). Dies alles hatte zum Ziel, bei der Deklamation »Wohlklang und gefällige Bewegung« zu befördern, »der Schönheit wegen, für sich und durchaus« (Johann Heinrich Voß, Zeitmessung der deutschen Sprache [Königsberg 1802], hrsg. von Abraham Voß, Königsberg 1831, S. 3 und S. 109). Man suchte in dem »Gewühl von Wortfüssen […] die höchste, in ihnen mögliche Mannigfaltigkeit« (ebd., S. 108). Friedrich Gottlieb Klopstock meinte dazu: »Sylbenmaß ist Mitausdruck durch Bewegung« (Friedrich Gottlieb Klopstock, Grammatische Gespräche [Altona 1794], in: Klopstock’s sämmtliche Werke, Bd. 9, Leipzig: Göschen 1857, S. 93): Die Bewegung der Wortfüße im rhythmischen Vortrag war seiner Meinung nach nicht nur ästhetisch wichtig, sondern auch ein direktes Hilfsmittel zum Ausdruck und Verständnis des Textinhaltes.
Auch heute kann man diese Wortfüße wieder finden und bewusst ausnutzen, sogar in der Prosa, vielmehr noch in der rhythmischen, ›erhabenen‹ Sprache wie in diesem Melodram von Brandes und Benda. Somit lassen sich bei der Deklamation Abwechslung, größere Kontraste, Bewegung, ein klares Verständnis und eine engere Beziehung zur Musik gewinnen.
Ich selbst habe mich mit dieser Materie seit zirka 15 Jahren in verschiedenen Sprachen und auch mit Bezug auf das gesungene Rezitativ oder auf gesprochene Dialoge in Singspielen beschäftigt. So habe mich gefreut, als ich gebeten wurde, an der HMT Leipzig einen Kurs dazu zu leiten. Das Seminar Die Kunst der Deklamation im 18. Jahrhundert anhand des Melodrams »Ariadne auf Naxos«, das am 18. März 2013 stattfand und das mir Gelegenheit gab, einige Stunden mit den beiden Sängern zu arbeiten, die bei der heutigen Veranstaltung deklamieren werden, war ein erster Schritt in der Richtung, die Schönheit des Deklamierens wieder zu beleben.
Goethe hat einmal vom »deklamatorischen Halbgesang« gesprochen (zitiert nach Emil Palleske, Die Kunst des Vortrags, Stuttgart 1880, S. 129). In der Tat wird die Stimme dabei mit einem größeren Tonumfang angewandt als beim Reden. Rhythmisch ergeben sich deutliche Unterschiede in der Dauer der wichtigen und unwichtigen Silben, durch welche dann sozusagen rhythmische Zellen entstehen, Klopstocks »Wortfüße«. Das alles mag für heutige Ohren zunächst einmal ›künstlich‹ klingen. Aber wenn man sich dafür öffnet, kann einem gerade im Kontext eines Melodrams die zurückgefundene Schönheit und Würde sowie die größere Einheit der Sprache mit der Musik nicht entgehen.
Marie Kuijken
Johann Christian Brandes, Georg Anton Benda und das Melodram „Ariadne auf Naxos“ von 1775
Anlässlich der Aufführung des Melodrams “Ariadne auf Naxos” von Johann Christian Brandes und Georg Anton Benda an der HMT Leipzig im April 2013 entstand dieser Programmhefttext von Michaela Bieglerová.
Die Geschichte des griechischen Mythos von Theseus und Ariadne, der Tochter des kretischen Königs Minos, faszinierte schon lange vor Bendas Melodram Künstler aller Sparten. Ariadnes Schicksal bildete die Vorlage vieler bekannter Werke und inspirierte so bekannte Maler wie Tizian, Peter Paul Rubens und viele andere. Aber nicht nur die Malerei und die Bildhauerkunst griffen den Stoff auf. Auch in der Musik erwachte die Geschichte immer wieder zum Leben, so zum Beispiel in Claudio Monteverdis L’Arianna von 1608 oder in Georg Friedrich Händels Ariadna von 1733.
Die griechische Mythologie überliefert mehrere Versionen der Geschichte und lässt das Ende des Mythos teilweise unerklärt – weshalb Theseus Ariadne auf Naxos zurücklässt, bleibt letztlich im Dunkeln. Bendas Librettist Johann Christian Brandes wählte gerade diese finalen Momente der Handlung für sein Textbuch aus, das auf einer ursprünglich für Weimar geschriebenen Kantate beruhte. In der Vorrede seiner Sämtlichen dramatischen Schriften (Hamburg 1790, neu hrsg. als Meine Lebensgeschichte von Willibald Franke, München 1923) schrieb er zur Entstehung des Textes selbst:
Um […] meiner Gattinn, welche sich durch natürliche Talente und Studium in ihrer Kunst zu dem Range einer beyfallswürdigen Schauspielerinn emporgeschwungen hatte, Gelegenheit zu geben, sich in einer ihren Kräften angemessenen glänzenden Rolle zeigen zu können, schrieb ich das Duodrama »Ariadne auf Naxos«, nach dem Inhalte der bekannten Cantate gleichen Namens, von unserm vortrefflichen Dichter Herrn von Gerstenberg […]. Durch den schmeichelhaften Beyfall, womit die verwittwete Herzogin von Weimar dieß kleine Schauspiel beehrte, ermuntert, gab ich es Schweitzern [Anton Schweitzer] zur Composition. Er arbeitete daran mit Fleiß und Glück, und hatte bereits einige Proben dieses musikalischen Fragments in Gegenwart verschiedener Musikkenner mit dem größten Beyfall aufgeführt, als der unglückliche Schloßbrand in Weimar dem dortigen Schauspiel ein Ende machte, und zugleich eine gänzliche Störung aller Kunstgeschäfte verursachte. Schweitzers musikalisches Meisterwerk blieb unvollendet.
Weiter berichtet Brandes, Schweitzer habe die ursprünglich für Ariadne geschriebene Musik dann 1773 in seiner Alceste verwendet. Gleich nach Brandes’ Ankunft in Gotha habe Georg Anton Benda das noch immer unkomponierte Libretto gelesen
und empfahl das Stück der Durchl. Herzoginn und der weiland Durchl. Prinzessinn Luise. Beyde erhabne Kennerinnen beehrten den Text mit den schmeichelhaftesten Lobsprüchen und wünschten es baldmöglichst mit Musikbegleitung auf der Bühne vorgestellt zu sehn.
Da Schweitzer gerade anderweitig beschäftigt war,
wurde an dessen Stelle Benda aufgefordert, die Composition dieses Duodrama zu übernehmen. Der Durchlauchtige Herzog gab selbst die Idee zu der Kleidung Ariadnens nach altgriechischem Geschmack an; die Dekoration zur Vorstellung wurde zweckmäßig geordnet; in einigen Wochen hatte auch Benda die Composition vollendet, und so wurde diese neue Erscheinung im Januar 1775 in Gotha zum erstenmale, in Gegenwart des ganzen Hofes, auf dem Hoftheater vorgestellt, und mit dem größten Beyfall aufgenommen.
Brandes’ Libretto schildert nicht so sehr die äußere Handlung der Geschichte von der verlassenen Ariadne, sondern lässt das Publikum das innere Drama des Liebespaares erleben. Ausgedrückt werden die Gedanken und Gefühle des Theseus, der, um sie zu beschützen, Ariadne gerade trotz seiner Liebe zu ihr verlassen muss, und die der wehrlosen Ariadne, die im Traum schon eine schlechte Vorahnung des Geschehens erhält. Damit bietet das Libretto eine Deutung der Motivation Theseus’ an, die im Mythos offen bleibt. Brandes lässt sich hingegen nicht von der Version der Geschichte inspirieren, nach der Ariadne verlassen wird, damit sie Bacchus bzw. Dionysos heiraten könne – obwohl gerade diese Interpretation oft in der Bildenden Kunst zum Thema geworden war, beispielsweise in Jacopo Tintorettos Gemälde Bacchus und Ariadne von 1576/78:
Im Vorbericht zum Libretto schreibt Brandes zu seiner neu gefundenen Begründung:
Diese, größtentheils nach dem Diodor ausgezeichnete Fabel, ist in gegenwärtigem Duodrama dahin abgeändert, daß Theseus nicht den höchsten Grad von Undankbarkeit gegen Ariadnen äußert; er verläßt sie nicht so wohl aus Leichtsinn, als vielmehr ihr Leben gegen die Wuth der auf Naxus angelandeten Griechen in Sicherheit zu setzen.
Trotz dieser Änderung entbehrt das Libretto nicht der Wirkung von schicksalhaften, himmlischen oder göttlichen Kräften. Somit wird die Erzählung nicht zum Märchen, sondern behält den Charakter des Mythos:
THESEUS. Ariadne!
Er will sie umarmen, fährt aber zurück.
Welche Gewalt, welche unwiderstehbare Zauberkraft reißt mich zurück?
Will es das Schicksal?
Indem Brandes auf den Ausdruck der Gefühle, des inneren Affektes der Personen, fokussiert, entwickelt er die antike Geschichte aus einem zeitgemäß empfindsamen Blickwinkel neu. Die Antike wird rezipiert, indem Brandes sie für die Ausdrucks- und Gefühlswelt seiner Zeit aktualisiert.
Die erste Aufführung von Bendas Musik zu Brandes’ Melodram erfolgte am 27. Januar 1775 im Schlosstheater Gotha. Die Darsteller waren Brandes Frau Charlotte als Ariadne und Michael Boek als Theseus. Der Hof unterstützte das Vorhaben nach Kräften: Die Herzogin beförderte das Manuskript zum Druck, der Weimarer Maler Georg Melchior Kraus fertigte für Herzog Ernst Skizzen aus, Kostüme und Dekorationen wurden in der damaligen Vorstellung des altgriechischen Stils gestaltet. Nicht nur die Leistungen von Benda und Brandes wurden nach den Aufführungen gelobt, auch die Schauspieler erhielten glänzende Kritiken. August Wilhelm Iffland hielt fest: »Dies war ein Tag des Ruhms für Mme Brandes« (Dramatische Werke, Leipzig 1798, S. 104).
Die Häufigkeit der Aufführungen demonstriert den großen Erfolg von Ariadne aus Naxos. Allein in Gotha war Ariadne zwischen 1775 und 1779 17 Mal zum hören. Weitere 36 Vorstellungen kam in Berlin dazu, die so gut besucht waren, dass das Melodram in das größere Monbijoutheater verlegt werden musste, wo 49 zusätzliche Wiederholungen folgten. Ariadne auf Naxos wurde eine Inspiration für andere Komponisten und veränderte den Umgang mit der Konzeption von Rezitativen. Aber es wurde auch Kritik laut. In seinen Sämtlichen Schriften schilderte Brandes rückblickend die kontroverse ästhetische Debatte, die Benda und er mit Ariadne auf Naxos losgetreten hatten:
Bey allem Beyfall, den dieß Stück, sogleich bey seiner ersten Erscheinung, erhielt, fand es auch strenge Tadler. Sie nannten einen mit Musik verwebten prosaischen Text, der nicht gesungen sondern gesprochen wurde, Unsinn – und sie hatten, wie ich weiter unten bemerken werde, gewissermaßen Recht. Andre behaupteten das Gegentheil, glaubten daß der Ausdruck der Empfindungen und Leidenschaften durch diese musikalischen Zwischensätze mehr Leben und Kraft gewänne. Man stritt und kämpfte, sprach und schrieb so lange für und wider die Sache, bis man endlich darin übereinkam, ein Melodrama wäre zwar Unsinn, aber ein sehenswürdiger anziehender Unsinn, der trotz aller Kritik auf der Bühne eine große Wirkung hervorbrächte […].
Diese »große Wirkung« wollte Brandes dann auch nicht für sich allein reklamieren, sondern war sich sowohl seiner Vorbilder als auch der essenziellen Rolle von Bendas Musik am Erfolg der Ariadne bewusst:
Den durch dieß Stück erworbenen Beyfall muß ich billig mit meinem alten Freunde Benda theilen; auch fordert die Wahrheit das Geständniß, daß ich mir nicht die Ehre der Erfindung dieser neuen Gattung von Dramen zueignen kann; diese gehört eigentlich dem berühmten Rousseau, der schon einige Zeit zuvor seinen Pygmalion, das erste Stück dieser Art, schrieb […]. Nur bin ich der Erste unter den deutschen Dichtern, welcher es wagte, diese Gattung Schauspiele auf die vaterländische Bühne zu bringen.
Michaela Bieglerová
„Furcht und Freude, Leben und Entsetzen“: Die Geburtsstunde des Melodrams in deutscher Sprache
Anlässlich der Aufführung des Melodrams “Ariadne auf Naxos” von Johann Christian Brandes und Georg Anton Benda an der HMT Leipzig im April 2013 entstand dieser Programmhefttext von Felicitas Freieck.
Die Rezeptionsgeschichte antiker Dramen in der Musik ist lang – und wenn der Mythos von Ariadne und Theseus auch nicht am Anfang des modernen Musiktheaters stand, so repräsentiert er doch einen ersten Meilenstein in seinem weiteren Werdegang: Bereits im Jahre 1608 nämlich vertonte Claudio Monteverdi den Stoff in seinem Werk L’Arianna und bestätigte damit endgültig das dramaturgische Potenzial der Oper als Theatergenre. Ende des 18. Jahrhunderts dann nahm sich die Weimarer Schauspieltruppe von Abel Seyler des antiken Mythos wieder einmal an und setzte einen weiteren Meilenstein, indem sie mit Ariadne auf Naxos das Fundament für die Entwicklung und Verbreitung einer im deutschsprachigen Raum neu aufkommenden Gattung legte. Der Gothaer Hofkapellmeister Georg Anton Benda, welcher nach einigen Verwicklungen mit der musikalischen Ausgestaltung dieses Melodrams beauftragt war, unterlegte die Textvorlage von Johann Christian Brandes so mit Musik, dass die Rezitation der Akteure einerseits immer wieder den bildhaften, tonmalerischen Einwürfen des Orchesters zu weichen hatte, andererseits mit charakterisierender Musik unterstützt wurde:
Dieses Prinzip von minutiös aufeinander abgestimmten reduzierten, plötzlich abbrechenden musikalischen Gesten und deklamiertem Text setzte einen komplett neuen ästhetischen Anspruch voraus, welcher nicht nur auf kompositorischer, sondern besonders auf dramaturgischer Ebene den Maßstab des Musiktheaters um einiges höher legte als bisher. Die Spannweite des subjektiven Gefühlsausdrucks umfasste zudem neben dem »Schönen und Erhabenen« nun auch das »Schreckliche und Grauenerregende« als der ästhetischen Gestaltung angemessenem Parameter – ganz im Sinne der nur wenige Jahre zuvor von Gotthold Ephraim Lessing verfassten Hamburgischen Dramaturgie, welche sich auf Aristoteles berief und das »Mitleiden« des Publikums als wesentlichste Wirkung eines Theaterstücks auf den Zuschauer deklarierte. Ariadnes Sturz in den Tod ist ein prägnanter Ausdruck dieses Topos:
Innerhalb Europas war Bendas und Brandes’ Ariadne jedoch nicht der erste Entwurf dieser Theatergattung gewesen. Bereits 1762 hatte Jean Jacques Rousseau bei der Arbeit an seinem Bühnenwerk Pygmalion an eine ähnliche Art der Vertonung gedacht und gesprochene Szenen mit musikalischen Intermezzi abwechseln lassen. Wie genau Benda damit vertraut war, ist unklar. Die Kenntnis erscheint immerhin möglich, wenn man um das große Interesse des Gothaer Hofs an der französischen, in erster Linie der Pariser Kultur weiß. Brandes jedenfalls hatte von Rousseaus Experiment gehört und benannte es im Vorwort einer späteren Ausgabe seines Librettos als einen Vorläufer des eigenen Textes.
Die Uraufführung der Ariadne fand in Gotha unter Beteiligung der gesamten Hofkapelle statt und wurde sowohl für die (ungewöhnlicherweise) weibliche Hauptdarstellerin als auch für Benda ein triumphaler Erfolg. Bei Schwickert in Leipzig erschien das Werk im Druck, nach einigen Jahren »zum Gebrauche gesellschaftlicher Theater« auch in einer Bearbeitung mit solistischer Streichquartettbegleitung und bezeichnenderweise mit alternativer französischer Textfassung. 
In den Bestandskatalogen von Breitkopf wurde mehrere Jahre vorher bereits die Partitur und ein Klavierauszug angezeigt. Ariadne auf Naxos konnte damit überall studiert und aufgeführt werden. Bedenkt man, in welchem Ausmaß das Werk bisherige Normen des deutschen Musiktheaters sprengte, ist dies keinesfalls als selbstverständlich anzusehen. Die Kritik fiel dennoch weitgehend positiv aus. So beurteilte Johann Nikolaus Forkel die neuartige Symbiose von Musik und Dialog im Gegensatz zum bisher Gewohnten als weitaus »begreiflicher und faßlicher«, während im Gothaer Theaterjournal gar von »Bewunderung und Ehrfurcht« für Bendas und Brandes’ Melodram die Rede war. Ähnlich euphorisch gab sich der Musikalische Almanach auf das Jahr 1772: »Eine so echt genialische Musik war in den Mauern unserer deutschen Schauspielhäuser noch nicht erschollen. Wem ist nicht beim Anhören der Ariadne Furcht und Freude, Leben und Entsetzen angekommen? Herr Benda brachte uns die neue Kunst des Melodramas, worinnen nicht gesungen wird, wo aber das Orchester gleichsam beständig den Pinsel in der Hand hält, diejenigen Empfindungen auszumalen, welche die Deklamation des Akteurs beseelen.«
Dass selbst eine schöpferische Koryphäe wie Wolfgang Amadé Mozart mehrmals seine Bewunderung für die neuartigen Kompositionstechniken Bendas aussprach, lässt erkennen, welchen Eindruck die Neuerungen hinterlassen hatten. In einem Brief vom 12. November 1778 schreibt er: »In der That, mich hat noch niemals etwas so surprenirt! Denn ich bildete mir immer ein, so was würde keinen Effect machen«. Er habe die Ariadne jedoch »mit dem größten Vergnügen aufführen gesehen«.
Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus erwies sich die Adaption als attraktiv – so sehr, dass die bereits genannten Fassungen mit geringerer Instrumentierung für den »Gebrauch gesellschaftlicher Theater« eingerichtet wurden und es in den Folgejahren eine Reihe weiterer Melodram-Neukompositionen gab. Teilweise versuchte man, die Melodramtechnik in Opern umzusetzen, um den statischen, wenig dramatischen Charakter der Arie aufzulockern (z. B. bei Mozart und Carl Maria von Weber). Ariadnes Tod erwies sich für das Musiktheater um 1800 also als ein temporärer Neuanfang…
Felicitas Freieck
Franz Brendel: „Das Kunstwerk der Zukunft“ (1853) – Teil 6
1853, nach den ersten kritischen Anmerkungen von Joachim Raff zum Konzept des Gesamtkunstwerks, veröffentlichte Franz Brendel in der „Neuen Zeitschrift für Musik“ eine Artikelserie „Die bisherige Sonderkunst und das Kunstwerk der Zukunft“. Diese erste Erläuterung von Wagners Ideen erweiterte er kurz darauf zu einem eigenen Buch. Der Text gibt einen Eindruck in die Anfangszeit der kritischen Wagner-Diskussion in der musikalischen Fachpresse der 1850er Jahre. – Die Transkription erfolgte im Rahmen eines Hauptseminars an der HMT Leipzig von Eva-Maria Meinhardt.
Franz Brendel: Die bisherige Sonderkunst und das Kunstwerk der Zukunft
[Teil 6: NZfM 28, Nr. 13, 25. März 1853. Transkription: Eva-Maria Meinhardt]
[133] Zum Schluss jetzt noch eine kurze Betrachtung über den von J. Raff weiter angeregten Einwand, daß sich Wagner „in der Sackgasse eines fast localen Deutschthumes zu verrennen drohe.“
Ich nehme diese Erörterung auf, weil durch Raff’s Bedenken eine äußere Veranlassung gegeben ist, muß jedoch gleich beim Beginn derselben bemerken, daß sie streng genommen ziemlich weit abliegt von dem, was uns gegenwärtig beschäftigt. Wir haben noch so viel mit der Erkenntniß des von Wagner aufgestellten zu thun, wir stehen noch so sehr am Anfange des in Folge davon eingetretenen Umschwunges, daß die Frage nach einer möglichen Einseitigkeit mir eine sehr verfrühte zu sein scheint. Das was zunächst erstrebt werden mußte, war die Anerkennung des neuen Princips im Allgemeinen, das Zweite ist die Erlangung eines ausgedehnteren, tieferen Verständnisses des Gegebenen durch die näher eingehende Debatte, zu der wir uns jetzt wenden, und erst in viel weiterer Zukunft dürfte eine erschöpfende Behandlung von Fragen, wie die oben angeregte am Ort sein. Weil indeß Veranlassung gegeben ist, so sei diese Betrachtung aufgenommen, obschon, wie gesagt, eine Erledigung nicht drängt. Ich hoffe auch hier Anregung für eine umfassendere Orientierung geben zu können.
Betrachten wir die Entwicklung Deutschlands, so sehen wir, wie dieselbe im Laufe seiner ganzen Geschichte von den tiefsten Spaltungen, den schroffsten Gegensätzen durchschnitten ist. Selbst das Christenthum trat als eine fremde Macht dem ursprünglich deutschen Wesen gegenüber, und fort und fort ist der Widerstreit beider Seiten zu Tage gekommen. So haben ferner auf deutschem Boden alle anderen Volksgeister Raum gefunden, sowohl die schon vom geschichtlichen Schauplatz abgetrennten, als auch die unmittelbar noch lebendiger Wirklichkeit angehörigen, und diesen universellen Bestrebungen gegenüber, diesen Versuchen das Fremde mit dem Eigenen zu verschmelzen ist dann wieder eine energischere Concentration auf das eigenthümliche, nationale Wesen gegenüber getreten. Bei der gegenwärtigen Erörterung ist es zunächst der Gegensatz des Nationalen und Antiken, welcher uns interessiert, und ich komme damit auf das gleich im Eingange dieses Aufsatzes erwähnte Thema zurück. Seit dem Wiedererwachen der Wissenschaften beim Beginn der modernen Zeitepoche bis herab auf die neueste Zeit erblicken wir den Kampf dieser wider[134]streitenden Richtungen, der auf künstlerischem Gebiet seinen Culminationspunkt in neuerer Zeit in der romantischen Dichterschule einerseits, in Schiller, bei weitem mehr noch in Göthe anderseits erreichte.
Von Haus aus und in seiner ganzen ersten Epoche huldigte Göthe einer deutsch nationalen Richtung; in ihm gerade erwachte dieselbe mit erneuter Kraft und Frische. Später aber, seit seinem Aufenthalt in Italien, ist das antike, das objective, plastische Element mehr und mehr bei ihm in den Vordergrund getreten. Er hat zwar auch dann noch im tiefsten Grunde seine deutsche Individualität bewahrt, aber er ist doch aus seiner bisherigen Welt herausgegangen, zur Hälfte auf die alte, griechische sich stützend. Er hat auf diese Weise eine Verschmelzung beider Seiten erreicht, der zu Folge jede Etwas von ihrem eigenthümlichen Wesen aufgeben mußte, er hat nicht das Deutsch-Nationale erfüllt durch das Antike, so daß dieß völlig aufgezehrt, in unser Wesen aufgenommen, in Fleisch und Blut verwandelt uns erschiene, daß es aufgehört hätte ein Fremdes zu sein, und aus unserer Entwicklung selbstständig erzeugt uns entgegenträte, er hat beide Seiten als gleich berechtigt nur erst verschmolzen, und das Deutsche eben so sehr mit nach Griechenland hinüber genommen. Dieser Wendung gegenüber bewegte sich die romantische Schule ausschließlich auf deutschem Boden, sie vertrat das Nationale im engeren Sinne, und dieß nicht blos im unmittelbaren Kunstschaffen, sondern auch theoretisch. Es ist namentlich L. Tieck gewesen, welcher in den vortrefflichen Einleitungen zu seinen Ausgaben der Dichter der Sturm- und Drang-Periode und der romantischen Schule den Gegensatz scharf und treffend hervorgehoben, welcher geradezu ausgesprochen hat, daß Göthe’s antike Richtung eine verfehlte gewesen sei. Die romantische Dichterschule zählt die begabtesten, reichsten Dichtertalente Deutschlands – Göthe hier natürlich ausgenommen – zu ihren Anhängern, aber sie hat es nicht über ein sehr beschränktes, einseitig aufgefaßtes Deutschthum hinausgebracht, sie hat dasselbe nicht auf der Höhe eines nationalen Standpunktes gefunden, im Gegentheil in einem particularistischen Abschließen. Sie besaß zugleich mehr nur eine literarisch vermittelte, künstliche Existenz, ohne bis zum Kern der Nation vordringen zu können. Diese Stellung hatte eine gewisse Krankhaftigkeit zur Folge, es fehlte zum Theil an wirklich substantiellem Inhalt, an Ernst und Charakter. Phantasterei und Willkühr, Caprice und Laune waren die Mächte, denen man huldigte, die Wirklichkeit wurde übersprungen, und so vermochten diese Dichter auch zu keinem wahrhaften Verhältniß zum Theater zu kommen.
Wir erblicken dem zu Folge auf dem Gebiet der modernen Poesie zur Zeit zwei wesentlich berechtigte Gegensätze, die sich wechselseitig ausschließen, ohne eine Versöhnung erreichen zu können. Es hat bis jetzt bei diesen Gegensätzen sein Bewenden gehabt, und die Frage ist als eine schwebende in die neueste Zeit mit herüber genommen worden. Bis auf die Gegenwart herab sind Zweifel geblieben, ob die Göthe’sche Wendung die einzige berechtigte, auch in Zukunft zu verfolgende war, oder ob von der weiteren Ausbildung der romantischen Richtung das fernere Gedeihen abhängen werde.
Nur die Tonkunst vermag bei dieser Ungewißheit uns eine befriedigende Antwort zu geben, und es ist das Gebiet derselben zu betreten, wenn wir zu wirklicher Erkenntniß unserer Entwicklung gelangen wollen. Möge dieß zugleich – beiläufig erwähnt – ein erneuter Beweis sein, wie nur aus einer viel innigeren Durchdringung der bisher getrennten Seiten, aus zusammenfassender Betrachtung, ein tieferes Verständniß hervorgehen kann. Die Musik war es, welche in höherer Weise erreicht hat, was in der romantischen Schule nur angestrebt wurde. Beethoven ist dieser durchaus deutsche Künstler, der frei von krankhafter Phantasterei, durchdrungen von dem tiefsten Ernst, das deutsche Wesen allseitig und in seinem ganzen Reichthum zur Darstellung bringt. Aber die Lösung des Gegensatzes war hier, bei aller Größe, doch nur eine einseitige, wie dieß ja der Musik nicht anders möglich, eine einseitige nämlich in dem Sinne, daß nur das Nationale, wenn auch in höchster Potenz, zur Erscheinung gekommen ist, nicht zugleich die andere von der antiken Welt beeinflußte Seite. Das romantische Princip allein fand hier seinen Culminationspunkt. Jetzt indeß hat die Tonkunst auch die gegenüberstehende Richtung in sich aufgenommen, und die allseitige Lösung erreicht. Was ihr allein unmöglich war, was auf dem Gebiet der Poesie nur erst in Gegensätzen zur Erscheinung kam, ist durch das Kunstwerk der Zukunft zum Abschluß gelangt, ist durch Wagner’s Schöpfungen angebahnt. Es ist hier wieder das Deutsch-Nationale, wie bei den Romantikern und in höherer Weise bei Beethoven, es ist der Ernst, die Macht der Gesinnung, wie bei dem Letzteren, zugleich aber ist in dem Kunstwerk der Zukunft die antike Welt zur vollsten Geltung, zu wahrhaft dem modernen Geiste entsprechender Wiedergeburt gelangt. Es ist nicht blos der Anschluß an Griechenland überhaupt, der Umstand, daß Wagner von demselben seinen Ausgang nimmt, es ist zugleich der Drang nach voller Wirklichkeit, der sich in seiner ganzen Richtung ausspricht, es ist die Vereinigung einer nur im Gedanken existirenden Kunst, es ist die Verneinung einer blos literarischen Existenz derselben, es ist die [135] Bevorzugung des Dramatischen, überhaupt die gesammte Weltanschauung, welche dieß bestätigt. So ist zur Einheit gelangt, was für unsere Dichter nur getrennt existirte, es ist zugleich Beethoven aufgenommen, und eine Durchdringung des Nationalen mit dem Antiken erreicht, welche auf dem Göthe’schen Standpunkt noch eine Unmöglichkeit war. Hier ist das Fremde nicht mehr als Fremdes vorhanden, es ist innerlichst angeeignet es ist ein durch den antiken Geist gehobenes, durch ihn wahrhaft erfülltes, und gesättigtes Deutschthum, es ist die Lösung des Göthe-Tieck’schen Streites gegeben, der einzig richtige Weg für die weitere Kunstentwicklung betreten. Deßhalb ist Wagner auch in dieser Beziehung für die Poesie der Gegenwart von größter Bedeutung, er ist auch für diese die epochemachende, bahnbrechende Erscheinung. Der jetzt betretene ist der einer künftigen Entwicklung überhaupt vorgezeichnete Weg, denn auch das Leben der Zukunft hat die Aufgabe, sich mit dem antiken Geist mehr zu durchdringen und zu sättigen, als bisher der Fall war, so aber daß das Fremde nicht mehr als Fremdes, als blos Angeeignetes, wieder Aufgenommenes erscheint, im Gegentheil als selbstständig Erzeugtes.
Ich erachte deshalb den oben angedeuteten Einwand eines einseitigen Deutschthums nach dieser Seite hin für erledigt. Wohl haben wir eine Verklärung, eine wahrhafte Auferstehung des deutschen Wesens vor uns, nicht aber in einem tadelnswerthen, beschränkten Sinne, im Gegentheil, in der umfassendsten, höchsten Weise, die es bis jetzt gegeben hat.
Es ist jedoch durch das jetzt Gesagte der ausgesprochene Tadel noch nicht allseitig entkräftet. Eine zweite Frage ist für unsere Betrachtung noch übrig; die Stellung der Wagner’schen Kunst zu den übrigen europäischen Nationen, die mit uns zum Theil Hand in Hand gegangen sind. Erst wenn es uns gelingt, auch nach dieser Seite alle Bedenken zu entfernen, kann unser Ziel als erreicht betrachtet werden. Mag es sein, wird der Gegner sagen, daß die Wagner’schen Kunstwerke in Bezug auf die Stellung zum Alterthum alle Probleme gelöst haben; gegen die anderen Nationen verhalten sich dieselben exclusiv. Schon die Wahl der Stoffe beweist dieß unwiderleglich.
Hierauf antworte ich:
Es ist die nächste Aufgabe des deutschen Volkes, endlich sich als Nation zu erfassen, nach Jahrhunderte langem Hin- und Herschwanken bis zu dem innersten Mittelpunkt des nationalen Bewußtseins vorzudringen. Diese Aufgabe hat sich in neuester Zeit in allen Bestrebungen geltend gemacht, auch in den politischen Bewegungen der verflossenen Jahre. Wir gelangen spät erst auf einen Standpunkt, welchen die übrigen europäischen Nationen von Haus aus und ununterbrochen eingenommen haben. Es ist jedoch die weltgeschichtliche Bestimmung Deutschlands gewesen, den verschiedensten geistigen Bestrebungen in seiner Entwicklung Raum zu gewähren, und aus diesem Grunde ist diese beim ersten Blick nahe liegende Aufgabe immer zurückgehalten worden. Jetzt steht dieselbe im Vordergrund, und es ist nicht eher weiter zu gelangen, als bis sie gelöst ist. Wenn daher Wagner gerade diese altdeutschen Stoffe für seine Kunstwerke wählte, so beweist er damit, daß er die Aufgabe der Zeit, mehr wie jeder Andere, ergriffen hat. Es ist eines seiner größten Verdienste, diesen Weg betreten, Das erreicht zu haben, was schon seit Jahren als die nächst nothwendige That von Vielen erkannt worden ist; – ich erinnere beispielsweise an die Erörterungen über „die Nibelungen als Oper“ in dies. Bl. – Was in den ältesten Zeiten unseres Volkes instinctartig hervortrat, ist jetzt mit Bewußtsein zu erfassen, und wieder zu geben. Der Kreislauf der Entwicklung schließt sich auf diese Weise, und wir kehren zurück zu unserem Ausgangspunkt, um jetzt, vor allem weiteren Vordringen, diesen als sicheres Fundament bewahren zu können.
Erscheint nun hierdurch die Wahl der Wagnerschen Stoffe gerechtfertigt, so ist damit der Vorwurf der Exclusivität immer noch nicht beseitigt. Wir sind einen Schritt vorwärts gekommen, die entscheidende Antwort aber fehlt.
Diese ist folgende:
Es ist die Aufgabe, auf diesen Standpunkt nationeller Ausschließlichkeit fest zu beharren, hartnäckig jetzt daran fest zu halten. Die Bestimmung der Zukunft ist eine Verschmelzung der Völker, wie dies jetzt schon aller Orten in unzweifelhaften Erscheinungen erkennbar wird. Die nationelle Einseitigkeit verliert deshalb ihre hervorstechende Bedeutung, und vermag künftig nur noch als individuelle Färbung sich geltend zu machen. Deutschlands Aufgabe ferner besteht nicht blos darin, die antike Welt sich innerlichst anzueignen, es ist zugleich seine Mission, auch die modernen Volksgeister in sich aufzunehmen, sich durch sie zu ergänzen. Der eben bezeichnete nationelle Standpunkt ist daher auch jetzt nur ein Durchgangspunkt. Früher bewegte sich die Entwicklung in den extremsten Schwankungen, mit völliger Verleugnung häufig aller Nationalität. Jetzt ist diese der Grund und Boden, auf dem sich ein neues Weltreich, eine höhere Universalität erhebt.
Was daher die Wagner’schen Kunstwerke betrifft, so ist zu unterscheiden zwischen diesen Stoffen und der Behandlungsweise derselben. Diese Stoffe gehören [136] der gegenwärtigen Entwicklungsstufe, dieser nationellen Wendung an. Wagner hat darin das zunächst Nothwendige gegeben, das gegenwärtige Ideal ergriffen. In der Behandlungsweise aber hat er einen viel größeren Spielraum eröffnet, und zwar in einem weit universelleren Sinne. Das Kunstwerk der Zukunft ist ja durchaus nicht an derartige Stoffe ausschließlich gebunden, eben so wenig als die Wagner’sche Individualität allein für dasselbe Maaß gebend ist. Das Kunstwerk der Zukunft trägt in sich die Fähigkeit, den verschiedensten Individualitäten und Nationalitäten zum Ausdruck zu dienen, und diese erste Erscheinungsform in den Wagner’schen Werken ist darum nicht als die einzige zu betrachten, nicht zu verwechseln mit Dem, was die Zukunft selbstständig und abweichend schaffen kann.
So hat Wagner im Allgemeinen theoretisch Bahn gebrochen, indem er durch das Kunstwerk der Zukunft aller künstlerischen Productivität einen Schauplatz unerschöpflicher reichster Thätigkeit eröffnet hat. Praktisch, im unmittelbaren Kunstschaffen, hat er den ersten Schritt zur Verwirklichung hin gethan. Er ist der Mann der Zeit, was seine Stoffe betrifft, aber es werden weiterhin Epochen kommen, wo andere Stoffe diese verdrängen. Bezüglich der künstlerischen Behandlung dieser Stoffe aber, so hat Wagner den Weg gezeigt und betreten, auf dem fortan weiter zu schreiten ist. Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß diese Behandlungsweise eine feste Norm sei, von der nicht abgewichen werden dürfe. Andere Stoffe werden auch, obschon immer unter Anerkennung der wesentlichen Voraussetzungen, eine veränderte Behandlungsweise erleiden. Somit erledigt sich, wie ich glaube, Raff’s Einwand zu allseitiger Zufriedenheit. Es ist richtig, – auch Uhlig hat dies ausgesprochen, – daß Tannhäuser und Lohengrin z. B. in Paris kein Glück machen würden, und in so weit ist Raff’s Einwand treffend. Dies kann jedoch zunächst auch gar nicht die Absicht sein. Erst müssen wir mit uns selbst fertig werden, bevor wir an Weiteres denken können. Das wahre Weltbürgerthum besteht nicht in charakterlosem Hin- und Herschwanken, wie es die deutsche Geschichte bis jetzt so oft gezeigt hat, es erhebt sich allein auf der Grundlage des nationalen Bewußtseins. Dies ist, was im tiefsten Grunde fest und sicher vorhanden sein muß, ehe die wahrhafte Universalität erreicht werden kann. So ist Wagner’s Kunst jetzt eine nationale, dem Kunstwerk der Zukunft aber, was durch jene vorbereitet wird, wohnt eine Universalität bei, die gerade es, meiner Ansicht nach, vorzugsweise in den Stand setzt, alle Nationen um sich zu versammeln, eine Weltkunst hervorzurufen.
Das Nächste war, daß das Verhältnis der Sonderkunst zum Gesammtkunstwerk zur Sprache gebracht werde. Es ist dies Verhältniß zur Zeit so sehr der Gegenstand abweichender Ansichten und Zweifel, daß man kaum mit Jemand über die neue Richtung sprechen kann, ohne daß Widerspruch nicht auch sogleich hervorträte. Erst nach erfolgter Feststellung dieses Verhältnisses ist es möglich das Nähere über die Art und Weise der Vereinigung zur Sprache zu bringen. Deßhalb fordere ich zunächst zum Austausch der Ansichten über diesen Gegenstand auf. Habe ich, indem ich darlegte, wie ich die Sache zur Zeit verstehe, auch nur erreicht, Andere zu weiterer Erörterung angeregt zu haben, so glaube ich, daß damit schon ein Schritt vorwärts gethan ist.
Franz Brendel: „Das Kunstwerk der Zukunft“ (1853) – Teil 5
1853, nach den ersten kritischen Anmerkungen von Joachim Raff zum Konzept des Gesamtkunstwerks, veröffentlichte Franz Brendel in der „Neuen Zeitschrift für Musik“ eine Artikelserie „Die bisherige Sonderkunst und das Kunstwerk der Zukunft“. Diese erste Erläuterung von Wagners Ideen erweiterte er kurz darauf zu einem eigenen Buch. Der Text gibt einen Eindruck in die Anfangszeit der kritischen Wagner-Diskussion in der musikalischen Fachpresse der 1850er Jahre. – Die Transkription erfolgte im Rahmen eines Hauptseminars an der HMT Leipzig von Eva-Maria Meinhardt.
Franz Brendel: Die bisherige Sonderkunst und das Kunstwerk der Zukunft
[Teil 5: NZfM 28, Nr. 12, 18. März 1853. Transkription: Eva-Maria Meinhardt]
[121] Die Untersuchung ist bis zu dem Punkt vorgeschritten, wo die Hauptfrage, ob die einzelnen Künste in Zukunft ihre Existenz allein in dem Gesammtkunstwerk haben werden, oder ob ihnen ein gesondertes Bestehen auch dann noch gesichert bleibt, genauer in Betracht gezogen werden kann.
Wenn ich bei der Beantwortung dieser Frage in Einigem von Wagner abweiche, so glaube ich doch, daß die Differenz mehr nur in der Fassung, in der ersten Darstellung, welche er der Sache gegeben hat, nicht oder weniger im Gedanken selbst beruht, und bin der Meinung eine Ansicht aufzustellen, welche die Möglichkeit in sich trägt, die verschiedenen jetzt noch auseinandergehenden Auffassungen – wenigstens in so weit, als dieselben in der Hauptsache unserer Richtung angehören – in sich zu einigen.
Möge sich indeß das Endergebniß gestalten, wie es wolle; mein Zweck ist erreicht, sobald es mir gelingt, wie schon wiederholt bemerkt, die Debatte anzuregen, wenn ich zu näherem Ideenaustausch die Veranlassung gebe. Ein solcher Ideenaustausch ist jetzt nothwendig, er ist die Bedingung des Weiterschreitens. Wir müssen ehrlich und offen mit der Sprache herausgehen, wir müssen uns entgegen kommen, und wenn nöthig unsere Irrthümer willig eingestehen, und Belehrung wechselseitig annehmen. Wir brauchen, indem wir die Idee des Kunstwerks der Zukunft näher zu erfassen bemüht sind, eine Gesinnung, ähnlich der, welche dieß selbst zu seiner Verwirklichung voraussetzt. Auf diese Weise wird zugleich die wahre und zur Zeit noch berechtigte Opposition von uns anerkannt und aufgenommen. Ein solcher freier Austausch der Ansicht ist überhaupt das, was ich von meinem Standpunkt aus für das Ersprießlichste halte; dieselbe Freiheit des Verhaltens charakterisirt meine Stellung, Wagner gegenüber. Wie sehr ich von der Bedeutung desselben durchdrungen bin, wissen die Leser dies. Bl.; in Folge dieses Umstandes allein aber würde ich keinen einzigen seiner Sätze unterschreiben. Am sclavischen Aufnehmen kann in Zukunft nichts mehr gelegen sein, unser Princip fordert selbstständige Ueberzeugung. So sind wir Alle weit entfernt, zu fordern, daß Jemand Alles auf Treu und Glauben annehme, das aber können wir verlangen, daß man sich möglichst unterrichte, daß man nicht die unreifsten Einfälle bei mangelhaftester Ein[122]sicht in die Welt hinausschreibe, und damit glaube, Etwas gegen uns bewiesen zu haben. Gegen solches Verfahren ist, wie bisher, Partei zu ergreifen. Gegen Mißverstand, der sich nicht die Mühe nimmt, sich zu unterrichten, und doch redet, der nur Schiefes, Halbwahres oder Trivialitäten vorbringt, und damit etwas gesagt zu haben glaubt, wie es z. B. der Wohlbekannte, Fr. Wieck [Anm.: Fr. Wieck hat das voraus, daß er ehrlich seinen Namen nennt, während so viele Andere aus dem Versteck ihrer Anonymität heraus kämpfen.], der Musikreferent der Grenzboten, u. A. thun, gegen Böswilligkeit, die von Coteriewesen spricht, wo Niemand daran denkt, wie es dem Concertreferent der Signale beliebt hat, ist zu kämpfen, und so lange dieß dauert, ist Polemik ein nothwendiges Uebel.
Dieß beiläufig.
Ich beantworte die an die Spitze gestellte Frage mit Ja, ich glaube, daß den einzelnen Künsten ein getrenntes Bestehen bewahrt werden muß.
Eine relative Selbstständigkeit der Theile liegt schon in dem Begriff des Kunstwerks der Zukunft, in dem Begriff der Einheit des Unterschiedenen überhaupt. Ohne eine solche relative Trennung der Momente würden wir in jedem reich gegliederten organischen Ganzen nur die abstracte, unterschiedslose Gleichheit, nicht eine concrete Einheit vor uns haben, nicht die Vereinigung einer Vielheit zu einem Ganzen. Ohne eine relative Selbstständigkeit der einzelnen Künste müßten diese demnach verschwinden, würden im Ganzen untergehen, eine selbstständige Geltung nicht bewahren können. Die Vereinigung der Künste in dem Gesammtkunstwerk ist eine freie, auf freier Hingebung beruhende, und es muß ihnen darum, so zu sagen, die Möglichkeit des Rücktritts, die Möglichkeit der Sonderung, offen stehen. Dieß kann indeß nur der Fall sein, wenn ihnen eine getrennte, wenn auch untergeordnete Sphäre erhalten bleibt, und so ist schon aus diesem Grunde, die Bewahrung gesonderter Eigenthümlichkeit nothwendig.
Indem ich dieß ausspreche, trete ich in Widerspruch mit allem Vorausgegangenen. Unser bisheriges Resultat war das siegreiche Hervortreten des Gesammtkunstwerkes, war die Einsicht, daß die einzelnen Künste in ihrer Sonderung zum Theil schon untergegangen sind, zum Theil, mit wenig Ausnahmen, nahe am Untergange stehen.
Jetzt behaupte ich das Entgegengesetzte.
Dieß ist aber gerade das, was wir brauchen, um zu der wichtigsten Einsicht zu gelangen, die Lösung dieses Widerspruchs führt unmittelbar zu der, meiner Ansicht nach, entscheidenden Bestimmung.
Bisher standen sich die Künste feindlich gegenüber, jede wollte das Ganze sein, jede strebte nach absoluter Geltung. Der Satz nun, daß sie in dieser Stellung dem Untergange verfallen sind, bleibt auch jetzt unerschüttert, und unser bisheriges Resultat behält seine Geltung. Es ist die unzweifelhafte Bestimmung dieser Künste, im Ganzen aufzugehen. Dieses Aufgehen aber kann nicht eine völlige Vernichtung der Existenz zur Folge haben, kann nicht gleichbedeutend mit einem völligen Verschwinden sein. Vernichtung droht allein der gegenwärtigen egoistischen Sonderung, dieser feindlichen Isolirung. Eine besondere Existenz dagegen unter steter, lebendiger Beziehung zum Ganzen, so daß dieß immer als Ziel und Bestimmung alles Einzelnen hervortritt, erscheint nicht blos zulässig, erscheint sogar geboten. Das Gesammtkunstwerk ist die Hauptsache, die Vereinigung das zunächst gesteckte Ziel. Nur nach vollbrachter Einigung kann von einem weiteren Bestehen der Künste die Rede sein, nicht vorher, nicht bei ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit. Dann aber ergiebt sich auch die relative Selbstständigkeit mit Nothwendigkeit. Nach ihrer Hingebung und in Folge derselben werden die Künste ein erneutes Leben für sich zurückerhalten, werden dieselben in ihrer Einzelexistenz frisch und gehoben durch neue Aufgaben hervortreten. Nur dann aber kann, wie gesagt, auch erst von einem getrennten Bestehen die Rede sein; ohne die jetzt gebotene Hingebung an das Ganze sind die getrennten Künste nichts. Die spätere Einzelexistenz ist deßhalb auch nicht mit der gegenwärtigen zu vergleichen; sie ist nur in steter, lebendiger Beziehung zum Ganzen zu denken, sie ist etwas Untergeordnetes dem Alles überstrahlenden Gesammtkunstwerk gegenüber, und dem entsprechend muß auch die bisherige breite Ausdehnung der einzelnen Künste verschwinden. – Um den hier bezeichneten Unterschied festzustellen, gebrauche ich folgende Bezeichnungen: die in unzulässiger Weise bisher getrennte Kunst nenne ich Sonderkunst, jene dagegen, welche in dem Ganzen wurzelt, und nur eine relative Selbstständigkeit behauptet, die Kunst der Zukunft, bezeichne ich mit dem Ausdruck Einzelkunst.
Wir haben hier die aus dem Begriff der Sache sich ergebenden Folgerungen. Aber noch andere Gründe sprechen für die bezeichnete Einzelexistenz.
Die Künste erhalten neue Belebung durch das Gesammtkunstwerk, sie erhalten neue Aufgaben, sie erfahren Steigerungen, welche ihnen bisher unbekannt waren; um aber neue Erfindungen in ihrer besonderen Sphäre machen zu können, specifische Erweiterungen, [123] die dann ebenfalls den Zwecken des Gesammtkunstwerkes zu Gute kommen, muß der Künstler sich zugleich auf sein Privatgebiet abschließen können. Auch die innere Energie, die Fähigkeit entsprechendsten Ausdrucks in dem besonderen Material würde leiden, wenn der Künstler nicht in selbstständiger Weise zur Darstellung besonderer Aufgaben von den Mitteln seiner Kunst Gebrauch machen könnte. Ich fürchte ferner, daß die schon erworbene Technik ohne eine solche Einzelexistenz leiden, ich bin der Ansicht, daß die errungene Virtuosität bald verloren gehen würde, wenn z. B. der Bildhauer aufhören müßte in Stein nachzubilden, oder der Maler den menschlichen Körper in der bisherigen Weise zu studiren, was für die Zwecke einer theatralischen Verwendung seiner Kunst an lebendigen Menschen kaum nöthig sein dürfte. Nur der Starke ist der wahren Hingebung fähig und Selbstständigkeit die Voraussetzung einer solchen; diese Letztere aber scheint mir ohne die Einzelexistenz der Künste nicht genug gewahrt.
Endlich und hauptsächlich spricht auch der Umstand für eine Trennung, daß nicht alle Aufgaben der Einzelkunst im Gesammtkunstwerk ihre erschöpfende Darstellung finden können, daß auch später noch gesonderte Aufgaben übrig bleiben.
Betrachten wir, um dieß uns zum Bewußtsein zu bringen, die Thätigkeit der einzelnen Künste nach geschehener Vereinigung.
Die Baukunst kommt am wenigsten in Frage. Sie hat als Dienerin des Ganzen im Theater der Zukunft zugleich eine volle, selbstständige Existenz wie bisher. Hier erscheint daher ohne Weiteres das Problem gelöst.
Skulptur und Malerei zeigten sich, meiner Darstellung zufolge und unbeschadet der hohen und herrlichen Verwendung, die ihnen bevorsteht, im Kunstwerk der Zukunft am meisten zurückgesetzt, in ihrer Technik eigentlich vernichtet, und eine Einzelexistenz mit besonderen Aufgaben muß deßhalb für sie vorzugsweise wünschenswerth erscheinen. Entsprechend dieser Bestimmung erblicke ich auch weiterhin für die Landschaftsmalerei die Möglichkeit einer eben so regen Thätigkeit wie bisher. Vieles dürfte der Bühne nicht zugänglich oder nicht brauchbar für dieselbe sein, was doch die trefflichste künstlerische Aufgabe genannt werden müßte. Anderseits könnte der Reichthum des landschaftlichen Hintergrundes, den das Theater zur Darstellung bringen wird, Veranlassung zu besonderer Fixirung im Bilde geben. Die Historienmalerei aber, wie überhaupt die gesammte bildende Kunst hat Aufgaben, welche auf der Bühne und am lebendigen menschlichen Körper gar nicht zur Verwirklichung kommen können. Es ist dieß das in der Erscheinung nicht vorhandene Ideal, welches die Skulptur in der gesammten Beschaffenheit des Körpers, die Malerei im Ausdruck des Gesichts und des Auges darstellt. Die griechischen Götter sind keine Menschen, ebenso wie die Madonnen- und Christusbilder weit über das Menschliche hinausgehen. Ganz in derselben Weise, wie bisher, bietet sich daher für die Malerei neben ihrer Existenz im Gesammtkunstwerk das Ideal des Menschen der Zukunft als besonderes Object. Eine im tiefsten Grunde verschiedene Weltanschauung muß natürlich auch einen ganz anderen Gesichtsausdruck zur Folge haben, und sie wird deßhalb dieses Ideal in seiner sinnlichen Erscheinung zur Darstellung zu bringen haben. Freilich muß die Malerei – so wie dieß überhaupt von allen Künsten gilt – erst vollständig in die neue Bewegung eingetreten sein. Wenn diese Kunst gegenwärtig noch mit Gegenständen des kirchlichen Glaubens sich beschäftigt und dieß insbesondere unter dem Einfluß der Tradition,, wenn sie sich z. B. mit Christusbildern nach dem Muster früherer Auffassung abquält, so halte ich das für ein durchaus überflüssiges und erfolgloses Thun. Vom alten Standpunkt aus ist das Größte schon geleistet, die Weltanschauung der Zukunft aber ist noch nicht so fertig, so eingedrungen, um die Grundlage für ein allgemeines Kunstschaffen sein zu können. Auch Christus, um dieß beiläufig zu erwähnen, wird ein erneuter Gegenstand für die Malerei sein, sobald man ihn als Repräsentant reinen Menschenthums, als weltbeherrschendem Genius erkannt hat. Anfänge für eine solche Auffassung sind vorhanden in dem Christuskind der sixtinischen Madonna, in diesen die Fülle des objectiven Geistes, in diesen den Weltgeist selbst ausstrahlenden Augen; wie weit es aber Raphael gelungen ist, Christus, den Mann, entsprechend darzustellen, können wir, die wir das in Rom befindliche Original der „Verklärung“ nicht kennen, nicht sagen, abgesehen auch von dem Umstande, daß in diesen Bildern immer noch das Göttliche zu sehr als solches, nicht vermählt mit dem Menschlichen, nicht als identisch mit demselben, also als rein Menschliches auftritt. – Noch in anderer Beziehung können, meiner Ansicht nach, der Malerei neue Aufgaben erwachsen. Sie kann unmittelbar ihre Objecte aus dem Kunstwerk der Zukunft entnehmen, und für sich fixiren, wie dieß vorhin schon bezüglich der Landschaft angedeutet wurde. Welche Fülle der trefflichsten Bilder z. B., eine wahre Fundgrube für den Maler, bietet allein dieser einzige Tannhäuser! – Minder bin ich gegenwärtig im Stande, das Gebiet der Skulptur zu bezeichnen. Ich sehe, abgesehen von ihrer Verwendung für die Architectur, welche Wagner andeutet, zur Zeit nur die abstracte Möglichkeit einer neuen Belebung, hervorgehend aus [124] der Aufhebung des christlichen Dualismus von Leib und Seele. Tritt die bisher unterdrückte, oder einseitig bevorzugte sinnliche Seite wieder mehr ins Gleichgewicht mit der gegenüberstehenden, so scheint es, als ob auch hier eine neue Basis für diese Kunst gewonnen werden könnte. Bestimmteres jedoch hierüber anzugeben, vermag ich, wie gesagt, im Augenblick nicht.
Was die Tonkunst betrifft, so bezeichnete ich schon früher die gesammte weltliche Gesangsmusik unter gewissen Bedingungen als das Gebiet, welches vorzugsweise eine Zukunft haben werde. Diese Bedingungen beruhen insbesondere auf der, später auch schon angedeuteten, neuen Verbindung des Verses und der Melodie. Daß dieselbe nothwendig, ergiebt sich schon aus dem dort Gesagten, das Nähere aber ist Gegenstand späterer Untersuchung.
Betreten wir jetzt das Gebiet der Poesie, so sprach ich ebenfalls schon aus, daß die bisherige breite Ausdehnung des Romans und der Novelle sich beschränken würde. Die relative Berechtigung derselben behandle ich zur Zeit als offene Frage, und erlaube mir deßhalb keine Bestimmung, keine vorläufige Antwort. Von der lyrischen Poesie bemerkte ich, daß ihr auch für die Zukunft höhere Berechtigung inwohnen werde; jetzt füge ich hinzu, daß dieß, meiner Ansicht nach, insbesondere von dem gesungenen Lied gelten dürfte. Der dramatische Dichter endlich hat die hohe Bestimmung, vorzugsweise der anregende zu sein, Derjenige, von dem die wichtigsten Impulse ausgehen. So sehr auch die anderen Künstler Aufgaben stellen und die Genossen anregen können, so scheint mir doch, daß er namentlich zum Führer des künstlerischen Reigens bestimmt ist. Seine Stellung ändert sich jetzt nur in so weit, als derselbe, befreit aus seiner bisherigen ärmlichen Abgeschlossenheit, und sich hingebend an das Ganze, zugleich alle Künste zu seinem Dienst verwenden darf. Indeß auch hier bin ich der Meinung, daß dem dramatischen Dichter eine besondere Sphäre gewahrt werden muß. Es ist dieß das vorzugsweise dem Reiche des Gedankens angehörende Drama. Zwar bemerkt Wagner sehr richtig, daß alle Aufgaben, alle Stoffe, bei denen die Musik als störend erscheine, dem Geiste der Zukunft als nicht entsprechend zu betrachten seien, er verbannt z. B. jene Intrigenstücke, in denen keine Spur von Empfindung, überhaupt Alles das, was in der Lüge und Heuchelei der Gesellschaft wurzelt, er stellt die Forderung: eure Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein. Trotz alle dem aber bleibt die bezeichnete Sphäre als ein gesondertes Gebiet übrig. Es kommt hier überhaupt die Stellung des Gedankens, die Stellung der Wissenschaft zur Kunst in Frage. Irre ich nicht, so betrachtet Wagner die Kunst in Zukunft als Mittelpunkt des gesammten geistigen Daseins, und dem zu Folge auch die Wissenschaft als untergeordnet. Einer solchen Ansicht würde nun zwar für die nächste Epoche in so weit die vollste Berechtigung zuzugestehen sein, als in Wahrheit die Wissenschaft momentan zurücktritt, die bisherige große philosophische Schöpferkraft z. B. zur Zeit nicht mehr in dem früheren Grade vorhanden ist. Ganz von selbst versteht sich ferner, daß die Kunst der Zukunft eine ganz andere, würdigere Stellung besitzen muß, als die moderne Zeit der gegenwärtigen einräumt. Dem ohngeachtet aber stehen wir, was Erkenntniß betrifft, nur erst am Anfange der Entwicklung. So Gewaltiges bisher geleistet worden ist, immer resultiren daraus neue und größere Aufgaben, so daß das Ringen des Erkennens überhaupt nur mit dem Menschengeschlecht selbst aufhören wird. In der Wagner’schen Ansicht scheint mir die Kunst deßhalb doch zu sehr als das Alleinige hingestellt. Ich habe ferner noch ein mit dem Gesagten im Zusammenhange stehendes Bedenken, welches mir bei den Mittheilungen des Vorworts zu den drei Operndichtungen entstand. Wagner fand, als er sich mit Friedrich dem Rothbart als Stoff zu einem Trauerspiel beschäftigte, die Verwendung der Musik dazu als ungeeignet, erkannte aber sogleich die Nothwendigkeit derselben, als er auf den Mythos zurückging. Die Musik – dieß ergab sich hieraus als Resultat – paßt vortrefflich für rein menschliche Aeußerungen, nicht aber für Situationen, in denen der Mensch umstrickt von den Verhältnissen auftritt. Es ist aber die Bestimmung des Menschen, aus jenem Urzustand heraus- und in die Entwicklung einzutreten, es läßt sich jenes reine Menschenthum im Fortgang der Geschichte nicht behaupten; nur als ein auf höherer und bewußter Stufe wieder zu erreichendes Ziel steht es jetzt vor unseren Augen. Eine große Zahl von Stoffen muß daher nothwendig der Zeit der Entwicklung angehören, und hier ist demnach ebenfalls eine Sphäre, wo dem specifischen Drama seine besondere Berechtigung verbleibt. Einem rein menschlichen Boden entsprungene Stoffe würden vorzugsweise die für das Kunstwerk der Zukunft geeigneten sein, während das, was zwischen dem Anfang und dem Ziel der Entwicklung liegt, das Einseitigere, auch eine einseitigere Behandlung nothwendig machen müßte.
Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergiebt sich als endliche Lösung demnach die relative Berechtigung und Selbstständigkeit der Einzelkunst gegenüber dem Gesammtkunstwerk. Das Verhältniß der Ersteren zu dem Letzteren gestaltet sich dem gesammten Leben der Zukunft entsprechend. Bis jetzt hat das Princip des Egoismus die Welt beherrscht, und wir sehen demzufolge Sonderung, Vereinzelung, Spaltung. Es ist nun die unzweifelhafte Aufgabe der nächsten [125] Weltepoche, dieser Trennung und Vereinzelung gegenüber, das Aufgehen im Ganzen zur Herrschaft zu bringen. Falsch und ebenso einseitig aber müßte ich diese Wendung nennen, wenn das Berechtigte, welches den bisherigen Weltzuständen inwohnte, dabei verloren gehen sollte. Nicht ein einseitiges Umschlagen in das andere Extrem, wie einige moderne Theorien lehren, ist das, was wir brauchen, im Gegentheil kann es nur die Aufgabe sein, auf dem Grunde des bisher Errungenen das Neue zu gestalten, die individuelle Berechtigung nicht gänzlich im Allgemeinen verschwinden zu lassen, sondern eine Durchdringung beider Seiten anzustreben.
Ich habe jetzt den meiner Ansicht nach wichtigsten Gegenstand, dessen Erfassung die Grundbedingung jedes weiteren Fortschritts ist, zur Sprache gebracht, ich habe eine vorläufige Beantwortung der Frage versucht. Ob meine Bestimmungen haltbar sind, oder nicht, muß die Erörterung ergeben. Zur Zeit glaube ich, daß das Erstere, wenigstens in der Hauptsache, der Fall, ich glaube nicht unwichtige Beiträge gegeben, und eine Vereinigung der divergirenden Ansichten ermöglicht zu haben.
Blicken wir schließlich noch einmal auf die schon oben angedeutete Verwandtschaft Wagner’s mit Mozart, was die geschichtliche Stellung Beider betrifft, zurück.
Wie in Mozart die einzelnen nationalen Richtungen sich verschmolzen haben, so, bemerkte ich, vereinigen sich in Wagner die einzelnen Künste. In derselben Weise nun, wie nach Mozart die verschiedenen Richtungen wieder auseinander gingen, sich erneut verselbstständigten, so aber daß der Durchgang durch den Einigungspunkt sichtbar bleibt, werden auch später, ist die Einigung erst zu ihrem Culminationspunkt gelangt, die einzelnen Künste wieder auseinander treten, mit derselben Bestimmung, daß der Durchgang durch den Einigungspunkt sichtbar bleibt. Ich kann mir zur Zeit das Kunstwerk der Zukunft und die Berührung desselben mit der Einzelkunst nur in steter Bewegung, nur in stetem Auf- und Abwogen vorstellen, in Schwankungen, so daß wir bald ein entschiedeneres Auseinandergehen, bald wieder eine energischer Concentration auf den Mittelpunkt, das Gesammtkunstwerk, haben. So große Lebendigkeit in dem Letzteren selbst durch das abwechselnde Hervor- und Zurücktreten der einzelnen Künstler besteht, so scheint dasselbe mir doch, so lange es ohne diese Beziehung zur Einzelkunst gedacht wird, nur eine einseitigere Entwicklung zu nehmen. Auch hier würde demnach Mozart und die an ihn sich schließenden Folgen ein Analogon bilden. Trete ich aber damit scheinbar dem Gesammtkunstwerk zu nahe, scheint diese Analogie ein schlechtes Prognostikon für die gegenwärtige Wendung zu sein, weil wir bald nach Mozart erneute, schlechte Einseitigkeit, endlich gänzlichen Verfall erblicken, so erwiedere ich: die gegenwärtige Wendung ist schon unter diesem Gesichtspunkt zu begreifen. Wagner’s That ist schon eine solche erneute Concentration des Auseinanderstrebenden, sie ist, im gegenwärtigen Sinne, die erneute Mozart’s, aber auf höherer Stufe, sie ist der zunächst nothwendige große kunstgeschichtliche Wendepunkt. Wir haben schon hier und in der Zeit bis auf Mozart zurück ein solches Beispiel des Auf- und Abwogens, wie ich so eben mich ausdrückte. Zweitens aber – und dies ist die Hauptsache – ist das Gesammtkunstwerk vor einem so egoistischen Zerfallen seiner Elemente, wie wir das nach Mozart sehen, schon dadurch geschützt, daß es überhaupt die Vernichtung des Egoismus zu seiner Voraussetzung hat. Wir können unter dieser Voraussetzung ein solches Zerfallen, wie wir es nach Mozart sehen, gar nicht mehr haben.
Es ist jetzt an der Zeit auf die Ansicht J. Raff’s näher einzugehen.
Es ergiebt sich, daß ich ihm beipflichten muß, wenn er sogleich auf die Stellung der Einzelkunst zum Gesammtkunstwerk als auf die Hauptsache losgeht, wenn er hier sogleich die Frage aufgreift, in der alle Verschiedenheit der Ansicht gegenwärtig ihren Grund hat, wenn er in der bezeichneten Stellung einen nicht aufgehellten Punkt fand. Ich stimme ferner überein, wenn er die Selbstständigkeit der einzelnen Künste, hier speciell der Musik, nicht völlig aufgeben will. Der Unterschied aber ist, daß er die bisherige Sonderung festhalten zu müssen glaubt, ohne die Nothwendigkeit eines vorherigen Aufgehens im Ganzen anzuerkennen, daß er das Gesammtkunstwerk als Etwas hinstellt, was mit der specifischen Kunst gar nichts zu thun hat, daß er sonach das Zusammengehörige in bisheriger Weise einseitig sondert und fixirt. Vergleicht er weiter die Stellung der Musik, so weit sie in unserem Gesammtkunstwerk aufzugehen bestimmt ist, mit dem Verhältniß, welches sie im griechischen Drama hatte, so ist auch das im Allgemeinen jedenfalls der Wagner’schen Ansicht entsprechend, denn wir sollen Das wieder erhalten, was die Griechen in ihrem Drama besaßen, aber es paßt speciell für Musik nicht, weil diese Kunst, dort die untergeordnetste, jetzt die mächtigste ist, es paßt nicht, weil dort das plastische, bei uns das musikalische Element überwiegt. Die Musik wird im Kunstwerk der Zukunft eine unendlich größere Bedeutung erhalten, als sie im Drama der Griechen besaß. Sagt er endlich im Hinblick auf seine so eben ausgesprochene Ansicht, Wagner würde gethan haben, was Aristoteles that, wenn er sich in [126] der Lage desselben befunden hätte, so finde ich das ebenfalls richtig, aber ich fahre fort: da Wagner sich indeß nicht in der Lage des Aristoteles befindet, so muß er es aus diesem Grunde eben anders machen.
Im Gefühl sind wir wohl Alle einig; es handelt sich nur darum, diesem Gefühl die entsprechende, erschöpfende, (nicht einseitig) theoretische Fassung zu verleihen, und da gehen unsere Wege zur Zeit noch auseinander.