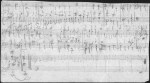Startseite » Beitrag veröffentlicht von muwileipzig (Seite 6)
Archiv des Autors: muwileipzig
Simon Leisterer: Zur Rezeption der Musik fremder Kulturen bei den Forschungsreisenden Johann Reinhold Forster und Georg Forster
Zur Rezeption der Musik fremder Kulturen bei den Forschungsreisenden Johann Reinhold Forster und Georg Forster
Der Text basiert auf einer Seminararbeit des Autors.
1. Einleitung
1.1 Zur Reiseliteratur und ihrer Popularität im 18. Jahrhundert
Schon immer gab es den Drang von Menschen, sich zu erheben[1], das Vertraute zu verlassen und Neues zu entdecken. Der Reiz des Fremden lag dabei in den unterschiedlichen Beabsichtigungen des Reisens: So kennzeichnete die Abenteuerreise, deren ältestes und berühmtestes Beispiel wohl Homers Odyssee sein dürfte, die Überwindung von Hindernissen und Herausforderungen des Fremden. Die Pilgerreisenden des Mittelalters versuchten mit heiligen Stätten und Reliquien in Kontakt zu kommen. Des Weiteren konnte das Motiv des Reisens in der Vermehrung des Wissens liegen. Seit dem 17. Jahrhundert erblühten im Zuge von Aufklärung und der langsamen Ausbildung der modernen Wissenschaften sowie der Entdeckung neuer Weltteile und der Entwicklung komfortablerer Fortbewegungsmöglichkeiten die Bildungs- und Forschungsreisen.
Und ebenso gab es immer den Drang des Menschen, die Erlebnisse und Beobachtungen weiterzugeben, z. B. über deren Verschriftlichung. So unterschiedlich die Reisen und ihre Intentionen waren, so unterschiedlich waren auch deren Formate: Es entstanden Reiseberichte, Reiseromane, Reiseskizzen, Reiseessays, Reisetagebücher, Reisenotate etc.[2] »Das frisch Gesehene wurde in den verschiedensten Stillagen notiert und verfügbar gemacht, zunächst im intimen, persönlichen Sinn, dann aber auch für die anderen, die Gruppe, die daheim Gebliebenen.«[3]
Dieser Vorstoß der Reiseliteratur in den öffentlichen Raum war eine Folge des wachsenden Interesses der Bevölkerung am Fernen und Fremden, das im England des 18. Jahrhunderts nicht zuletzt durch dessen Stellung als Seemacht und seine Neuentdeckungen von bis dato unbekannten Erdteilen gewachsen war. Zu dieser Zeit war die Reise nach den Publikationen religiösen Inhalts das zweitbeliebteste Sujet der britischen Leserschaft.[4] Dies konnten fiktive Reisegeschichten sein, wie Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe aus dem Jahr 1719, oder es waren Reiseberichte, wie sie in Richard Hakluyts dreibändiger, bereits zwischen 1598 und 1600 erschienener Sammlung The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation zu finden waren. Hakluyt und spätere Herausgeber von Reiseberichten wurden in England veritable Berühmtheiten – nicht nur im Kreis der See- und Kaufleute, sondern auch beim »normalen, zuhausesitzenden Leser«.[5]
In die Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fielen die Entdeckungsreisen des Thomas Cook, an deren zweiter der deutsche Forscher Johann Reinhold Forster und sein Sohn Georg Forster beteiligt waren. Zwischen 1772 und 1775 steuerte die Crew zahlreiche Inseln des Südmeeres an, deren Charakteristika von den beiden wissenschaftlich erfasst werden sollten.
1.2 Die Forsters und ihre Reiseberichte
Aufgrund dieses Interesses an Reise und dem Fremden dürften sich die Forsters von der Reise neben »dem Gewinn, der der Wissenschaft erwachsen solle, und dem Zuwachs des menschlichen Wissens im allgemeinen«[6] auch einen finanziellen Gewinn versprochen haben. So verkauften sie einerseits nach der Rückkehr viele ihrer mitgebrachten, von der Aura des Exotischen umgebenen Objekte, die bereits während der Expedition jeweils doppelt gesammelt wurden.[7] Als weitere Einnahmequelle, aber auch als Mittel der Erhöhung der eigenen Reputation beabsichtigte Johann Reinhold Forster andererseits die Herausgabe einer großen, für die breite Öffentlichkeit bestimmten Reisebeschreibung. Doch nach einem Zerwürfnis mit der britischen Admiralität war ihm die Veröffentlichung eines populären und somit gewinnträchtigen Reiseberichts entzogen worden. Stattdessen publizierte er 1778 ›lediglich‹ eine wissenschaftliche Abhandlung mit dem Titel Observations made during a Voyage round the World, on Physical Geography, Natural History, and Ethic Philosophy, die zwar kein Massenpublikum erreichen konnte, jedoch »schnell zu einem Standardwerk über die Südsee und insbesondere ihre Bewohner avancierte.«[8]

John Francis Rigaud: Reinhold und Georg Forster. Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forsterundsohn.jpg#mediaviewer/Datei:Forsterundsohn.jpg
Das Verbot zur Veröffentlichung einer populären Reisebeschreibung bezog sich allerdings nur auf den in Ungnade gefallenen Vater, nicht auf dessen Sohn Georg. Der junge Mann schrieb innerhalb von rund acht Monaten sein zweibändiges Werk A Voyage round the World, das noch vor Thomas Cooks eigener Reisebeschreibung im Jahr 1777 erschien. Das Werk erntete viel Anerkennung und erschien kurz darauf in deutscher Sprache, stellenweise verändert sowie angereichert mit Abschnitten aus Thomas Cooks Tagebüchern, in zwei Bänden 1778 und 1780. Der Erfolg seiner Reise um die Welt war immens und beförderte den Dreiundzwanzigjährigen »in Deutschland in die Reihe der meistgelesenen Schriftsteller jener Zeit«.[9]
Doch erfuhr das Werk auch heftige Anfeindungen. Georg Forster wurde öffentlich verdächtigt, gar nicht der tatsächliche Verfasser des Reiseberichts zu sein. Vielmehr sei es der Vater Johann Reinhold Forster gewesen, der das Werk geschrieben und lediglich unter dem Namen seines Sohnes herausgebracht hätte.[10] Auch wenn sich der Sohn dagegen wehrte und seine Autorenschaft heute unstrittig sein dürfte: Neben seinen eigenen Aufzeichnungen bildeten ebenso die Niederschriften des Vaters die Grundlage für die Reise um die Welt.[11] Und auch die Bemerkungen von Johann Reinhold Forster dürften nicht unberührt von Georgs notierten wie auch von gemeinsam diskutierten Beobachtungen und Erkenntnissen geblieben sein. Der Forster-Experte Michael E. Hoare konstatiert, dass Vater und Sohn »bei uns […] als ein wissenschaftliches Team oder eine symbiotische Einheit angesehen« würden und geht mit Blick auf die Reisebeschreibung davon aus, dass »die beiden Forsters zusammen noch vor dem Ende der Reise die ausführlicheren sowohl botanischen als auch zoologischen Beschreibungen der Reise in ein fast veröffentlichungsfertiges Stadium […] gebracht hatten.«[12] Aufgrund der kurz umrissenen engen Verflechtung der beiden Autoren werden die Werke Reise um die Welt und Bemerkungen in dieser Untersuchung nicht in vergleichender Gegenüberstellung, sondern in ergänzender Hinsicht auf ihre Rezeptionen von Musik fremder Kulturen untersucht.
2. Rezeption ›fremder‹ Musik bei den Forsters[13]
Nach derzeitiger Literaturlage gibt es noch keine Untersuchungen zur Musikrezeption bei den Forsters. Somit können keine Vergleiche zu anderen Arbeiten gezogen werden. Die Analyse wird eng an den Texten erfolgen. Die Untersuchung wird in zwei wesentliche Teilbereiche der Musikrezeption untergliedert: Zunächst soll ermittelt werden, wo und wie die Forsters explizit über Musikinstrumente und deren Eigenschaften berichten.[14] In einem zweiten Schritt werden die Wertzuschreibungen, Funktionen und Ausführungen von Musik im gesellschaftlichen Leben der Völker untersucht.
Dabei ist den kommenden Ausführungen voranzustellen, dass Georg Forsters Reise um die Welt und Johann Reinhold Forsters Bemerkungen vorrangig die Beobachtungen und Erfahrungen der Wissenschaftler im Bereich der Ethnographie und Botanik enthalten. Auf fremdartige Musik und eine Berichterstattung über sie wird kein expliziter Schwerpunkt gelegt. Nur in wenigen und in der Regel sehr kurzen Abschnitten wird das Thema behandelt. Somit stellt sich die Suche nach der Forsterschen Musikrezeption mitunter als eine äußerst spitzfindige heraus. Nichtsdestotrotz kann bereits hier vorangestellt werden, dass in den Werken sowohl Musikinstrumente und ihre Eigenschaften als auch verschiedentliche Funktionen von Musik im Leben bereister Inselkulturen beschrieben werden.
2.1 Beschreibung fremder Musikinstrumente
Von fremden Musikinstrumenten, ihrer Beschaffenheit und ihrer praktischen Nutzung berichten die Forsters nur in erstaunlich seltenen Fällen. So schreibt Georg Forster über eine Begegnung mit exotischen Instrumenten in Neuseeland:
Auch fanden wir einige musicalische Instrumente bey ihnen, nemlich eine Trompete oder vielmehr ein hölzernes Rohr, das vier Fus lang und ziemlich dünn war. Das Mundstück mochte höchstens zwey, und das äußerste Ende ohngefähr 5 Zoll im Durchschnitt halten. Sie bliesen damit immer in einerley Ton, der wie das rauhe Blöken eines Thieres klang, doch möchte ein Waldhornist vielleicht etwas mehr und besseres drauf haben herausbringen können. Eine andre Trompete war aus einem großen Tritons-Horn (murex Tritonis) gemacht, mit künstlich ausgeschnitzten Holz eingefaßt, und an demjenigen Ende, welches zum Mundstück dienen sollte, mit einer Öfnung versehen. Ein schrecklich blökender Ton war alles was sich herausbringen ließ. Ein drittes Instrument, welches unsere Leute eine Flöte nannten, bestand aus einem hohlen Rohr, das in der Mitte am weitesten war und in dieser Gegend, desgleichen an beyden Enden eine Öfnung hatte. Dies und das erste Instrument waren beyde, der Länge nach, aus zwey hohlen Stücken von Holz zusammengesetzt, die eins für das andre so eben zurecht geschnitten waren, daß sie genau auf einander paßten und eine vollkommne Röhre ausmachten.[15]
Zunächst ist die Verwendung der europäischen Begrifflichkeiten »Trompete« und »Flöte« für die unbekannten Instrumente auffällig, die Forster zwar zur Veranschaulichung benutzt und sich doch im selben Atemzug von ihnen distanziert. Auf der einen Seite benötigt er Begriffe, die ihm und den Lesenden das Unbekannte über Vertrautes näher bringen, andererseits weiß er um die Diskrepanz zwischen Bezeichnung und Erfahrenem, wenn er der vermeintlichen Trompete die Beschreibung als »vielmehr ein hölzernes Rohr« beifügt und beiläufig klarstellt, dass die Flöte nur von »unsere[n] Leute[n]« als solche bezeichnet wird.
Ferner fällt auf, wie detailliert die Beschreibung trotz der wenigen Worte ausfällt: Forster klärt über Größe, Material, Aufbau und Tonumfang auf, sodass sich der heimische Leser ein recht genaues Bild von den Instrumenten machen kann. Die Wertung lässt dabei nicht lange auf sich warten: Wie das »Blöken eines Tieres« klängen die sogenannten Trompeten. Durch den Vergleich mit animalischen Lauten wird dem neuseeländischen Instrument jede ästhetische Klangqualität abgesprochen. Der europäische Leser des späten 18. Jahrhunderts kann sich hingegen ein ungefähres Klangbild machen und sich in der Stärke seiner Zivilisation bestätigt sehen.
Ebenso berichten die Forsters sowohl in der Reise um die Welt als auch in den Bemerkungen von einer weiteren Flöte und ihrer Spielart, deren Bekanntschaft sie auf Tahiti machten:
Einer von den jungen Männern blies mit den Nasenlöchern eine Flöte von Bambusrohr, die drei Löcher hatte und ein andrer sang dazu. Die ganze Musik war […] nichts anders als eine einförmige Abwechselung von drey bis vier verschiednen Tönen, die weder unsern ganzen, noch den halben Tönen ähnlich klangen, und dem Werth der Noten nach, ein Mittelding zwischen unsern halben und Vierteln seyn mochten. Übrigens war nicht eine Spur von Melodie darinn zu entdecken; ebensowenig ward auch eine Art von Tact beobachtet, und folglich hörte man nichts als ein einschläferndes Summen. Auf diese Weise konnte die Music das Ohr freylich nicht durch falsche Töne beleidigen, aber das war auch das beste dabey, denn lieblich war sie weiter eben nicht zu hören. Es ist sonderbar, daß, da der Geschmack an der Music unter alle Völker der Erde so allgemein verbreitet ist, dennoch die Begriffe von Harmonie und Wohlklang bey verschiedenen Nationen so verschieden seyn können.[16]
Und Johann Reinhold Forster schreibt bezüglich des tahitianischen Instruments:
Weit unvollkommener als ihre Poesie und Tanzkunst, ist ihre Music. Die taheitische Flöte hat nur drey Ventile, und ist folglich auf gar wenige Noten beschränkt. Die Musik die damit gemacht wird, besteht in einem einförmigen Gesumme. Die Flöte wird mit der Nase geblasen.[17]
Beide benutzen auch hier den ihnen bekannten Begriff der Flöte für die Beschreibung des Instruments. Auffällig scheint doch die bei beiden nahezu beiläufige Äußerung, dass das Instrument mit der Nase gespielt wird. Für den europäischen Rezipienten dürfte dies eine Attraktion gewesen sein! Doch lässt sich vermuten, dass die Forsters auf ihrer jahrelangen Fahrt öfter mit solchen Blasinstrumenten in Berührung kamen, sodass sie diese Besonderheit nicht weiter ausschmückten.
Die Reisenden konstatieren nicht nur sachlich die Andersartigkeit des dortigen Tonsystems, sondern sie bemängeln darüber hinaus den monotonen Klang und den beschränkten Tonumfang der Flöte. Georg Forster geht gar noch weiter in seiner Kritik. Nicht nur das Instrument sei primitiv, sondern auch die musikalische Ausführung von Instrumentalist und Sänger: Denn zur fehlenden Melodie und seinem wahrgenommenem »Summen« wurde »ebensowenig […] eine Art von Tact beobachtet«. Auch wenn Georg Forster ihm einen generellen »Geschmack an der Music« zugesteht und ihn somit nicht völlig diskreditiert, wird der Tahitianer somit indirekt als unmusikalisch dargestellt.
Dass Georg Forster aber auch eine gewisse Faszination für ein Instrument entwickelte, lässt sich an einer Episode auf Tanna ablesen: Dort hätten die Insulaner ihm ein Instrument präsentiert,
welches gleich der Syrinx, oder Pan-Flöte, von Tonga-Tabbu, aus acht Rohr-Pfeifen bestand, mit dem Unterschied, daß hier die Röhren stufenweise kleiner wurden, und eine ganze Oktave ausmachten, obgleich der Ton jeder einzelnen Pfeife nicht völlig rein war. […] Wir kauften auch etliche achtröhrige Pfeifen ein, die nebst Boden, Pfeilen, Streitkolben und Speeren feil geboten wurden […].[18]
Die Beschreibung des Instruments wird recht knapp und sachlich gehalten. Des Weiteren fällt hier der intragruppale Vergleich auf: Die tannische »Pan-Flöte« wird mit einem anscheinend ähnlichen Instrument in Beziehung gesetzt, das auf einer anderen Insel (Tongatabu) gesichtet wurde.[19] In dieser Gegenüberstellung wird die tannische »Panflöte« der tongaischen bevorzugt, hat sie doch einen Tonumfang von immerhin »eine[r] ganze[n] Oktave«. Nicht zuletzt lässt sich die wohlwollende Sicht des Autors auf das Instrument mit seinem Kauf »etliche[r] achtröhrige[r] Pfeifen« belegen – hier begnügte er sich nicht mit dem Kauf eines oder zweier Exemplare, wie sonst wohl üblich.[20]
Als weitere häufig erwähnte, aber nur an einer Stelle tatsächlich beschriebene Instrumentengattung sind Trommeln zu nennen. In der Regel werden sie nur beiläufig und in Verbindung mit Tänzen erwähnt. Die einzige knappe Instrumentenbeschreibung findet sich in den Ausführungen zu einem Hiva-Tanz auf Raiatea.[21] Dort heißt es, es habe sich um »drei aus hartem Holz geschnitzte und mit Haifischhaut überzogene Trommeln« gehandelt. Die Beschaffenheit aus Haifischhaut ist für den Leser zwar durchaus interessant, doch über die Größe und den Klang des Instrumentes erfährt man nichts.
An wenigen Stellen finden auch Beschreibungen des Gesangs Einzug in die Ausführungen. Diese sind insbesondere im achten Abschnitt der – im Gegensatz zur chronologisch angelegten Reise um die Welt – systematisch aufgebauten Bemerkungen zu finden.[22]
In Bezug auf die Gesangskünste werden die Kulturen in vergleichender Betrachtung qualitativ-hierarchisch dargestellt: Einen angenehmen Gesang hätten die Forsters in Neuseeland und in Tanna erlebt. Bei anderen Völkern, wie den Einwohnern Tahitis, sei dieser weniger komplex gewesen:
Auch die Vocalmusik ist [in Tahiti] von keinem weiteren Umfange; sie enthält nur drey bis vier Töne, demohnerachtet sind einige ihrer Gesänge nicht ganz unangenehm. Unter den Einwohnern der freundschaftlichen Inseln hat die Musik ungleich stärkern Fortgang gehabt. Die Gesänge der Frauenzimmer auf der Insel Ea-uhwe oder Middelburg […] hatten etwas angenehmes. Noch mehr Abwechselung und Umfang findet man in den Gesängen der Tannesen und der Neuseeländer; es scheint also, daß diese von Natur mehr Anlage zur Musik haben.[23]
Die Äußerung veranschaulicht den damals sicherlich modernen, heute antiquiert wirkenden Fortschrittsgedanken Forsters: Es gäbe Ethnien wie jene in Tahiti, deren Gesänge weniger entwickelt wären, und andere, wie das Neuseelands, das einen stärkeren Fortgang durchlebt hätte und dazu »von Natur mehr Anlage zur Musik haben«. Dieser These liegt selbstverständlich das europazentrische Weltbild zugrunde, das auch am Ende des 18. Jahrhunderts unter Humanisten, als welche sich die Forsters verstanden, verbreitet war. Keines der bekannt gemachten Völker konnte seine Kunstprodukte aus ihrer Sicht in Umfang und Qualität mit europäischen Gesängen vergleichen.
Während sich die Gesangskunst nach Auffassung der Forsters also nicht mit jener der Europäer messen konnte, imponierte ihnen anscheinend die Improvisationskunst der fremden Kulturen:
Die Kunst, aus dem Stegereif Verse zu machen und sie zugleich abzusingen, ist allgemein. Ihre dramatischen Vorstellungen sind gemeiniglich dergleichen auf der Stelle erdachte Compositionen, oder ein Gemisch von Gesängen, Tänzen und Musik. Unser Welttheil hat also seine Improvvisatori nicht allein.[24]
Hier wird das improvisierte Texten und Singen als tatsächliche Kunst beschrieben. Die Qualität des Dargebotenen wird mit jener der Europäer gleichgesetzt. Dies erstaunt doch und dürfte zu damaliger Zeit eine Provokation für den ein oder anderen einheimischen Leser dargestellt haben. Eine indirekte Begründung – nicht weniger brisant – wird ausgerechnet am Beispiel der Tahitianer gegeben, denen doch nur wenige Textpassagen zuvor die Kunst des Gesanges abgesprochen wurde:
Die Taheitier pflegen, wie auch die Griechen ehemals thaten, ihre Verse stets singend zu recitiren. Diese kleinen Gedichte werden mehrentheils aus dem Stegereif gemacht. […] Die Verse haben ein förmliches Sylbenmaaß, und beym Singen wird die Quantität ausgedruckt.[25]
Hier werden die Tahitianer mit dem antiken Griechenland verglichen und dadurch in eine indirekte Beziehung mit den Europäern und deren Tradition gesetzt. Nach dieser Darstellung bliebe zwar die tahitianische Bevölkerung in ihrer Entwicklung Tausende Jahre hinter den Europäern zurück, aber ihre Wurzeln wären die gleichen. Neben diesen erstaunlichen Ausführungen fällt ein weiteres Mal der Versuch auf, das Wahrgenommene mit den eigenen Begrifflichkeiten zu beschreiben: Es wird von »Versen« gesprochen, die ein »förmliches Silbenmaaß« hätten.
Alles in allem bleibt festzuhalten, dass sich die Forsters vergleichsweise wenig mit Musikinstrumenten auseinandersetzen. In nur wenigen Aufzeichnungen werden Instrumente explizit beschrieben, wobei vor allem die flötenartigen Instrumente exemplarisch und vergleichend vorgestellt werden. Trommeln werden zwar öfter erwähnt, aber kaum beschrieben.[26] Neben ihnen findet der Gesang und seine Ausprägung Einzug in die Beschreibung. Allerdings wird er lediglich an einer Stelle dem Leser näher gebracht. Während die Instrumente und Gesänge auf weniger Zustimmung bei den Forsters stoßen, hegen sie Respekt für die Improvisationskünste der Insulaner.
2.2 Zur Rolle von Musik im gesellschaftlichen Leben
Die Forscher kamen mit der musikalischen Praxis der Inselkulturen sowohl in deren Alltag als auch zu besonderen Anlässen in Kontakt.[27] Zum Bereich des Alltags werden in dieser Untersuchung der Umgang mit und der Ausdruck von Musik gezählt, die den Ethnien als typisch und sich stets ereignend zugeschrieben werden. Als besondere Anlässe werden solche angesehen, die sich nicht oder nur selten wiederholen.
Wie bereits oben konstatiert, geben die Forsterschen Werke nur selten Einblicke in die fremden Musikinstrumente. Gleiches gilt auch für die Behandlung von Musik im Alltagsleben der bereisten Völker. Wenn allerdings Rezeptionen von Musik im Alltag ihren Niederschlag in die Schriften finden, so wird ihr ein hoher Stellenwert für die Insulaner zugeschrieben. So heißt es in Bemerkungen zu den Bewohnern von Mallikollo:
Frölichkeit, Musik, Gesang und Tänze sind bei ihnen sehr beliebt.[28]
Und zu den Neuseeländern wird im gleichen Werk festgehalten:
Fabeln und romantische Erzählungen, Musik, Lieder, Tänze sind ihr Zeitvertreib.[29]
Ähnliches wird über die Bewohner der schon früher bereisten portugiesischen Insel Madeira berichtet, die nicht nur in der Freizeit, sondern trotz widriger Lebensumstände ebenso vergnügt während der Arbeit musizierten:
[…] dennoch sind sie bey aller Unterdrückung lustig und vergnügt, singen bey der Arbeit und versammeln sich des Abends, um nach dem Schall einer einschläfernden Guitarre zu tanzen und zu springen.[30]
Schon aus den genannten Beispielen lässt sich ersehen, dass Musik im Alltagsleben laut den Forsters bei vielen Kulturen eng mit Tänzen verbunden war. Oftmals hätten diese bei Nacht und in großem Stil stattgefunden, wie es in Reise um die Welt u. a. für die Bewohner von Raiatea (Gesellschaftsinseln) beschrieben wird:
Überhaupt halten sie es mit allen Arten von sinnlicher Freuden; und daher ist Musik und Tanz allenthalben ihr Zeitvertreib. Diese Tänze sollen des Nachts ungebührlich ausschweifend seyn, doch wird keinem, als blos den Mitgliedern der Gesellschaft, der Zutritt verstattet.[31]
An dieser wiederum sachlichen und knappen Beschreibung ist zu erkennen, dass die Forsters nicht immer die Möglichkeit hatten, die Vorgänge mit eigenen Augen zu sehen. Ebenso kann ein identitätsstiftendes Moment in den abendlichen Musik- und Tanzveranstaltungen von Raiatea aufgrund ihres geschlossenen Charakters gesehen werden. Dass die Tänze ausschweifend gewesen seien, lässt auf die Länge und Lautstärke der nächtlichen Veranstaltungen schließen. Aber dürfte eine sexuelle Anzüglichkeit der Tänze darin inbegriffen sein. So ist in den Bemerkungen bezüglich desselben Volks zu lesen, die Gesänge und Tänze der Bewohner »athmen Wollust«[32]. Die sexuellen Reize, die die Autoren anscheinend verspürten, werden ebenso für die Frauen Tahitis in Verbindung mit ihren musikalischen Ausdrucksformen festgestellt.[33]
Die beiden Forsters widmen sich in vergleichsweise ausführlicher Weise dem Erlebnis eines Hivas. Allerdings widersprechen sich die beiden in der Verortung des Erlebten: Während Georg Forster die Beschreibungen auf die Insel Raiatea bezieht, spricht Johann Reinhold Forster von Tahiti. Da aber in beiden Berichterstattungen ganz ähnliche Charakteristika sowohl den Protagonisten, als auch dem Ereignis zugesprochen werden, ist davon auszugehen, dass es sich tatsächlich um den gleichen Beobachtungsgegenstand handelt. Ob das Gesehene nun in Raiatea oder auf Tahiti stattfand, lässt sich nicht anhand der beiden Werke herausfinden.
Der Hiva sei ein öffentlicher Tanz gewesen und »abermalig« aufgeführt worden.[34] Er sei in vier Akte untergliedert gewesen, die von einem Trommelspiel eingeleitet worden seien, wobei diese »von vier oder fünf Leuten blos mit den Fingern, aber mit unglaublicher Geschwindigkeit geschlagen« worden seien.[35] Die Zuschreibung der geschickten Spielweise ist nicht nur als Respektsäußerung, sondern auch als Hinweis für ein schnelles Zusammenspiel der Musiker zu verstehen.
Daraufhin wären Tänzerinnen dazu gestoßen. Sie hätten sich in ihren Bewegungen zum einen nach dem Trommelspiel gerichtet, zum anderen aber auch nach einem alten Mann, dem »Ballettmeister«[36], »der mit tanzte und einige Worte hören ließ, die wir, dem Ton nach, für eine Art Gesang hielten.«[37] Um nach Georg Forsters Formulierung zu urteilen, war jener Gesang des Mannes in den Ohren der Forsters nicht angenehm, zumindest ungewohnt.
Davon abgesehen, dass die Mundbewegungen der tanzenden Frauen von beiden Forsters als äußerst unästhetisch wahrgenommen wurden,[38] imponierte ihnen der Tanz. In den Armbewegungen der Tänzerinnen sei doch »viel Grazie und in dem beständigen Spiel ihrer Finger ebenfalls etwas ungemein zierliches.«[39] Die Europäer »überhäuften die Tänzerinnen« nach der Darbietung aus Begeisterung »mit Corallen und anderm Putzwerk«.[40]
Die Aufzeichnungen der Forsters gehen in ihren Musikbeschreibungen stellenweise ebenso auf die weniger alltäglichen, besonderen Ereignisse ein, die sich im Leben der Insulaner oder in direktem Kontakt zwischen den Europäern und den Fremden zutrugen. So berichtet Georg Forster in Reise um die Welt von einem Zusammenstoß zwischen den Einwohnern Mallikolos und der Crew von Cook: Während die Einwohner sich mit den Europäern auf deren Schiff kennenlernten, eskalierte die Situation. Es war nicht genug Platz an Deck und so wurden einige Insulaner wieder zurück geschickt. Einige ließen sich von den Europäern provozieren und richteten Pfeile auf die Mannschaft, andere schwammen zurück an Land.
Kaum hatten sie dasselbe erreicht, so hörte man in unterschiednen Gegenden Lerm trommeln, und sahe die armen Schelme […] truppweise beysammen hucken, ohne Zweifel um Rath zu halten, was bei so critischen Zeitläufen zu tun sey?[41]
An dem Beispiel lässt sich erkennen, dass die Insulaner ihre Trommeln nicht nur für Tänze und andere musikalische Aufführungen nutzten, sondern auch als militärisches Mittel. Über diese Funktion von Musik wird in Bemerkungen ebenfalls über die Neuseeländer berichtet:
Sie beginnen sogar ihre Gefechte mit kriegerischem Tanz und Gesang.[42]
In einer näheren Ausführung zum neuseeländischen »Schlachtgesange« schreibt Johann Reinhold Forster:
Die Neuseeländer pflegten uns zuweilen mit ihrem Schlachtgesange zu unterhalten. Einer stimmte ihn an, und stampfte dabey heftig mit den Füssen, machte allerley Bewegungen und Gebehrden dazu, und schwenkte seine Streitaxt. Am Ende jeder Strophe folgte eine Art von Ritornell, in welches der ganze wilde Haufen, als Chor, mit lautem gräßlichen Geschrey einstimmte. Dadurch erhitzen sie sich bis zu einem gewissen Grade von Raserey, welches der einzige Gemüthszustand ist, in dem sie handgemein werden.[43]
Auffällig ist abermals die wiederholte Verwendung von Begriffen aus der europäischen Musiktheorie: Forster spricht von Strophen, einem wiederkehrenden Ritornell und einem Chor, was eigentlich nicht so recht mit diesem angeblichen »wilde[n] Haufen« und »gräßlichen Geschrey« zusammenpassen will. Um die Erfahrungen wiederzugeben, benötigt er anscheinend auch hier ein Begriffswerkzeug, das ihm und seinen Lesern bekannt ist.
Neben seiner Abwertung der wahrgenommenen Musik scheint doch die Äußerung interessant, dass sich die Neuseeländer über die Musik in einen Zustand versetzen könnten, der sich stark von ihrem eigentlichen, von Forster attestierten Wesen abhebt: Dies sei der »einzige Gemüthszustand«, der sie »handgemein« werden ließe. Wie diese Bösartigkeit aussah, lässt er im Dunkeln. Doch bleibt für ihn die Erkenntnis, dass sich die Neuseeländer über die Musik in einen aggressiven Zustand versetzen und für ein mögliches Gefecht rüsten konnten.
Eine weitere Episode handelt von einer Hochzeit auf Tahiti, der die Forsters aber nicht selbst beiwohnten. Dennoch gibt der ältere Forster in Bemerkungen die Szenerie wieder, wie sie von einem Landsmann auf Tahiti gesehen worden sein soll.[44] Dieser hätte beobachtet, wie während der Trauungsprozedur zehn bis zwölf Personen, vor allem Frauen, …
umherstanden, und einige Worte in einem singenden Tone, als Recitative, hersagten. Zwischen den Absätzen dieses Gesanges antworteten Maheine und seine Braut durch kurze Formeln.[45]
Kann den Aussagen des unbekannten Zeugen vertraut werden, dann wäre die Vokalmusik ein Ritualbestandteil tahitianischer Hochzeiten gewesen. Mehr erfährt der Leser leider nicht zu dem musikalischen Anteil an der Prozedur.
Ein weiterer, von Johann Reinhold Forster selbst beobachteter Anlass, bei dem Musik eine wichtige Rolle spielte, war ein Begräbnis auf der Insel O-Tahà, das denn auch etwas präziser beschrieben wird:
Auf der Insel O-Tahà war ich bey einem Begräbniße zugegen, wo drey kleine Mädgen tanzten, und drey Mannspersonen Zwischenspiele vorstellten. Zwischen den Aufzügen traten die Freunde und Verwandten (Hea-biddi) des Verstorbenen, vom Kopf bis auf die Füsse bekleidet, paarweise vor den Eingang der Hütte, jedoch ohne hineinzugehen. Darauf ward der Platz auf welchem das Schauspiel vorgestellt worden war, ein Fleck von 30 Schuh in Länge, und acht Schuh in der Breite, mit Zeug belegt, und dieses dem Trommelschlägern, die während der Vorstellung Musik gemacht hatten, zum Geschenke gegeben. […] nur so viel erfuhr ich, es sey gebräuchlich, daß, bey dem Absterben vornehmer Leute, der erste Leidtragende, zur Begräbnißfeyer in dem weitr oben beschriebenen Trauerkleide umher gehe, und daß Schauspiele, von Tänzen und Gesängen begleitet, angestellet würden.[46]
Die Darstellung der Szenerie zeigt auf, dass eine musikalische Umrahmung des Begräbnisses zum Ritual der Bevölkerung auf O-Tahà gehörte. Anscheinend handelte es sich hierbei um die Beerdigung eines Menschen hohen Ranges innerhalb der Gesellschaft. Wahrscheinlich wurde auch nur Bewohnern mit hohem Ansehen solch eine musikalisch garnierte Trauerfeier zuteil. Forster erwähnt auch hier die Trommelspieler, die während des Rituals Musik machten. Dass sie das niedergelegte »Zeug« geschenkt bekamen, kann als Zeichen der Achtung gegenüber den Musikern gewertet werden. Auch die Feststellung, Musiker hätten nur bei außerordentlichen Zeremonien mitgewirkt, unterstreicht die Annahme ihrer gesellschaftlichen Stellung.
Doch treten in der Darstellung nicht nur Trommler auf, sondern ebenso drei tanzende Mädchen und drei Männer, die die »Zwischenspiele vorstellten«. Was mit diesen Zwischenspielen tatsächlich gemeint ist, bleibt dem Leser verschlossen. Dass es sich bei diesem Begräbnis jedoch um eine Veranstaltung gesellschaftlichen Rangs, von einem größerem künstlerischem Programm umrahmt, handelte, wird deutlich. Der Musik wurde demnach ebenso auf O-Tahà große Bedeutung zugesprochen.
Bei zusammenfassendem Blick auf die beschriebenen Musikfelder im Leben der Gesellschaften fällt auf, dass der Stellenwert von Musik bei den bereisten Kulturen hoch gewesen sein muss und die Forsters dies bereitwillig dokumentieren. Sowohl im alltäglichen Leben als auch zu besonderen Anlässen wurde ihren Berichten zufolge musiziert – zumeist in Verbindung mit Tänzen, die freilich nicht selten als anzüglich beschrieben werden. Wertungen treten bei den Beschreibungen zur Musik im Leben der Gesellschaften ansonsten zurück. Vielmehr wird von den Forsters versucht, die Begebenheiten möglichst ›objektiv‹ wiederzugeben, auch wenn immer wieder Einwürfe subjektiver Wahrnehmungen erkenntlich sind.
Die Untersuchung zeigt zunächst, dass das Thema Musik nur in recht wenigen Passagen der Werke Reise um die Welt und Bemerkungen behandelt wird. Auch rücken nicht alle, sondern nur wenige Inselvölker diesbezüglich in den Fokus: Vor allem den Berichten zu Neuseeland und Tahiti sind Ausführungen zur Musik der fremden Kulturen zu entnehmen. Mit Blick auf die tatsächlich verbrachte Zeit vor Ort verwundert dieser Befund nicht, verweilte Cooks Mannschaft doch während zweier Aufenthalte über fünf Wochen auf Tahiti und noch deutlich länger auf Neuseeland.[47] Weshalb ebenfalls länger besuchte Inseln wie bspw. Huaheine oder die Fidschi-Inseln nicht in die Musikbeschreibungen aufgenommen wurden, lässt sich anhand der Schriften nicht erklären – schließlich ist nicht davon auszugehen, dass die Bevölkerung dort keinerlei Musik praktizierte. Wahrscheinlich ist der Grund in der wissenschaftlichen Ausrichtung der Forsters zu finden: Ihr Forschungsschwerpunkt lag auf der Botanik sowie Ethnographie und nicht auf der Musik fremder Kulturen. Demzufolge ist fast zwangsläufig der Anteil von Musikbeschreibungen gegenüber anderen Feldern nachgestellt und in einigen Inselbeschreibungen schlicht weggelassen worden.
Dennoch lassen sich einige Ergebnisse zur Musikrezeption bei Forster anhand ihrer Beschreibungen eruieren: Da ist zum einen die Art der Beschreibung, bei der die Verwendung von europäischen Musikbegriffen bei beiden Autoren auffällig ist. Begriffe wie Rezitativ, Vers, Strophe usw. zeugen von dem Drang, die Fremdheitserfahrung mit den sicheren Begriffen der Heimat zu beschreiben. Das dient nicht nur dem Autor, sondern erleichtert auch dem europäischen Zeitgenossen die Imagination des Fremden. Dass Johann Reinhold Forster häufiger auf die landesüblichen Bezeichnungen von Tänzen, Gesängen etc. eingeht, verwundert bei seiner Intention der Abfassung einer wissenschaftlichen Arbeit selbstverständlich nicht.
Zum anderen tragen die Beschreibungen inter- wie auch intragruppale Vergleiche in sich. Zu ersterem können jene zur europäischen Musik gezählt werden, die sich beispielsweise bereits indirekt in den genutzten europäischen Musikbegriffen oder direkt am Beispiel der festgestellten Improvisationskunst der Südländer, die jener Europas nicht nachstehe, auszumachen sind. Intragruppale Vergleiche werden von den Forsters dort vorgenommen, wo sie die festgestellten Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den fremden Kulturen benennen, u. a. bei Johann Reinhold Forsters Versicherung, die Vokalmusik der Tahitianer wäre jener der Einwohner Tannas und Neuseelands qualitativ nachzustellen.
Beim fokussierten Blick auf die wenigen Passagen Forsterscher Musikrezeption fällt der hohe Ausbreitungsgrad und Stellenwert von Musik im Leben der diesbezüglich beschriebenen Kulturen auf, den die beiden Chronisten beschreiben. Sowohl im Kontext des Alltagslebens als auch von Feierlichkeiten wird der Musik auf mehreren Inseln eine besondere Bedeutung zugemessen. Ihre Funktion lag sowohl in dem gemeinschaftlichen Ritual des Alltags als auch in der Umrahmung von Hochzeiten (Tahiti), Begräbnissen (O-Tahà) oder in der Vorbereitung eines Gefechts (Neuseeland).
Bezüglich den Forsterschen Ausführungen zu den Instrumenten ist festzuhalten, dass diese nur selten Gegenstand musikalischer Beschreibungen sind. Nach diesen zu urteilen, kamen die beiden Forscher nur mit wenigen exotischen Instrumenten in Kontakt. Hier sind vor allem die tahitianischen Flöten zu nennen, die mit der Nase geblasen wurden. Von der Begegnung mit fremden Harmonieinstrumenten berichten die Autoren nahezu gar nichts. Musiziert worden sei mit Flöten, vor allem aber mit Trommeln und der menschlichen Stimme. Besonders auffällig ist den Berichten zufolge die Bedeutung des Tanzes, der anscheinend bei musikalischen Aufführungspraktiken zu verschiedensten Anlässen auf den Inseln praktiziert wurde. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Musik auf den meisten beschriebenen Inseln nach Ansicht der Forsters ungewohnt rhythmusbetont, weniger harmonie- als melodiereich gewesen sein musste und überwiegend im Zusammenwirken mit Tänzen aufgeführt wurde.
Zuletzt sei noch auf die Forstersche Sicht auf die Völker und die Bewertung des Reifegrades derer Musik eingegangen: Sowohl in der Reise um die Welt als auch in den Bemerkungen werden die Insulaner als Menschen angesehen, was damals noch immer alles andere als üblich war. Durch den Vergleich der tahitianischen Musik mit jener der Griechen werden sie und ihre Kunst gar in eine gemeinsame Traditionslinie mit den Europäern gestellt. Nur seien sie unterschiedlich weit entwickelt und hätten allesamt noch nicht das Stadium der Europäer erreicht; es bleibt offen, ob die Inselvölker nach Meinung der Forsters zu einer Entwicklung und einer Geschichtlichkeit überhaupt in der Lage seien. Die weniger entwickelten Techniken in verschiedenen Bereichen der Völker seien aber durchaus auch von Vorteil für deren Mentalität gewesen. So soll ein Zitat aus den Bemerkungen den Abschluss dieser Studie bilden, das Johann Reinhold Forsters Rekapitulation seiner „Allgemeine[n] Übersicht über das Glück der Insulaner im Südmeere“ entnommen ist und ihn voller Respekt für die Insulaner zeigt:
Indeß die Knaben und Mädgen mit Tanz und Gesang sich ergötzten, und die reifere Generation an ihren Freuden thätigen Antheil nahm, entdeckten wir oft im sanften, freudigheitern Blick des ehrwürdigen Alten, ein stummes Zeugniß ihres und seines Glücks. Daher sind wir auch völlig überzeugt, daß diese Insulaner einen Grad von Zufriedenheit geniessen, den man, bey mehr gesitteten Völkern, selten bemerkt, und der desto schätzbarer ist, je allgemeiner er sich auf jeden Mitbürger erstreckt, je leichter er erreichbar ist, und je genauer er mit der gegenwärtigen Verfassung des Volks zusammenstimmt, welches, für höhere Stufen der Glückseligkeit, noch nicht empfänglich ist.[48]
Nachweise und Anmerkungen
[1] Das Wort »Reise« stammt laut Duden vom althochdeutschen »risan«, das u. a. »sich erheben« bedeutet (http://www.duden.de/rechtschreibung/Reise. zuletzt eingesehen am 23. Juni 2014).
[2] Vgl. Moennighoff, Burkhard et al.: Vorwort, zu ders. et al. (Hrsg.): Literatur und Reise, Hildesheim 2013, S. 5.
[3] Ortheil, Hanns-Josef: Schreiben und Reisen. Wie Schriftsteller vom Unterwegs-Sein erzählen, in: Moennighoff, Burkhard et al. (Hrsg.): Literatur und Reise, Hildesheim 2013, S. 7.
[4] Kalb, Gertrud: Travel Literature Reinterpreted. Robinson Crusoe und die religiöse Thematik der Reiseliteratur, in: Anglia. Zeitschrift für englische Philologie 101 (1983), S. 407.
[5] Ebenda, S. 410.
[6] Johann Reinhold Forster: “The thirst of knowledge, [and] the desire of discovering new animals new plants […]”, zitiert nach: Kaeppler, Adrienne: Die ethnographischen Sammlungen der Forsters aus dem Südpazifik. Klassische Empirie im Dienste der modernen Ethnologie, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 59.
[7] Dass die doppelte Einholung der Artefakte tatsächlich der Intention des Weiterverkaufs geschuldet ist, ist wahrscheinlich, aber nicht belegbar. Vergleiche hierzu: Kaeppler, Adrienne L.: Die ethnographischen Sammlungen der Forsters, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 63.
[8] von Hoorn, Tanja: Dem Leibe abgelesen. Georg Forster im Kontext der physischen Anthropologie des 18. Jahrhunderts, Tübingen 2004, S. 22.
[9] Neubauer, Barbara: Nachwort, in: Forster, Georg: Reise um die Welt, hrsg. von Barbara Neubauer, Berlin 1960, S. 646.
[10] Der Astronom der zweiten Cook-Reise, William Wales, Lord Sandwich und ein Rezensent der Göttinger Gelehrten Anzeigen erhoben diese Vorwürfe. Hierzu: Neubauer, Barbara: Nachwort, in: Forster, Georg: Reise um die Welt, hrsg. von Barbara Neubauer, Berlin 1960, S. 646.
[11] Ebenda, S. 645.
[12] Hoare, Michael E.: Die beiden Forster und die pazifische Wissenschaft, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 30.
[13] Als Quellen fungieren die jeweils deutschen Ausgaben der Werke – Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt gesammelt, Berlin 1783; Forster, Georg: Reise um die Welt, in: Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin (Hrsg.), Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. Streitschriften und Fragmente zur Weltreise, 2 Bde., Berlin 1972.
[14] Zu den Musikinstrumenten wird hier auch die menschliche Stimme gezählt.
[15] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 198.
[16] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 246.
[17] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 405f.
[18] Forster, Georg: Reise um die Welt, 2. Teil, S. 248ff.
[19] Allerdings wird jenes Instrument weder in der Reise um die Welt noch in den Bemerkungen explizit beschrieben.
[20] Wie oben erwähnt, kauften die Forsters in der Regel lediglich zwei Exemplare. Vgl. Kaeppler, Adrienne L.: Die ethnographischen Sammlungen der Forsters, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 63.
[21] Auf den Tanz wird in Punkt 2.2 näher eingegangen.
[22] Hier werden neben den Wissenschaften explizit auch die Künste der bereisten Länder vorgestellt. Siehe: Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 375ff.
[23] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 406.
[24] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 403.
[25] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 406f. – Im Übrigen erscheint wenige Zeilen nach dem Zitat in Johann Reinhold Forsters Text der einzige Versuch, Liedabschnitte wiederzugeben. Dabei erfolgt, neben der Textaufzeichnung und -übersetzung, eine Notation des gesungenen Rhythmus in Form von über den Worten eingetragenen Strichen für die langen Noten und Punkten für die kurzen, eingeteilt wird das Notat durch Taktstriche. Siehe Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 407.
[26] Auf die verschiedentlichen Kontexte wird in Punkt 2.2 eingegangen.
[27] Der Begriff ›Alltag‹ kann hier nicht völlig problemlos gebraucht werden, da dieser durch die Anwesenheit von Cooks Crew beeinflusst wurde. Trotzdem soll hier zwischen Beobachtungen des Musikgebrauchs im ›normalen Leben‹ und dem ›besonderen Ereignis‹ unterschieden werden.
[28] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 306.
[29] Ebenda, S. 286.
[30] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 49. – Auf Madeira wird zum einzigen Mal und nahezu beiläufig eine Gitarre als begleitendes Instrument benannt.
[31] Forster, Georg: Reise um die Welt, S. 279; ebenfalls zu dieser Insel: Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 358; siehe auch für die Bewohner von Mallikolo: Forster, Georg: Reise um die Welt, 2. Teil, S. 164.
[32] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 207.
[33] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 412; ebenfalls zur angeblichen Anzüglichkeit tahitianischer Frauen: Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 278.
[34] Vgl. Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 321.
[35] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 322.
[36] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 405.
[37] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 323. – Ähnlich in Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 405.
[38]Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 323f. Bei Johann Reinhold Forster überwiegen beinahe seine Ausführungen zu den Mundbewegungen. Diese seien »nichts als die häßlichste Verunstaltung«, »wiedrig und eckelhaft«. Siehe Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 405.
[39] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 323. Johann Reinhold Forster hebt auch die »Geschicklichkeit und Zierlichkeit« der Fingerbewegungen hervor. Er begründet dies mit ihren anatomischen Voraussetzungen, wonach ihre Finger »fast durchgehends lang gut proportioniert, und zugleich so angenehm biegsam« seien. Siehe Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 404. Gut ersichtlich ist in dieser Passage auch der wissenschaftliche Anspruch des älteren Forsters, der immer wieder die landesüblichen Termini wiederzugeben versucht. So nennt er u. a. die Bezeichnung für die galanten Fingerbewegungen, »Eorre«. Siehe Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 404.
[40] Forster, Georg: Reise um die Welt, 1. Teil, S. 324.
[41] Forster, Georg: Reise um die Welt, 2. Teil, S. 167.
[42] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 286.
[43] Ebenda, S. 412.
[44] Ebenda, S. 483f.
[45] Ebenda, S. 484.
[46] Ebenda, S. 412f.; ebenfalls Bezug nehmend auf die Situation, aber keine neuen Erkenntnisse zur Musik: ebenda, S. 490.
[47] Neben der langen Zeit auf See ist die teilweise sehr kurze Verweildauer auf anderen Inseln zu beachten. Eine chronologische Auflistung der bereisten Inseln ist zu finden in: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Hrsg.): Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe, Bd. 3, bearb. von Gerhard Steiner, Berlin 1966, S. 453–455.
[48] Forster, Johann Reinhold: Bemerkungen, S. 509. Hier behandelt er die Bewohner Tahitis stellvertretend für die bereisten Völker.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen
Forster Johann Reinhold: Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt gesammelt, Berlin 1783.
Forster, Georg: Reise um die Welt, in: Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin (Hrsg.), Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. Streitschriften und Fragmente zur Weltreise, 2 Bde., Berlin 1972.
Literatur
Hoare, Michael E.: Die beiden Forster und die pazifische Wissenschaft, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 29–44.
von Hoorn, Tanja: Dem Leibe abgelesen. Georg Forster im Kontext der physischen Anthropologie des 18. Jahrhunderts, Tübingen 2004.
Kaeppler, Adrienne: Die ethnographischen Sammlungen der Forsters aus dem Südpazifik. Klassische Empirie im Dienste der modernen Ethnologie, in: Klenke, Claus-Volker (Hrsg.): Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive, Berlin 1994, S. 59–76.
Kalb, Gertrud: Travel Literature Reinterpreted: Robinson Crusoe und die religiöse Thematik der Reiseliteratur, in: Anglia. Zeitschrift für englische Philologie 101 (1983), S. 407–420.
Moennighoff, Burkhard et al., Vorwort, in: Moennighoff, Burkhard et al. (Hrsg.): Literatur und Reise, Hildesheim 2013, S. 5f.
Neubauer, Barbara: Nachtwort, in: Forster, Georg: Reise um die Welt, hrsg. von Barbara Neubauer, Berlin 1960, S. 635–652.
Ortheil, Hanns-Josef: Schreiben und Reisen. Wie Schriftsteller vom Unterwegs-Sein erzählen, in: Moennighoff, Burkhard et al. (Hrsg.): Literatur und Reise, Hildesheim 2013, S. 7–31.
Elisabeth Sasso-Fruth: Literarische Aspekte in und um Romance und Mélodie
Elisabeth Sasso-Fruth (Leipzig)
Literarische Aspekte in und um Romance und Mélodie
Phillip Moll zum 70. Geburtstag
Dieser Text basiert auf einem Vortrag an der HMT Leipzig im Rahmen des Studientags Lied-Konzepte um 1800 am 21. Juni 2013. – Übertragungen sämtlicher französischer Texte ins Deutsche: Elisabeth Sasso-Fruth.
1. Musik in der Literatur: zu einem Gespräch in Gustave Flauberts Roman Madame Bovary
 In Gustave Flauberts 1857 erschienenem Roman Madame Bovary findet sich im zweiten Kapitel des zweiten Teils folgender Ausschnitt aus einem Gespräch, das zwischen Madame Bovary, dem Apotheker Homais und dem Notargehilfen Léon, der im Fortgang des Romans zum (zweiten) Liebhaber der Titelheldin werden soll, stattfindet:
In Gustave Flauberts 1857 erschienenem Roman Madame Bovary findet sich im zweiten Kapitel des zweiten Teils folgender Ausschnitt aus einem Gespräch, das zwischen Madame Bovary, dem Apotheker Homais und dem Notargehilfen Léon, der im Fortgang des Romans zum (zweiten) Liebhaber der Titelheldin werden soll, stattfindet:
– Ces spectacles [des paysages de montagnes] doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l’extase! Aussi je ne m’étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d’aller jouer du piano devant quelque site imposant.
– Vous faites de la musique? demanda-t-elle.
– Non, mais je l’aime beaucoup, répondit-il.
– Ah! Ne l’écoutez pas, madame Bovary, interrompit Homais en se penchant sur son assiette, c’est modestie pure. – Comment, mon cher! Eh! L’autre jour, dans votre chambre, vous chantiez L’ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire; vous detachiez cela comme un acteur.
Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage, sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire […].
Emma reprit:
– Et quelle musique préférez-vous?
– Oh! La musique allemande, celle qui porte à rêver.
– Connaissez-vous les Italiens?
– Pas encore; mais je les verrai l’année prochaine, quand j’irai habiter Paris, pour finir mon droit.[1]
– Diese Anblicke [der Gebirgslandschaften], müssen den Betrachter einfach in Begeisterung versetzen und stimmen ihn zwangsläufig zum Gebet, zur Ekstase! Übrigens wundere ich mich auch nicht mehr über jenen berühmten Musiker, der, um seine Phantasie noch besser anzuregen, die Gewohnheit hatte, sich zum Klavierspielen immer vor irgendeine imposante Landschaft zu begeben.
– Machen Sie selbst eigentlich auch Musik? fragte sie.
– Nein, aber ich liebe sie sehr, antwortete er.
– Ach! Hören Sie nicht auf ihn, Madame Bovary, unterbrach Homais und beugte sich dabei über seinen Teller, das ist doch die reinste Bescheidenheit. – Was sagen Sie denn da, mein Lieber! He! Neulich haben Sie in Ihrem Zimmer einfach hinreißend L’ange gardien gesungen. Ich hörte Sie vom Labor aus, Sie deklamierten das so deutlich wie ein Schauspieler.
Tatsächlich war Léon bei dem Apotheker untergebracht, wo er in der zweiten Etage ein kleines Zimmer hatte, das zum Platz hinaus ging. Das Kompliment seines Hausherrn ließ ihn erröten […].
Emma fragte weiter:
– Und welche Musik bevorzugen Sie?
– Oh! Die deutsche Musik, die, die einen zum Träumen bringt.
– Kennen Sie auch die Italiener?
– Noch nicht, aber ich werde sie nächstes Jahr sehen, wenn ich nach Paris umziehen werde, um meine Jurastudium zu beenden.
Unter vier Aspekten ist hier von Musik die Rede: Da ist zunächst die Pose des vor imposanter Kulisse spielenden berühmten Pianisten, dann die vom Apotheker zufällig belauschte Darbietung von L’ange gardien durch Léon, der sich in seinem Zimmer unbeobachtet wähnte, schließlich werden kurz die »deutsche Musik« und »die Italiener« angetippt.
Zunächst soll L’ange gardien näher betrachtet werden. Der Titel des von Léon gesungenen Stückes ist von Flaubert nicht ganz genau wiedergegeben, er lautet korrekt A mon ange gardien. Es handelt sich um eine Romance aus der Feder von Pauline Duchambge (1776–1858), die Graham Johnson als “France’s first notable woman song composer” bezeichnet.[2] Duchambge war in ihrem Schaffen äußerst produktiv: Zwischen 1816 und 1840 schrieb sie rund 400 Romances. Die Komposition A mon ange gardien entstand um 1825, also zum Ende der Blütezeit der Romance als Salonromanze in Frankreich,[3] die in die Revolutionszeit, unter das Empire und die Restauration fällt. Die Autorschaft des vertonten Textes ist unklar. Doch war dieses Gedicht um 1825 sehr bekannt und beliebt.[4]
2. Analyse von A mon ange gardien von Pauline Duchambge
Faksimile:[5]
A mon ange gardien
Bon ange ô sauvez moi d’une erreur dangereuse,
Je ne veux pas l’aimer, l’amour fait trop souffrir!
Mais il me suit partout je suis bien malheureuse
Comment faire mon ange, hélas! pour le haïr?
Quand il m’ouvre son cœur en vain je le repousse
Il pleure et moi ces pleurs me donnent de l’effroi
Je ne veux pas l’aimer, mais sa voix est si douce
Ô mon ange veillez sur moi!Il m’avait autrefois, donné la tourterelle
Que (je sais pourquoi) je préfère aujourd’hui
Lorsque je la caresse, elle me le rappelle,
Je trouve qu’elle est triste, et douce comme lui
En rêvant l’autre jour, j’interrogeai moi-même
Ces fleurs qui des amants peignent dit-on la foi…
Les fleurs que j’effeuillais disaient toutes je t’aime
Ô mon ange, veillez sur moi.Tous les lieux qu’il chérit, je les chéris de même
La couleur qu’il préfère est la mienne à présent,
Je ne chante jamais que la chanson qu’il aime
J’adopte tous les mots qu’il répète souvent
Je conserve toujours la fleur qu’il m’a donnée
Elle est là sur mon cœur… et cependant je crois
Que depuis bien long tems cette fleur est fanée
Ô mon ange veillez sur moi.(Transkription nach dem Manuskript ohne Korrektur von Interpunktion und Rechtschreibung)
An meinen Schutzengel
Guter Engel, oh rette mich vor einem gefährlichen Fehler,
Ich möchte ihn nicht lieben, Liebe bedeutet zu viel Leid!
Doch er folgt mir überall hin, ich bin ziemlich unglücklich,
Was soll ich nur tun, mein Engel, ach! um ihn zu hassen?
Wenn er mir sein Herz öffnet, dann weise ich ihn vergeblich zurück,
Er weint und mich, mich erschrecken diese Tränen,
Ich möchte ihn nicht lieben, aber seine Stimme ist so sanft,
Oh, mein Engel, wache über mich!Er hatte mir einst die Turteltaube geschenkt,
die (ich weiß wohl, warum) ich heute am liebsten habe,
Wenn ich sie liebkose, erinnert sie mich an ihn,
Ich finde, dass sie so traurig und so sanft ist wie er.
Neulich ging ich im Traum in mich
Diese Blumen, von denen es heißt, sie stünden für die Treue der Liebenden…
Die Blumen, die ich abzupfte, sagten alle: ich liebe dich.
Oh, mein Engel, wache über mich.All die Plätze, die ihm so lieb sind, sind auch mir so lieb,
Seine Lieblingsfarbe ist gerade auch die meine,
Ich singe immer nur das Lied, das er so gerne hat,
Ich sage die gleichen Worte, die er so oft ausspricht,
Ich habe noch immer die Blume, die er mir geschenkt hat,
Sie ist da, auf meinem Herzen… und doch glaube ich
Dass diese Blume schon seit langer Zeit verwelkt ist.
Oh, mein Engel, wache über mich.
2.1. Literarische Analyse von A mon ange gardien in Hinblick auf gattungstypische Merkmale der Romance
2.1.1. Aufbau und Metrik
Entsprechend der Tradition der Romance ist die vorliegende Komposition in Strophenform verfasst. Eher untypisch ist der Verzicht auf einen Refrain, doch bei »Pauline Duchambge gibt es in der Regel keine Refrains.«[6] Außerdem erinnert der Endvers der drei Strophen, der immer denselben Wortlaut aufweist, entfernt an dieses Gattungsmerkmal.
Der Wechsel von männlichen und weiblichen Versen und das alternierende Reimschema erfolgen mit Regelmäßigkeit. Diese kennzeichnet auch die Versabfolge innerhalb der Strophen: auf sieben Alexandriner folgt immer ein Achtsilbler. Mit den Alexandrinern und den Achtsilblern kommen in diesem Gedicht zwei der klassischen französischen Verse zur Anwendung, die hier auch beide genau in der Mitte zäsiert sind (also der Alexandriner nach der sechsten, der Achtsilbler nach der vierten Silbe). Nur eine einzige Abweichung weist das Manuskript in der sonst so regelmäßigen Metrik auf, nämlich im zweiten Vers der zweiten Strophe, die aus einem Elfsilbler besteht. Vermutlich liegt allerdings hier ein Versehen vor und es wurde einfach ein ne vergessen: « Que (je ne sais pourquoi) je préfère aujourd’hui ». Dann würde die Aussage in der Klammer verneint: »die (ich weiß nicht warum) ich heute am liebsten habe«. Diese Verneinungspartikel würde nicht nur dem Versschema durchgängig zur Regelmäßigkeit verhelfen, sondern auch inhaltlich besser zur ›Psychologie‹ der Sprecherin in diesem Gedicht passen (siehe unten). Insgesamt lässt sich feststellen, dass die metrischen Strukturen des Textes keine Überraschungen bergen. Dies erleichtert und fördert die Einprägsamkeit des Textes.
2.1.2. Inhalt und sprachliche Aspekte
Das für die Romance typische sentimentale Sujet[7] des Gedichtes lässt sich folgendermaßen kurz zusammenfassen: Ein Mädchen wehrt sich gegen das Gefühl der Liebe, die es für einen Mann empfindet, der ihm ebenfalls in Liebe zugeneigt ist.
Das weibliche lyrische Ich ist offensichtlich noch sehr jung und ›unschuldig‹. Dafür sprechen:
- die gebetartige Hinwendung der Sprecherin in ihrer ›Not‹ an den Schutzengel, den sie um Hilfe bittet (Gesten des Gebets: vgl. I,1 und den sich je wiederholenden Schlussvers)
- die pubertär anmutende Dringlichkeit, mit der sie dies tut (I,1 und I,4: unvermittelte Anrede des Schutzengels, emphatische Interjektion (« hélas! »), die hilflose, litaneiähnliche Selbstüberantwortung an den Schutzengel jeweils im Schlussvers aller drei Strophen)
- das ›Dilemma‹ selbst – denn worin liegt eigentlich das Problem der jungen Frau? Offensichtlich ist die Erfahrung der Liebe für sie neu, ihre Reaktionen auf die Liebesbekundungen des jungen Mannes sind erschreckt und scheinen deshalb hilflos (siehe I,3f. und I,6f.).
- ihr Umgang mit der ›Notsituation‹: Unfähigkeit zur Abstrahierung und Verortung der neuen Erfahrung im eigenen Leben, dieses Liebeserlebnis bleibt ausschließlich auf der Ebene der Emotionen verhaftet. Die umgangssprachliche umständliche Wortstellung in I,6 bildet die emotionale Verwirrung auf sprachlicher Ebene ab.
- Die einzige ›abstrakte‹ Einsicht « l’amour fait trop souffrir » (I,2) scheint mit ihrer fast apodiktischen Gesetztheit eher aus der Überlieferung bzw. einer Spruchsammlung als aus der eigenen Erfahrung der Sprecherin zu stammen. Sie verlässt sich ziemlich unreflektiert auf »Hörensagen« (« dit-on », II,6).
- (Rück)halt und Antworten auf ihre Fragen sucht sie auf metaphysischer Ebene (Schutzengel) und in schlichten (abergläubischen) Volkstraditionen (Abzupfen der Blütenblätter).
Die erste Strophe setzt mit großer emphatischer Geste ein (im ersten Vers: Anrufung des Schutzengels (« Bon ange »); dramatische Bitte um Rettung (« sauvez-moi ») vor einer Gefahr (« dangereuse »), an der sie selbst zumindest eine Mitschuld hat (« erreur »)). Der Zuhörer wird sofort vom Sujet ergriffen und emotional involviert. Außerdem ist die Tatsache, dass das Mädchen hier dem Schutzengel sein Herz ausschüttet, Garantie dafür, dass die Rede des Mädchens – die übrigens auch sprachlich sehr einfach und leicht verständlich ist – absolut aufrichtig und unverfälscht ist. Sie zeugt von der Unverderbtheit des Mädchens, wodurch diesem wiederum die unbedingte Sympathie des Zuhörers sicher ist. Die dramatische Sprechhaltung durchzieht die ganze erste Strophe.
In der zweiten Strophe weicht diese Dramatik der Erinnerung (« autrefois » – Geschenk der « tourterelle » – « l’autre jour ») und der Reflexion (« je m’interrogeai moi-même » – ›Befragen‹ der Blumen, denn die »sagen die Wahrheit über die Liebe«). In der dritten Strophe klopft die junge Frau ihre eigenen Vorlieben (« couleur [préférée] ») und ihr eigenes Verhalten (« chanson » – « mots ») auf Anzeichen für die Seelenverwandtschaft mit dem (verehrten) Verehrer ab. Die Reflexionen und Selbstvergewisserungen sind von großer Schlichtheit und Klischeehaftigkeit und zeichnen insgesamt das Bild eines hochemotionalen und naiven Mädchens, das – dies die Pointe des Gedichtes – sich vielleicht zu lange gegen seine eigenen Gefühle sträubte (« fleur […] fanée »), was die Geschichte für die Protagonistin vermutlich nicht gut ausgehen lässt.
Der Leser, der von Anfang an auf die Denk- und Gefühlsebene des Mädchens gebracht wird, wird emotional in dessen ›Geschichte‹ involviert und kann,wenn er dem Mädchen gegenüber einen Vorsprung an Lebenserfahrung hat und die Situation etwas zu abstrahieren vermag, in der Sprecherin das tragische Opfer ihrer eigenen Unschuld erkennen.
2.2. Musikalische Analyse von A mon ange gardien in Hinblick auf gattungsspezifische Merkmale der Romance
Das Stück A mon ange gardien ist eine Komposition für Gesang mit Klavierbegleitung. Die Melodie ist einfach und weist – wie bei der Romance üblich[8] – keine melodische Überfrachtung auf. Abgesehen von einer einzigen Stelle im vorletzten Takt (die eine Silbe « sur » verteilt sich auf drei Noten) gibt es in dem Stück keine Melismen und keine rhythmischen oder harmonischen Auffälligkeiten. Zwar unterstreicht ein durch Pausen etwas ›bewegterer‹ Rhythmus vor allem in der ersten Strophe den Text an der Stelle « Comment faire, mon ange, hélas, pour le haïr » und lässt sich eine harmonische Auffälligkeit bei dem Auflösungszeichen über dem Wort « Amour » (erste Strophe, zweites System im Manuskript) feststellen, doch tut dies insgesamt der rhythmischen und harmonischen Einfachheit der Komposition keinen Abbruch.
Mit dem Klavier wählt Pauline Duchambge ein für die Romance neben der Gitarre oder Harfe gängiges Begleitinstrument.[9] Obwohl die Begleitung anspruchsvoller als der Gesangspart ist, hält auch diese sich vom Schwierigkeitsgrad her in Grenzen. Es sind keinerlei Bestrebungen nach Unabhängigkeit der Begleitung festzustellen, vielmehr dient die Begleitung – gattungstypisch – dem Gesang.[10]
Auch auf musikalischer Ebene kommt die Strophenform der Verständlichkeit des Textes entgegen, schließlich lässt angesichts der Wiederholung ab der zweiten Strophe das Interesse an der musikalischen Ausformung bzw. der Melodie nach und der Rezipient lenkt seine Konzentration vornehmlich auf den Text.
Die nur einen Vers (acht Silben) umfassende Identität des jeweiligen Schlussverses der drei Strophen ist auch in musikalischer Hinsicht zu kurz, um von einem Refrain sprechen zu können. Doch setzt Duchambge trotz des Verzichtes auf einen Refrain im eigentlichen Sinne in ihrem Stück kunstvoll akustische Wiedererkennungseffekte ein. So ist die Melodie auf den ersten und letzten Alexandriner (also auf den jeweils ersten und siebten Vers einer jeden Strophe) identisch, wobei auf eine minimale rhythmische Differenz hingewiesen sei: punktierte Achtel plus Sechzehntel im ersten Alexandriner vs. zwei Achtel im zweiten Alexandriner. Allerdings ist dieser melodische Abschnitt immer mit einem anderen Text unterlegt.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass mit A mon ange gardien ein auf Emotionalität abzielendes Stück vorliegt, das sowohl auf der Textebene als auch in der musikalischen Bearbeitung dem Ideal der Einfachheit und Schlichtheit verpflichtet ist. Die Komposition ist intelligent, stellt aber weder an den Sänger noch an den Begleiter allzu hohe Ansprüche und ist somit relativ einfach auszuführen.
3. Die Romance im 18. Jahrhundert
Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei A mon ange gardien um eine Romance. Als musikalische Gattung beschäftigte diese bereits im 18. Jahrhundert die Theoretiker. Vor dem Hintergrund der im zweiten Abschnitt der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Analyse des Stückes von Pauline Duchambge seien hier als Folie die Definitionen der Romance in der Encyclopédie von Diderot und d’Alembert (1765) und aus dem Dictionnaire de musique von Rousseau (1768)angeführt:
Vieille historiette écrite en vers simples, faciles et naturels. La naïveté est le caractère principal de la romance […]. Ce poème se chante et la musique française, lourde et niaise, est, ce me semble, très propre à la romance.[11]
Alte Anekdote, geschrieben in schlichten, einfachen und natürlichen Versen. Die Unbefangenheit ist das Hauptmerkmal der Romance […]. Dieses Gedicht wird gesungen und die französische Musik, die plump und einfältig ist, scheint mir für die Romance sehr geeignet zu sein.
ROMANCE. Air sur lequel on chante un petit poème du même nom, divisé par couplets, duquel le sujet est pour l’ordinaire quelque histoire amoureuse et souvent tragique. Comme la romance doit être inscrite d’un style simple, touchant, et d’un goût un peu antique, l’air doit répondre au caractère des paroles; point d’ornements, rien de maniéré, une mélodie douce, naturelle, champêtre, et qui produise son effet par elle-même, indépendamment de la manière de la chanter […] quelquefois on se retrouve attendri jusqu’aux larmes sans pouvoir dire où est le charme qui a produit cet effet. […] Il ne faut, pour le chant de la romance, qu’ une voix juste, nette, qui prononce bien, et qui chante simplement.[12]
ROMANCE. Weise, nach der man ein kleines Gedicht mit derselben Bezeichnung singt, das in Couplets unterteilt ist und dessen Sujet gewöhnlich irgendeine Liebesgeschichte ist, die oft tragisch verläuft. Da die Romance in einem einfachen, anrührenden und etwas altertümlichen Stil verfasst sein soll, muss die Weise dem Charakter der Worte entsprechen; keine Verzierungen, nichts Manieriertes, eine sanfte, natürliche, ländliche Melodie, die ihre Wirkung aus sich selbst heraus erzielt, unabhängig von der Art, wie sie gesungen wird […] manchmal ist man am Schluss zu Tränen gerührt und vermag aber nicht einmal zu sagen, wo der Reiz zu suchen wäre, der diese Wirkung erzielte. […] Für das Singen einer Romance bedarf es lediglich einer natürlichen, klaren Stimme, die gut ausspricht und einfach nur singt.
Auch wenn diese beiden Definitionen noch aus der Zeit vor der »sentimentalen Salonromanze«[13] stammen, die 1783 mit Giovanni Paolo Martinis Plaisir d’Amour[14] begründet wird und der, wie bereits erwähnt, auch A mon ange gardien noch zuzurechnen ist, sind die wesentlichen Charakteristika der Romance bereits benannt. Rousseau – der übrigens auch selbst Romances komponierte[15] und so aktiv zur Herausbildung des Genres beitrug – hält klar fest, dass sich die Musik (und zwar sowohl die Vertonung als auch die Ausführung) nach dem Gedicht zu richten und sich also diesem unterzuordnen habe. Es geht vor allem darum, Emotionen und das Sujet zu befördern. Der Primat des Textes und des Sujets erklärt auch, warum Rousseau auf die deutliche Aussprache großen Wert legt. In dem eingangs angeführten Zitat aus Flauberts Roman tut dies übrigens auch der Apotheker Homais, der zufällig Zeuge von Léons Darbietung des Ange Gardien wurde, lobt er diesen doch vor allem dafür, dass er alles so deutlich wie ein Schauspieler ausgesprochen habe.
4. Die Romance in Flauberts Madame Bovary
Selbstverständlich ist es problematisch, Romanfiguren als verlässliche Garanten für die Rezeption der Romance heranzuziehen, insbesondere wenn sie, wie in diesem Falle der Apotheker Homais in Flauberts Roman, ironisch gebrochen sind. Ihr in der Immanenz des Romans geäußertes Urteil muss dem des Erzählers (und des Autors) sowie dem der Wissenschaft bzw. Musikwissenschaft gegenübergestellt werden und sich hinsichtlich objektiver Aussagen über die musikalische Gattung der Romance behaupten.
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine zweite Stelle aus Madame Bovary, an der von der Romance die Rede ist. Sie befindet sich im sechsten Kapitel des ersten Teils von Madame Bovary, das rückblickend von der Erziehung der Klosterschülerin Emma handelt. Diese verschlang in ihrer Jugend nicht nur begeistert romantische Lektüren (etwa aus der Feder von Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand oder Walter Scott, um nur einige zu nennen), auch der Musikunterricht bot ihr vielerlei Anregungen:
A la classe de musique, dans les romances qu’elle chantait, il n’était question que de petits anges aux ailes d’or, de madones, de lagunes, de gondoliers, pacifiques compositions qui lui laissaient entrevoir, à travers la niaiserie du style et les imprudences de la note, l’attirante fantasmagorie des réalités sentimentales.[16]
Im Musikunterricht war in den Romances, die sie sang, nur von kleinen Engeln mit goldenen Flügeln, von Madonnen, von Lagunen, von Gondolieri die Rede, friedselige Kompositionen, die sie durch die Albernheit des Stils und die Unzulänglichkeiten der Vertonung das verlockende Wahngebilde der Wirklichkeit der großen Gefühle erahnen ließ.
Während sich in dem zuerst angeführten Zitat aus dem Roman, dem Gespräch zwischen Madame Bovary, Léon und Homais, die Romanfiguren in direkter Rede quasi ›ungefiltert‹ äußerten, ergreift bei der Schilderung des Musikunterrichts Emmas, der späteren Madame Bovary, der Erzähler (der nicht mit dem Autor zu verwechseln ist!) das Wort. Angefangen von der Lexik – hier wird beispielsweise der Gattungsbegriff Romance verwendet und diese ziemlich ›komplex‹ beschrieben – bis hin zu der scharfsinnigen Analyse der Auswirkung des Musikunterrichts auf die Protagonistin entspricht dabei nichts dem Sprechen und Denken Emmas; das vernichtende Urteil des Erzählers über die »alberne« Romance richtet sich noch im selben Satz ironisch ebenso vernichtend gegen die Titelheldin.[17] Denn diese, nach Emotionen lechzend, nimmt unter anderem diese triviale Musikform mit ihren abgedroschenen, kitschigen und klischeehaften Themen (man beachte den Plural bei « anges » – « madones » – « lagunes » – « gondoliers ») zum Vorbild und erkennt darin die Ideale, an denen sie ihr späteres Leben ausrichten wird: ein Unterfangen, das, für den Erzähler wie für den Leser kaum verwunderlich, zwangsläufig zum Scheitern führen muss.
Somit bildet die Stelle über den Musikunterricht aus dem ersten Teil von Madame Bovary die Folie, vor der das Gespräch Emmas mit Léon über die Musik im zweiten Teil gelesen werden muss. Bei diesem Gespräch finden sich zwei Seelenverwandte – und tatsächlich wird diese Begegnung auch bestimmend für das weitere, verhängnisvoll verlaufende Romangeschehen.[18]
Die Tatsache, dass sowohl Emma als auch Léon in der Lage sind, eine Romance zu singen, sei es im privaten Kontext oder dem des Musikunterrichts, kann als Indiz dafür verstanden werden, dass die Romance auch für Laien ohne Schwierigkeiten nachzusingen ist. Tatsächlich stellte die Romance, wie bereits erwähnt, grundsätzlich keine allzu hohen Anforderung an den oder die ›Interpreten‹. Große Ansprüche an die ausführenden Künstler zu stellen, lag übrigens auch Pauline Duchambge fern. Der Komponistin, die selbst Gesangsunterricht gab,
ging es [nämlich] […] nicht darum, Sänger für die Bühne oder die großen Salons auszubilden, sondern die Kunst zu vermitteln, « à chanter simplement, pour le charme intime et pour le timide écho de la maison » [»schlicht zu singen, um den intimen Charme und das schüchterne Echo des Hauses einzufangen«].[19]
Die Bekanntheit der Romance auch in ländlichen Gegenden ist oft gerade Laiensängern zu verdanken, die die Stücke in der Provinz darboten. Und so ist es wenig erstaunlich, dass Léon in der nahe Rouen gelegenen kleinen – fiktiven – Ortschaft Yonville imstande ist, solch eine Romance nachzusingen, und der Apotheker diese auch sofort wiedererkennt. Dies spricht für den hohen Bekanntheitsgrad von A mon ange gardien im Speziellen und der Romance im Allgemeinen.
5. « La musique allemande » – das deutsche Lied
Im eingangs angeführten Zitat aus Madame Bovary kommt die Musik in der Unterhaltung zwischen Madame Bovary, Léon und Homais, wie bereits erwähnt, in mehreren Aspekten zur Sprache. Auf Emmas Frage hin erklärt Léon, ohne die Gattung zu bezeichnen, « la musique allemande, celle qui porte à rêver » – also »die deutsche Musik, die, die einen zum Träumen bringt« – zu seiner Lieblingsmusik.[20] Dass er die Gattung nicht benennen kann, entbehrt nicht der Ironie, wodurch die im Gespräch befindlichen Figuren bloßgestellt werden. Die zur Schau gestellte Kunst- bzw. Musikbeflissenheit Léons findet nämlich nicht eigentlich die ›richtigen‹ Worte, was ein Indiz dafür ist, dass die Begeisterung des jungen Mannes oberflächlich und letztlich dem Halbwissen verhaftet ist. Selbst der « musicien célèbre » bleibt in Léons Diskurs namenlos. Dessen Geste (Klavierspiel vor imposanter Landschaft) ist als eine Äußerung des ungebändigten romantischen Genies zu verstehen und sollte als solche die Einzigartigkeit und Individualität des berühmten Künstlers unterstreichen. Doch die Tatsache, dass dessen Identität nicht gelüftet wird (von Léon nicht gelüftet werden kann?), entlarvt diese ausholende Geste als ein klischeehaftes Versatzstück der (Selbst-?)Inszenierung eines Künstlers, den Léon vor Augen hat und den er womöglich überschätzt. – Léons Gesprächspartnerin Emma scheint nicht aufzufallen, dass die Äußerungen Léons unzulänglich, lückenhaft und somit fast nichtssagend sind. Sie nimmt daran keinen Anstoß, im Gegenteil signalisiert sie durch ihre Einwürfe, dass Léons Rede ihr Interesse geweckt hat. Allerdings sind ihre Nachfragen unqualifiziert und tragen nicht zur Vertiefung des Gegenstandes bei, vielmehr lösen sie – von Emma unbeabsichtigt – komische Effekte aus. So führt sie beispielsweise gerade durch ihre unvermittelte Frage nach Léons musikalischen Aktivitäten (« Vous faites de la musique ? ») einerseits die spektakuläre Geste des großen Künstlers (Pianist) und andererseits die Intimität, in der der Laie Léon sich – vermeintlich unbelauscht – künstlerisch äußert, auf engsten Raum zusammen, was den ohnehin schon vorhandenen komischen inhaltlichen Kontrast der beiden Szenerien noch weiter verschärft.
Gemeint ist mit jener « musique allemande » das deutsche Lied der Romantik, vor allem Franz Schuberts,[21] das seit 1833 in Frankreich zunehmend bekannt wurde. Allein zwischen 1840 und 1850 wurden über 300 deutsche Lieder in Frankreich veröffentlicht.[22] Mit der Verbreitung des deutschen Liedes ging in Frankreich die Erschütterung der Salonmusik einher, untergrub es doch mit seinen neuen Maßstäben die Grundfesten der Romance.[23] So kam der Dramatiker Ernest Legouvé in seinem 1837 in der Revue et Gazette musicale publizierten Artikel Mélodies de Schubert zu der Feststellung: “[Schubert] has killed the French romance”.[24] Allerdings hielten die Befürworter der Romance in der Zeitschrift La France musicale dagegen “that the mélodie[25] will not kill our romance because the French romance also has its value”.[26]
Wie ist diese dramatische Entwicklung zu erklären und welche Folgen zeitigte sie? Was das deutsche Lied gegenüber der in Frankreich so verbreiteten Romance auszeichnete, ist die Bedeutung, die es der Begleitung beimaß. Diese wurde von den Komponisten der Romance so gering geschätzt, dass es durchaus möglich war, darauf sogar völlig zu verzichten und nur die Solostimme einzusetzen. Während also bei der Romance der Text und damit auch der – deklamierende! – Gesang im Mittelpunkt des Interesses steht, geht der Gesang im deutschen Lied, vor allem bei Schubert, mit dem Klavier eine derart enge Symbiose ein, dass Sänger und Pianist fast zu ein und demselben Interpreten verschmelzen, um sinngemäß Schubert über seine Aufführungen mit Vogl zu zitieren,[27] ja die Aufwertung des Klavierparts kann sogar zur Priorität des Instruments gegenüber der Stimme führen.
Dem deutschen Lied wurde in ganz Frankreich – auch in der Provinz[28] – große Bewunderung entgegengebracht, doch übernahmen die Franzosen, so Marie-Claire Beltrando-Patier, diese seine Eigenheiten nicht. Tatsächlich sei nämlich die französische Vokalmusik seit jeher sehr auf das Wort bezogen gewesen, so dass jegliche musikalische Vorgehensweise wie beim deutschen Lied suspekt erscheinen musste. Das Lied, so Marie-Claire Beltrando-Patier weiter, sei in Frankreich also niemals nachgeahmt oder kopiert worden, vielmehr habe es den Wunsch nach etwas anderem ausgelöst, den dann die Mélodie erfüllen sollte.[29]
6. Die Anfänge der Mélodie
6.1. Hector Berlioz
Hector Berlioz war der erste, der eigene Kompositionen mit dem Gattungsbegriff mélodie bezeichnete.[30] Doch sehen moderne französische Musikhistoriker die Verwendung dieses Begriffes hinsichtlich der Kompositionen von Berlioz nicht immer eindeutig gerechtfertigt. So schreibt etwa Marie-Claire Beltrando-Patier:
[Les] caractères propres à la romance constituent […] le fondement du goût français en matière de musique vocale. Les grands mélodistes le savent et restent observateurs d’une intelligibilité parfaite. Pour cette raison, les débuts de la mélodie auront quelque chose de la romance, et il est difficile de dire […] que brusquement, Berlioz a abandonné la romance populaire pour […] la mélodie.[31]
[Die] Merkmale der Romance bilden […] die Grundlagen des französischen Geschmackes hinsichtlich der Vokalmusik. Die großen Komponisten der Mélodie wissen dies und achten auf eine perfekte Verständlichkeit. Aus diesem Grund haben die Anfänge der Mélodie etwas von der Romance an sich, und es lässt sich nicht einfach sagen, dass Berlioz plötzlich die populäre Romance […] zugunsten der Mélodie aufgegeben hat.
Auch Les Nuits d’été (1841) von Berlioz seien nicht eindeutig oder ausschließlich der Gattung der mélodie zuzuordnen, vielmehr bewege sich der Komponist hier zwischen einer legitimen Suche nach Neuem und der Natürlichkeit, die man von einer Romance erwarten könne.[32]
6.2. Louis Niedermeyer – Le Lac
Camille Saint-Saëns sieht in der Einleitung zu Vie d’un compositeur moderne (Paris 1893) Louis Niedermeyer als den ersten Komponisten von Mélodies:
[le premier, Niedermeyer a] brisé le moule de l’antique et fade romance française en s’inspirant de beaux poèmes de Lamartine et de Victor Hugo, et créé un genre nouveau d’un art supérieur, analogue au Lied allemand; le succès retentissant du Lac a frayé le chemin à M. Gounod et à tous ceux qui l’ont suivi dans cette voie.[33]
[Niedermeyer hat als erster] die Form der althergebrachten und faden französischen Romance zerbrochen, indem er sich an schönen Gedichten von Lamartine und Victor Hugo inspirierte, und hat so eine neue Gattung von höherer Kunst geschaffen, die dem deutschen Lied entspricht; der durchschlagende Erfolg von Le Lac hat Herrn Gounod den Weg geebnet, sowie auch all denen, die ihm auf diesem Pfad gefolgt sind.
Tatsächlich wird die Komposition Le Lac von Niedermeyer aus dem Jahr 1821 oder 1825[34] nach einem Text von Lamartine oftmals als der Beginn der mélodie in Frankreich bezeichnet. Doch stellt sich die Frage, ob tatsächlich die Vertonung einer qualitativ besseren Textvorlage (Lamartines Méditations von 1820, aus denen Le Lac stammt, gelten als der Prototyp der frühromantischen Dichtung in Frankreich, Victor Hugo, von dem im Zitat ebenfalls die Rede ist, als einer der größten romantischen Dichter Frankreichs) schon ausreicht, um von einer neuen Gattung der Vokalmusik sprechen zu können, wie es das Zitat von Saint-Saëns suggeriert. Und so spricht der Musikhistoriker Frits Noske Niedermeyer auch die Ehre ab, der Begründer der Mélodie zu sein:
Niedermeyer cannot accurately be called the creator of the mélodie. Basically his songs are still romances, even though distinguished form their dull contemporaries by the superior quality of the text, by structural changes, by a closer relationship between words and music, and by the relative importance of the accompaniment.[35]
Genau genommen kann Niedermeyer nicht als der Schöpfer der mélodie bezeichnet werden. Im Grunde sind seine Lieder noch Romances, auch wenn sie sich von den faden zeitgenössischen Kompositionen durch die höhere Textqualität, Veränderungen der Struktur, eine engere Beziehung zwischen Wort und Musik und durch die relative Bedeutung der Begleitung absetzen.[36]
6.3. Romance vs. mélodie (vs. Lied)
Wo sind also die Grenzen zu ziehen zwischen Romance, Mélodie (und Lied), wie ist deren Verhältnis zueinander? Hierzu ein Zitat von Marie-Claire Beltrando-Patier:
En fait, si romance et mélodie – et même lied, pourrait-on ajouter – répondent à la même définition de poème chanté pour voix soliste, il s’agit de catégories d’art différentes, sans hiérarchie dans les valeurs. La romance se présente comme un produit de grande consommation, répondant au goût bourgeois du début du XIXe siècle. […] [Elle] sera cultivée avec bonheur jusque vers 1870. On peut compter parmi ses chefs-d’œuvre quelques-unes des mélodies du 1er Recueil de Fauré, œuvres déjà très raffinées, voire « fauréennes », comme Mai (1862).
Vers 1870 se developpe la mélodie […]. A la base de ce changement se situe le renouveau poétique créé par les Parnassiens, […] hostile aux épanchements romantiques […].[37]
Obschon sich Romance und Mélodie – und selbst das Lied ließe sich hier einreihen – gleichermaßen als gesungenes Gedicht für Solostimme definieren lassen, handelt es sich dabei in Wirklichkeit doch um unterschiedliche Kunstkategorien (Gattungen), ohne dass diese Unterscheidung mit einer Wertehierarchie einherginge. Die Romance präsentiert sich als ein Produkt für den Massenkonsum, sie entspricht dem bürgerlichen Geschmack zu Beginn des 19. Jahrhunderts. […] [Sie] wird bis um 1870 gepflegt werden und sich großer Beliebtheit erfreuen. Zu ihren Meisterwerken können einige der Mélodies aus der Ersten Sammlung (1er Recueil) von Fauré gezählt werden, dabei sind diese Werke bereits sehr kunstvoll gestaltet, ja sogar Fauré-typisch, wie etwa Mai (1862).
Um 1870 entwickelt sich dann die Mélodie […]. Am Beginn dieser Veränderung steht die Erneuerung der Dichtung durch die Parnassiens, […] die den romantischen Gefühlsergüssen ablehnend gegenüber standen […].
Wo auch immer also die Kritik die Anfänge der mélodie verortet – ob schon bei Niedermeyer um 1820, bei Berlioz zwischen 1830 und 1841, oder erst um 1870, etwa vor dem Hintergrund des neuen Schaffensstils Faurés, wird doch ein Kriterium konstant als ausschlaggebend herangezogen: die Wechselwirkung der Entwicklung auf dem Gebiet der Musik mit der Literatur. Sei es, dass die Wahl des Komponisten auf ›bessere‹ Dichter fällt (beispielsweise bei Niedermeyer: Lamartine, bei Fauré die Abwendung von Hugo und Hinwendung zu Baudelaire), oder ein Neuanfang in der Literatur – nämlich die literarische Strömung der Parnassiens, die in ihrer Dichtung und ihren Theorien um die Jahrhundertmitte die romantische Poesie endgültig hinter sich lassen wollten[38] – letztlich die Komponisten zu musikalischem Experimentieren veranlasste und zur Herausbildung der mélodie führte: Die Entwicklung der Solo-Vokalmusik ist im Frankreich des 19. Jahrhunderts nicht ohne den Einfluss der Literatur zu denken. Der enge Bezug zwischen Entwicklungen in der Literatur und der Vokalmusik ist ein prägendes Phänomen, das sich in Frankreich auch im 20. Jahrhundert intensiv fortsetzen wird. Stellvertretend für viele sei hier Poulenc angeführt, der, neben anderen (auch älteren) Dichtern, vor allem Texte von Apollinaire und Eluard vertonte. Wie eng sich dieser Komponist des 20. Jahrhunderts den beiden mit ihm befreundeten Poeten in seinem Schaffen verbunden und verpflichtet weiß, geht aus seinem 1945 geäußerten Wunsch für die Aufschrift seines Grabsteins hervor:
Si l’on mettait sur ma tombe: « Ci-gît Francis Poulenc, le musicien d’Apollinaire et d’Eluard », il me semble que ce serait mon plus beau titre de gloire.[39]
Wenn auf meinem Grabstein stünde: »Hier ruht Francis Poulenc, der Musiker von Apollinaire und Eluard«, dann wäre dies, so scheint mir, mein schönster Ruhmestitel.
Exkurs:
Emma Bovary in der Oper
Die ausführlichste Thematisierung eines Musikerlebnisses in Madame Bovary stellt die Schilderung eines Opernabends dar, die das gesamte fünfzehnte Kapitel des zweiten Teils des Romans umfasst. Auf dem Programm steht die französische Adaption von Donizettis Lucia di Lammermoor, die Emma in Begleitung ihres Mannes im Theater von Rouen besucht. Wie auch an den anderen Stellen, in denen die Musik eine Rolle spielt, geht es Flaubert hier nicht etwa um eine Auseinandersetzung mit der Kunst eines Donizetti, vielmehr ist die Beschreibung des Opernabends funktional auf die Beobachtung des Verhaltens des Publikums und dabei insbesondere der Reaktionen der Titelheldin und ihres Gatten sowie auf die Ironisierung von Künstler und Kunstbetrieb ausgerichtet.
Die Opernaufführung wird ausschließlich entweder aus der Sicht eines x-beliebigen durchschnittlichen Theaterbesuchers oder aus dem Blickwinkel Emmas und ihres Mannes Charles beschrieben; dem der Oper Donizettis nicht kundigen Leser von Madame Bovary erschließt sich das Werk Donizettis aus der Romanlektüre kaum bis gar nicht. Sehr zum Ärgernis seiner Frau versteht Charles, der fast als eine Karikatur des bürgerlichen Opernpublikums angesehen werden kann, gar nichts von der Opernhandlung (die – nicht nur für ihn – sehr viel mehr im Zentrum des Interesses steht als die Musik), trotzdem findet er zunehmend Gefallen an der Aufführung und will im dritten Akt auf die Frage Léons hin die Vorstellung nicht vorzeitig verlassen:
Ah! pas encore! restons! dit Bovary. Elle a les cheveux dénoués: cela promet d’être tragique.[40]
Ach! noch nicht! Bleiben wir doch noch! sagte Bovary. Ihre Haare haben sich gelöst: sieht so aus, als könnte das noch tragisch werden.
Emma dagegen fühlt sich mit Beginn der Aufführung in die Welt ihrer Jugendlektüren versetzt:
Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott.[41]
Sie fühlte sich in ihre Jugendlektüren zurückversetzt, mitten in Walter Scott.
Da sie Walter Scotts Roman, der als Textvorlage für das Libretto diente, als junges Mädchen gelesen hatte, kann sie der Handlung im Gegensatz zu ihrem Mann mühelos folgen. Ab dem Auftritt des Tenors Lagardy in der Rolle des Edgar parallelisiert sie das Bühnengeschehen mit ihren eigenen Erfahrungen in der Liebe:
Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir.[42]
Sie erkannte ein jedes Gefühl der Trunkenheit und der Angst wieder, an denen sie fast gestorben wäre.
Letztendlich stellt sie die große Diskrepanz zwischen der übergroßen – idealen – Liebe der Opernfiguren und ihrem eigenen enttäuschenden Liebesleben fest:
Mais personne sur la terre ne l’avait aimée d’un pareil amour.[43]
Doch niemand auf der Welt hatte ihr je solch eine Liebe entgegengebracht.
Ohne den Sänger von seiner Rolle zu unterscheiden, phantasiert sie sich in der Folge in eine Liebesbeziehung mit dem Tenor, wobei sich dieses Traumbild für Emma auch schon in Wirklichkeit umzusetzen scheint:
[…] entraînée vers l’homme par l’illusion du personnage, elle tâcha de se figurer sa vie, cette vie retentissante, extraordinaire, splendide, et qu’elle aurait pu mener cependant, si le hasard l’avait voulu. Ils se seraient connus, ils se seraient aimés! Avec lui, par tous les royaumes de l’Europe, elle aurait voyagé de capitale en capitale […]; puis, chaque soir, au fond d’une loge, […] elle eût recueilli, béante, les expansions de cette âme qui n’aurait chanté que pour elle seule; de la scène, tout en jouant, il l’aurait regardée. Mais une folie la saisit: il la regardait, c’est sûr![44]
[…] durch die Illusion der Rolle fühlte sie sich zu diesem Manne hingezogen und versuchte, sich sein Leben vorzustellen, dieses aufsehenerregende, außergewöhnliche, glanzvolle Leben, das auch sie hätte führen können, wenn der Zufall es so gewollt hätte. Sie hätten sich kennengelernt, sie hätten sich geliebt! Mit ihm zusammen wäre sie durch alle Königreiche Europas von Hauptstadt zu Hauptstadt gereist […]; schließlich hätte sie jeden Abend ganz hinten in einer Loge […] mit weit aufgerissenem Mund die Ergüsse dieser Seele, die nur für sie ganz allein gesungen hätte, in sich aufgenommen; von der Bühne aus hätte er sie während des Spiels angeblickt. Doch ein Wahn ergriff sie: er blickte sie an, ja, ganz sicher!
Der von Emma bewunderte und angehimmelte Tenor scheint allerdings offensichtlich nicht nur von ihr überschätzt zu werden und in Wirklichkeit alles andere als ein überragender Künstler zu sein, der noch dazu einen Gutteil seiner künstlerischen Anerkennung beim Publikum seinen Liebesabenteuern verdankt. Dieser Umstand trägt zusätzliche zur Steigerung der Ironisierung der Figur der Emma bei und verleiht ihren Träumen schon fast tragische Züge. Nicht zuletzt wird dabei auch ein kritisch-ironisches Licht auf den Künstler und den Kunstbetrieb der Zeit geworfen:
[…] cette célébrité sentimentale ne laissait pas que de servir à sa réputation artistique. […] Un bel organe, un imperturbable aplomb, plus de tempérament que d’intelligence et plus d’emphase que de lyrisme, achevaient de rehausser cette admirable nature de charlatan, où il y avait du coiffeur et du toréador.[45]
[…] die Berühmtheit, zu der er aufgrund seiner Liebesabenteuer gelangt war, trug beständig zu seinem künstlerischen Ansehen bei. […] Ein schönes Organ, eine unerschütterliche Selbstsicherheit, mehr Temperament als Intelligenz und mehr Emphase als lyrischer Ausdruck rundeten diese bewundernswerte Natur von einem Scharlatan vollends ab, der auch etwas von einem Friseur und von einem Stierkämpfer an sich hatte.
So wie der allseits bewunderte Sänger hier entzaubert wird, klaffen auch Emmas Lebenswirklichkeit und ihre hochfliegenden Träumen auseinander. Anstatt mit dem Star von Hauptstadt und Hauptstadt zu eilen, sitzt sie in Gesellschaft der örtlichen Bourgeoisie im Theater der Provinzhauptstadt Rouen, anstatt mit dem großen Künstler ihrem öden Eheleben zu entfliehen, begegnet sie im Theater zufällig Léon wieder, der nunmehr in Rouen lebt und mit dem sie in der Folge eine Liebesbeziehung eingehen wird. Durch das Zusammentreffen mit Léon in der Pause zwischen dem zweiten und dritten Akt verliert sie auch vollständig das Interesse am Bühnengeschehen:
[…] elle n’écouta plus […] tout passa pour elle dans l’éloignement […][46]
[…] sie hörte nicht mehr hin […] alles war für sie mit einem Mal entrückt […]
Ihre Phantasien über ein Leben mit dem Tenor werden völlig verdrängt von der Erinnerung an ihre erste Liebe zu Léon, « tout ce pauvre amour si calme et si long, si discret, si tendre »[47] (»diese ganze arme Liebe, die so ruhig und so lang, so diskret, so zärtlich gewesen war«), so dass sie schließlich, dem Vorschlag Léons folgend, in dessen und ihres Mannes Begleitung die Aufführung, die sie gerade noch so hochfliegend hatte träumen lassen, vorzeitig – noch vor dem dramatischen und musikalischen Höhepunkt der Oper, der Wahnsinnsarie Lucias! – verlässt.
Nachweise und Anmerkungen
[1] Gustave Flaubert, Madame Bovary. Mœurs de Province, hrsg. von Claudine Gothot-Mersch, Paris: Garnier 1971, S. 84f.
[2] Graham Johnson und Richard Stokes, A French Song Companion, New York: Oxford University Press 2000, S. 134.
[3] Unabhängig davon, ob die Untersuchungen zur Romance das gesamte 18. Jahrhundert wesentlich einbeziehen, herrscht insgesamt in der Kritik Einhelligkeit darüber, dass Martinis Plaisir d’Amour (1783) einen Meilenstein in der Geschichte der Romance darstellt. Diese Komposition ist in den Worten Gstreins der Auftakt für das Genre der »sentimentalen Salonromanze, die in den folgenden Jahrzehnten das Bild des frz. Salonliedes prägen sollte.« (Rainer Gstrein, Die vokale « romance française » im 18. Jahrhundert, in: Zur Entwicklung, Verbreitung und Ausführung vokaler Kammermusik im 18. Jahrhundert: XXII. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 10. bis 12. Juni 1994, hrsg. von Bert Sigmund, Michaelstein: Stiftung Kloster Michaelstein 1997 (Michaelsteiner Konferenzberichte 51), S. 128). Erst ab 1833 geriet diese in Krise, als das deutsche Lied in Frankreich zunehmend bekannt wurde (Marie-Claire Beltrando-Patier, Romance, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 562; vgl. hierzu auch Abschnitt 5. dieser Untersuchung). Zur zeitlichen Eingrenzung der Romance siehe auch die Standardwerke Frits Noske, French Song from Berlioz to Duparc, übers. von Rita Benton, New York: Dover Publications 1970, Neuauflage 2012; Henri Gougelot, La Romance française sous la Révolution et l’Empire, Melun: Legrand et Fils 1937; Roger Hickman, Romance, in: Grove Music Online (www.oxfordmusiconline.com).
[4] Vgl. Herbert Schneider, Duchambge, in: MGG2P, Bd. 5, Sp. 1495. Der Text dieser Romance wird von der weiterführenden Literatur irrtümlicherweise immer wieder der mit Pauline Duchambge eng befreundeten und von ihr häufig vertonten Dichterin Marceline Desbordes-Valmore zugeschrieben(vgl. beispielsweise Christian Goubault, La musique et les lettres au XIXe siècle, in: Histoire de la France littéraire, Bd. 3, hrsg. von Patrick Berthier und Michel Jarrety, Paris: PUF 2006, 32009, S. 561). Diese hat auch tatsächlich ein Gedicht mit dem Titel L’ange gardien (!) verfasst, allerdings wurde dieses Gedicht nicht vertont. Bei der Vertonung des aus unbekannter Feder stammenden Textes wirkte aber eine Dichterin an der Seite Pauline Duchambges mit, nämlich Amable Tastu (vgl.Johnson/Stokes,S. 134f.). Hinter dem Pseudonym verbirgt sich Sabine Casimire Amable Voïart (1798–1885).
[5] Nach dem Digitalisat auf http://archive.org/details/monangegardien830duch.
[6] Claudia Schweitzer, Pauline Duchambge (http://mugi.hfmt-hamburg.de/A_lexartikel/lexartikel.php?id=duch1776).
[7] Zu weiteren typischen Sujets in der Romance siehe Gougelot, S. 24–88. Er unterscheidet folgende Romance-Typen nach inhaltlichen Aspekten: Romances historiques – pastorales – sentimentales (historische – pastorale – sentimentale Romances). Ferner differenziert er die Romances nach ihrer Darbietung in Romances narratives – dramatiques – lyriques (narrative – dramatische – lyrische Romances).
[8] Zu den Gattungsmerkmalen siehe z. B. Beltrando-Patier, Romance, S. 559.
[9] Vgl. Hickman.
[10] Beltrando-Patier, Romance, S. 559.
[11] Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d’Alembert: Romance, in: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (online über http://fr.wikisource.org).
[12] Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique (online über http://www.imslp.org).
[13] Gstrein, S. 128,vgl. auch Anm. 3.
[14] Text: Jean-Pierre Claris de Florian.
[15] Beispielsweise in Le devin du village (Intermède, 1752); hier wird der Begriff Romance (die Romance des Colin, achte Szene, Textanfang: « Dans ma cabane obscure ») erstmals als Liedtitel verwendet (vgl. Gstrein, S. 126). Rousseaus Komposition wurde richtungweisend für die Romance als charakteristischem Bestandteil der Opéra Comique.
[16] Flaubert, S. 39.
[17] Zu Ironiestrategien in der Literatur allgemein und bei Flaubert im Besonderen siehe die Forschungsarbeiten von Rainer Warning: Ironiesignale und ironische Solidarisierung, in: Das Komische, hrsg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning (Poetik und Hermeneutik, Bd. 7), München: Fink 1976, S. 416–423; Ders., Die Phantasie der Realisten, München, Fink 1999, S. 150–184.
[18] In diesem Kontext empfiehlt sich ein kurzer Exkurs zum Begriff Bovarysme, der auch hinsichtlich der Grobstruktur der Romanhandlung aufschlussreich ist. Beim Bovarysme handelt es sich um das nach Flauberts Titelheldin Madame Bovary benannte Motiv des Scheiterns im und Zerbrechens am realen Leben, zu dem es kommt, weil – wie prototypisch in Flauberts Roman dargestellt – Emma an das reale Leben die Maßstäbe anlegt, die sie durch eine überaktive träumerische Einbildungskraft anhand von (romantischen) Lektüre- und anderen ›Kunst‹-Erlebnissen ausgebildet hat. So sind ihre Anforderungen an das reale Leben, das sie mit ihrem unbedeutenden und langweiligen Mann in der Provinz führt, einfach zu hoch; aus Enttäuschung über ihr unausgefülltes Dasein unternimmt sie mehrere Ausbruchsversuche (unter anderem die Liebesaffaire mit Léon). Schließlich endet sie im Selbstmord. Der Begriff geht auf den französischen Philosophen Jules de Gaultier (1858–1942) zurück und findet zur Beschreibung des Handlungsmusters auch bei anderen literarischen Werken Verwendung.
[19] Le Ménestrel, 6. Juni 1858, S. 3, zitiert in Schneider, Sp. 1493.
[20] Kurz darauf kommen Emma und Léon noch auf ein weiteres musikalisches Interessensgebiet zu sprechen: mit der von Emma lapidar als « les Italiens » – »die Italiener« – bezeichneten Musik ist die Gattung der italienischen Oper gemeint. Im Gegensatz zu Romance und Mélodie kann man diese in der Abgeschiedenheit der Provinz (Yonville) unmöglich rezipieren, daher stellt sich hier auch zunächst eher die Frage des Kennens (« Connaissez-vous […] » – »Kennen Sie […]«) als die nach musikalischen Vorlieben. Nicht zuletzt zielt somit Emmas Frage indirekt auch auf die Mobilität und eventuelle soziale Kontakte Léons zur Großstadt ab, nach der sie selbst sich vom Land fortsehnt. – Die italienische Oper feierte im Paris der Zeit, in der Madame Bovary spielt, große Erfolge, einige Opern aus der Feder renommierter italienischer Komponisten (Rossini, Bellini, Donizetti) wurden dort sogar uraufgeführt. Die Opernstoffe entsprachen dem Geschmack Emmas, stammten sie doch beispielsweise von Walter Scott, dessen Werke sie neben anderen in ihrer Jugend verschlungen hatte. Zum Zeitpunkt dieses Gespräches mit Léon war sie selbst allerdings noch nicht in den Genuss eines Opernbesuches in Paris gekommen. Erst sehr viel später im Fortgang des Romans wird sie einer Aufführung der französischen Adaption von Donizettis Lucia di Lammermoor beiwohnen, allerdings nicht in Paris, sondern in der Provinzstadt Rouen (siehe den Exkurs am Ende des Textes).
[21] Auf der romaninternen, inhaltlichen Ebene trifft Léon mit der Präzisierung, »die einen zum Träumen bringt«, ganz den Geschmack der sich nach großen Gefühlen sehnenden Emma Bovary, und gibt sich nicht zuletzt mit diesem Ausdruck als ihr Seelenverwandter zu erkennen. – Darüber hinaus geht jenseits der Immanenz des Romans aus einem Eintrag Flauberts in sein Dictionnaire des Idées reçues hervor, dass er die Deutschen allgemein für »ein Volk von (alten) Träumern hält« (« Allemands : peuple de Rêveurs (vieux) », zitiert in Flaubert, Madame Bovary, S. 456, Anm. 46). Dieses Attribut zielt auf die Romantik deutscher Prägung, als eine deren künstlerischer Ausdrucksformen Schuberts Musik, vor allem sein Liedschaffen, gilt. – Flauberts Roman Madame Bovary ist als Abrechnung mit der Romantik zu lesen, dennoch hat der Autor in seiner Korrespondenz mit befreundeten Schriftstellern immer wieder (und dies durchaus auch selbstironisch) betont, dass er selbst sich der Romantik verpflichtet weiß. Flauberts Verhältnis zur Romantik bleibt also letztlich widersprüchlich.
[22] Vgl. Noske, S. 25ff., und Beltrando-Patier, Romance, S. 562f. Besondere Erwähnung verdient hier der Tenor Adolphe Nourrit, der mit seinen Liederabenden und Übersetzungen der Liedtexte Schuberts wesentlich dazu beitrug, Schubert in ganz Frankreich bekannt zu machen. – Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Entstehungszeit von Madame Bovary. Flaubert hat fünf Jahre, von 1851 bis 1856, intensiv an diesem Stoff gearbeitet, bevor er den Roman ein erstes Mal 1856 in der Zeitschrift Revue de Paris veröffentlichte. Der Text bedeutete einen Skandal, es kam zum Prozess. Aus diesem ging Flaubert als Sieger hervor, und so konnte der Roman 1857 unzensiert in vollem Umfang als Buch erscheinen.
[23] Noske, S. 34.
[24] Zitiert – in englischer Übersetzung – in Noske, S. 34. Vgl. auch Noske, S. 415, Anm. 91 und 85. Ernest Legouvé war mit Berlioz befreundet und arbeitete auch mit diesem zusammen (vgl. Gérard Condé, Hector Berlioz, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 45); so basiert beispielsweise die Komposition La Mort d’Ophélie auf einem Text von Legouvé nach William Shakespeare.
[25] Mit mélodie ist hier das Lied Schuberts gemeint, nicht die Gattung der französischen mélodie. Das Lied Schuberts und seiner Nachfolger bezeichnet man im Französischen heute mit dem deutschen Begriff le lied.
[26] Zitiert – in englischer Übersetzung – in Noske, S. 34.
[27] Zitiert in Beltrando-Patier, Romance, S. 562.
[28] Nourrit gab seine Konzerte auch in der Provinz und macht so das deutsche Lied über die Hauptstadt hinaus bekannt. Vgl. Noske, S. 27ff.
[29] « Le Français apprécie sans la faire sienne cette dernière proposition [de donner la priorité à l’instrument sur la voix]. Il y a en effet dans la musique vocale française une constante référence au verbal qui rend suspecte toute opération musicale de type lied. Le lied ne sera donc jamais imité ou copié, mais déclenchera un désir d’autre chose, que la mélodie viendra combler » (Beltrando-Patier, Romance, S. 563). – »Ohne es sich selbst anzueignen, schätzt der Franzose letzteres [einem Instrument gegenüber der Stimme den Vorzug zu geben]. Es gibt nämlich in der französischen Vokalmusik einen ständigen Bezug zum wortsprachlichen Ausdruck, was jegliche musikalische Operation wie beim Lied verdächtig erscheinen lässt. Das Lied wird also niemals imitiert oder nachgeahmt werden, vielmehr sollte es das Verlangen nach etwas anderem auslösen, das dann die Mélodie einlösen wird.«
[30] Neuf mélodies / imitées de l’anglais (Irish Melodies) / pour une ou deux voix, et chœur / avec acompagnement de piano lautete 1830 der ursprüngliche Titel, den Berlioz später (1849) zu Irlande mit dem Untertitel Neuf mélodies verkürzte (vgl. Condé, S. 47,und Pierre Bernac, The interpretation of French song, übers. von Winifred Radford, London: Kahn & Averill 1997, Nachdruck 2005, S. xiii).
[31] Beltrando-Patier, Romance, S. 560.
[32] Vgl. Condé, S. 45. Noske reiht Berlioz unter die mélodistes ein, allerdings unterteilt er kurioserweise das Mélodie-Œuvre Berlioz in folgende Kategorien: “1. The youthful romances and the Mélodies irlandaises […]. 2. The […] pieces written between 1830 and 1838, and the collection Les nuits d’été, composed about 1840. The evolution from romance to mélodie occurred during this time. 3. The last songs” (Noske, S. 93).
[33] Camille Saint-Saëns, Vie d’un compositeur moderne, Paris 1893, zitiert in Marie-Claire Beltrando-Patier, Louis Niedermeyer, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 476. Diese Stelle wird – gekürzt – auch in Goubault, S. 561, und – in voller Länge auf Englisch – in Noske, S. 12 angeführt.
[34] Die Angaben hinsichtlich des Entstehungsjahrs der Komposition sind widersprüchlich: So wird die Komposition in David Tunley, Romantic French Song 1830–1870, Bd. 1, hrsg. von David Tunley, New York, London: Garland 1994, S. xxviiauf das Jahr 1821datiert; bei Beltrando-Patierdagegen auf 1825 (Beltrando-Patier, Louis Niedermeyer, S. 476).
[35] Noske, S. 12.
[36] Übersetzung aus dem Englischen: Elisabeth Sasso-Fruth.
[37] Marie-Claire Beltrando-Patier, Gabriel Fauré, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 212f.
[38] Der romantischen Gefühlbetontheit (« émotions ») stellten die Parnassiens ihr Ideal der « impassibilité » (Ungerührtheit) gegenüber.
[39] Claire Delamarche, Francis Poulenc, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 488.
[40] Flaubert, S. 233.
[41] Ebd., S. 228.
[42] Ebd., S. 229.
[43] Ebd.
[44] Ebd., S. 231f.
[45] Ebd., S. 229.
[46] Ebd., S. 233.
[47] Ebd.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Beltrando-Patier, Marie-Claire: Romance, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 558–565.
Dies.: Louis Niedermeyer, in: ebd., S. 476–477.
Dies.: Gabriel Fauré, in: ebd., S. 211–230.
Bernac, Pierre: The interpretation of French song, übers. von Winifred Radford, London: Kahn & Averill 1997, Nachdruck 2005.
Condé, Gérard: Hector Berlioz, in: Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994, S. 44–53.
Delamarche, Claire: Francis Poulenc, in: ebd., S. 488–503.
Diderot, Denis, und Jean Baptiste le Rond d’Alembert: Romance, in: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Bd. 14, Paris 1751: http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/Volume_14# ROMANCE.
Duchambge, Pauline: A mon ange gardien: http://archive.org/details/monangegardien830duch.
Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Mœurs de Province, hrsg. von Claudine Gothot-Mersch, Paris: Garnier 1971.
Goubault, Christian: La musique et les lettres au XIXe siècle, in: Histoire de la France littéraire, Bd. III, hrsg. von Patrick Berthier und Michel Jarrety, Paris: PUF 2006, 32009, S. 555–569.
Gougelot, Henri: La Romance française sous la Révolution et l’Empire, Melun: Legrand et Fils 1937.
Gstrein, Rainer: Die vokale « romance française » im 18. Jahrhundert, in: Zur Entwicklung, Verbreitung und Ausführung vokaler Kammermusik im 18. Jahrhundert: XXII. Internationale Wissenschaftliche Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Michaelstein, 10. bis 12. Juni 1994, hrsg. von Bert Sigmund, Michaelstein: Stiftung Kloster Michaelstein 1997 (Michaelsteiner Konferenzberichte 51), S. 125–129.
Guide de la mélodie et du lied, hrsg. von Brigitte François-Sappey und Gilles Cantagrel, Paris: Fayard 1994.
Hickman, Roger: Romance, in: Grove Music Online: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/23725?q=Romance&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit.
Johnson, Graham, und Richard Stokes: A French Song Companion, New York: Oxford University Press 2000, S. 134f.
Noske, Frits: French Song from Berlioz to Duparc, übers. von Rita Benton, New York: Dover Publications 1970, Neuauflage 2012.
Perrin, Jean-François: Cordes sensibles: la mélodie du penseur, in: Le Magazine Littéraire (Nr. 514), Dezember 2011, S. 64f.
Rousseau, Jean-Jacques: Dictionnaire de musique, Paris: Duchesne 1768: http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP72006-PMLP144356-Dictionnaire_de_musique__1768_.pdf.
Schneider, Herbert: Duchambge, in: MGG2P, Bd. 5, Sp. 1492–1495.
Schweitzer, Claudia: Pauline Duchambge: http://mugi.hfmt-hamburg.de/A_lexartikel/lexartikel.php?id=duch1776.
Starobinski, Jean: Rousseau – Eine Welt von Widerständen, übers. von Ulrich Raulff, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 133–137.
Tunley, David: Romantic French Song 1830–1870, Bd. 1, hrsg. von David Tunley, New York, London: Garland 1994.
Warning, Rainer: Ironiesignale und ironische Solidarisierung, in: Das Komische, hrsg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning, München: Fink 1976 (Poetik und Hermeneutik 7), S. 416–423.
Ders.: Die Phantasie der Realisten, München, Fink 1999.
August Bungert: Vorwort zu „Nausikaa“ (1885)
Im Jahre 1885 veröffentlichte August Bungert im Verlag von Friedrich Luckhardt die Erstfassung eines Librettos seiner Tetralogie „Homerische Welt“. Er wählte „Nausikaa“ als Ausgangspunkt, von dem aus sich das Konzept allerdings in den nächsten Jahren wesentlich verschieben sollte. Als die Tetralogie von 1896 bis 1903 in Dresden, Berlin und Hamburg über die Bühnen ging, handelte der erste Teil von Kirke, der zweite von Nausikaa, der dritte von Odysseus’ Heimkehr und der vierte von Odysseus’ Tod, den Homer gar nicht schilderte. Auch in der Ideenwelt hatte sich seit 1885 viel verändert; aus der Betonung des Lebens als Leiden und der Kunst als Tröstung wurde nach Bungerts Bekanntschaft mit Friedrich Nietzsche eine immer stärkere Akzentuierung des aktiven, handelnden Menschen und der selbstständigen Gestaltung des eigenen Geschicks.
Zur Einführung
Es giebt ein Wort, das so alt ist wie die Welt. Alle dahingegangenen Völker kannten und alle bestehenden Völker kennen dieses Wort. In ihren Religionen ist es niedergelegt oder es haben uns das Wort ihre Dichter und ihre Philosophen in ihren Werken ausgesprochen. In den verschiedensten Weisen ward es und wird es gesungen. Im einfachen Volksliede wie im höchsten Kunstgedicht klingt uns das Wort entgegen. Am Abend eines stillen, eingeschränkten Lebens ertönt das herbe Wort und am Ende des prometheischen Ringens eines jeglichen Helden, eines jeglichen Uebermenschen vernehmen wir es. – Dieses alte orphische Urwort heißt: „Entsagen!“ Das Wort „Entsagen“ ist der Grundgedanke unseres Daseins – es ist das Ende vom Lebensliede. Das Höchste, was der Mensch erreichen kann, ist als Heros, entsagend, au diesem Leben zu scheiden! Kein Erdenwanderer bringt es weiter, als, nach übermenschlichem Ringen und Kämpfen, ausgesöhnt mit dem mühevollen, kurzen Dasein, mit Lächeln ohne Bitterkeit auf den Lippen, verscheidend, stammeln zu können: „Ich entsage!“ Dieses Wort, das mit jedem Schritt, den wir weiter thun auf dieser Lebensbahn, uns lauter und vernehmlicher tönt, macht uns reifer, stiller und mahnt uns zu bedenken, daß Leben Sterben ist.
Wo aber ist der Lethebecher, aus dem die müde Seele Vergessen trinken kann und uns alle Qual des Daseins entfernen? – Die Kunst ist der Becher. Aus diesem Becher trinken wir jegliches Lebens-Leid fort.
Das echte Kunstwerk bietet uns das Menschenleben, oder Episoden desselben, von jenem geklärten, hohen Standpunkte aus gesehen, wo nur die bedeutungsvollen Fäden, welche die Handlung, d. h. den symbolischen Grundgedanken des Kunstwerkes bilden, licht und klar uns entgegenleuchten. Aus diesen Fäden, einem Liniensystem gleich, bauen sich die ethischen Akkorde auf, die, mögen sie nun herb oder milde klingen, doch Musik sind, und unsere Seele klärend berühren. Unsere Seele wird mit dem Dichter hellsehend – hellhörend – entrückt im Lande der Kunst. Wie vergessen in solcher Anschauung, unter dem Banne des Kunstwerkes stehend, das eigene Leid, weil wir auch dieses nun von jenem geklärten, hohen, einzig wahren Standpunkte des Weltgeistes aus ansehen und empfinden!
Das schöne erquickende der Kunst ist eben der klingende göttliche Akkord, den der Dichter, sein Kunstwerk schaffend, gehört hat, nun uns in diesem enthüllt! –
Der Grundgedanke des vorliegenden Werkes ist: die Entsagung. Es ist also dasselbe alte Lied, das in dem größten Werk unseres größten Dichters, im Faust ertönt: „Entbehren sollst du, sollst entbehren!“
Das Ideal des griechischen Helden ist neben Achilleus vor allen Odysseus. Sein Leben heißt: Kämpfen – genießen – leiden! Er ist der unermüdliche Kämpfer – der nie ermüdende Genießende – der erhabene Dulder! Kurz vor dem Ende seiner Laufbahn tritt ihm im Phäakenlande, Nausikaa die Mädchenblume entgegen. Neuer Kampf – neues Leid! Aber zugleich, und dieses habe ich in meiner Dichtung besonders betont, ist ihm das Phäakenland auch das Land der Kunst; hier hört er seine eigenen Thaten bereits durch den Mund des Sängers verherrlicht. – Die ganze Art, wie auch Homer, am Schluß seiner Irrfahrten Odysseus noch nach Phäakenland gelangen läßt, die Schilderung des Volkes, dessen Freude und Lust am Dasein, seine Pflege und Verehrung des Schönen; dann die Art und Weise, wie Odysseus Nachts von diesem Traumlande schlafend fortgefahren wird, um Morgens endlich in seiner Heimat Ithaka zu landen – all dieses hat bei Homer einen eigenen, bei ihm ganz einzig dastehenden, beinahe phantastischen Zug. Wie ein Lethebecher ist dem Helden, nach dieser Seite hin, der Aufenthalt im Phäakenland –, wie ein Becher der Erquickung vor dem letzten Kampf gegen die Freier in der Heimat! –
Und nun Nausikaa! In der Odyssee im 7. und 13. Gesange bringt Homer wenigstens äußerlich nicht das Tragische der Gestalt zum Austrag. Es war dies aus vielen Gründen im Epos nicht am Platze. Das Verhältnis zur Nausikaa mußte und konnte nur vorübergehend dargestellt werden; denn es handelt sich vor allem um die Heimkehr des Odysseus. Dem Epiker genügte hier das Tragische nur anzudeuten. Daß der Dramatiker durchaus anders den Stoff anfassen mußte, ist natürlich. Auf Nausikaa’s Gestalt ruht, nachdem sie den Helden gesehen, der ganze Zauber, der bei Tag und Sonne, voll und stolz aufblühenden Rose – und bei Odysseus Abschied – steht sie da, wie die arme Blume, auf die der Reif der Frühlingsnacht gefallen ist! – –
*
Bezüglich der Betonung Nāūsika und Nausikaá statt der bisher durchweg gebräuchlichen bin ich theilweise derselben Ansicht wie Jordan, der in seiner neuen Uebersetzung des Homer auch Folgendes sagt: „Aus irrthümlicher Analogie mit Nausīthoos hat man bisher den Namen Nausīkaa ausgesprochen. Da der Name mit dieser Aussprache unschön klingt und das griechische Nausikaá in unserm lediglich accentuierenden Hexameter unmöglich ist, bin ich für die Aussprache Nāūsika.“
In der freien Strophe der Musik-Tragödie in keiner Weise jenem Zwange unterworfen, hab’ ich beides, sowol Nausikaá wie Nāūsika gebraucht.
Daß es lange Zeit ein Lieblingsgedanke Goethes gewesen ist, seine Nausikaa zu schreiben, daß er in Palermo am Strande wandelnd eine Skizze entwarf, die allerdings nur sehr dürftig ist, ist aus seiner Italienischen Reise bekannt. Dieses war am 16. April 1787; also vor beinahe 100 Jahren. Die nach einem späteren Entwurf ausgeführten Nausikaa-Szenen sind aus seinen Werken bekannt.
Sophokles soll eine Nausikaa geschrieben haben. Es ist uns aber leider nichts übrig geblieben; von den Scholastikern wird nur der Titel mitgetheilt.
Noch will ich hinzufügen, daß diese Nausikaa der dritte Theil, d. h. der III. Abend meiner Tetralogie „Homerische Welt“ ist.
Der erste Abend betitelt sich: Achilleus und Helena, mit dem Vorspiel: das Opfer der Iphigenie in Aulis.
Der zweite Abend: Orestes und Klytemnestra.
Der dritte Abend: Nausikaa.
Der vierte Abend: Odysseus Heimkehr.
Da indeß ein jedes Drama für sich allein besteht, so gehe ich einstweilen nicht darauf ein, den Grundgedanken des ganzen Werkes, wie auch der einzelnen anderen Abende hier näher zu entwickeln. Das Erscheinen des ganzen Werkes wird in nicht ferner Zeit erfolgen.
Pegli bei Genua, 14. März 1885.
August Bungert.
[Transkription: Christoph Hust]
Cäcilien-Vereins-Katalog
Als Zwischenschritt zum Projekt der HMT einer Datenbank zu den Cäcilien-Vereins-Katalogen können wir Ihnen hier Scans der ersten Einträge dieses Katalogs präsentieren. Sie finden diese Scans auf der Homepage des Instituts für Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Theater Leipzig auch als OCR-erfasste PDF-Dokumente.
Joseph Joachim Raff als Kompositionslehrer
Im Jahre 1864 unterrichtete Joseph Joachim Raff, mittlerweile aus Weimar nach Wiesbaden übergesiedelt, seine Privatschülerin Marie Rehsener (später machte sie nicht als Musikerin Karriere, sondern als Scherenschnittkünstlerin). Der umfangreich dokumentierte Kurs führte von Generalbass- und Kontrapunktübungen bis zu einfachen Satzmodellen. Eingebettet sind zwei kleinere musiktheoretische Traktate von Raff. Sie finden hier die gesamte Quellen (teils in Mitschriften von Rehsener, teils in Manuskripten von Raff) in digitalen Versionen. In der nächsten Zeit sollen auch einige „Highlights“ transkribiert werden. – Die Originale sind in Privatbesitz; Anfragen zur Reproduktion bitte an christoph.hust@gmx.de.
August Bungert: Einführung zur „Faust“-Bühnenmusik (1903)
Nach den Aufführungen seiner Tetralogie „Homerische Welt“ wandte sich August Bungert sofort neuen Aufgaben zu. Vor dem Mysterium op. 60, einem Oratorium für Soli, Chor und Orchester, war Goethes „Faust“ sein erstes neues Projekt. Mit Bungerts Bühnenmusik wurde „Faust“ zur Tetralogie und zu einem postwagnerianischen „Bühnenweihespiel“, wie der Komponist es im umfangreichen Vorwort des Klavierauszugs darlegte.
Zur Einführung.
Im Auftrage des Rheinischen Goethe-Vereins, unter dem Protektorat Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen des deutschen Reiches und dem Vorsitze Sr. Excellenz des Ministers H. von Rheinbaben, frug im Februar dieses Jahres Max Grube, der Oberregisseur des Königl. Schauspielhauses zu Berlin, bei mir an, ob ich Zeit und Muße finden würde, bis zu Ende Mai eine neue Musik zu Goethe’s Faust zu komponieren.
Da ich eben mein Lebenswerk, die Musiktetralogie: Die Odyssee abgeschlossen hatte und längst der Plan in mir ruhte, an eine solche Arbeit heranzutreten, ohne daß indes eine Note dazu geschrieben war, so übernahm ich mit Freude und glühendster Begeisterung die Aufgabe.
In unbeschreiblicher Erregung wurde in etwa 7–8 Wochen die ganze Musik skizziert, Tag und Nacht daran geschrieben und bis zum festgesetzten Termin im Mai war die Instrumentation in der Hauptsache vollendet, die Klavierauszüge liefen in Korrekturabzügen bei den Proben ein, die Orchester- und Chorstimmen folgten bis in die letzten Tage vor den Erstaufführungen am 5., 6. und 7. Juli. [Anm. von Bungert: Allerdings rief die Überanstrengung der Augen eine starke lang andauernde Entzündung hervor.]
Manches konnte aus verschiedenen scenarisch-technischen Gründen nicht zur Aufführung kommen, doch im Ganzen wurde das Werk in 3 Abenden unter der Rollenbesetzung bedeutendster schauspielerischer Kräfte von Berlin und andern Hauptstädten Deutschlands in der von Max Grube eingerichteten Lesart, mit herrlichen Dekorationen von Georg Hacker, unter der vorzüglichen Leitung des Kapellmeister Fröhlig aufgeführt und fand in den 4maligen Cyklen der 3 Abende den begeistertsten Beifall des Publikums, das jeden Abend das Theater bis auf den letzten Platz gefüllt hatte. –
Einige Einführungsworte zu vorliegender Faust-Musik mögen gestattet sein.
Der I. Teil des Faust begann nach Vorausgang einer breiten Horn- und Trompeten-Fanfare mit dem Vorspiel auf dem Theater. Dann folgte das Ganze in der Original-Lesart bis zum Schluß mit einigen Strichen in der Walpurgisnacht; die Kürzungen mußten wegen mangelhaften scenischen Apparates stattfinden. Die Aufführung dauerte 6 Stunden, sodaß die Idee entstand, bei späteren Aufführungen den I. Teil auf 2 Abende zu verteilen; dann natürlich in breitester Weise die Walpurgisnacht zu bringen und zwar so, daß der 1. Abend mit der Hexenküche schließt und das Gretchen-Drama den 2. Abend bilden würde, während der II. Teil (auch in 2 Abende zerfallend), im 3. Abend mit der „Peneiosscene“ (Chiron, Faust, Manto) schloß, und dann im 4. Abend mit der Helena-Tragödie beginnend, bis zum Schluß des Werkes mit einigen Umstellungen und Strichen wieder möglichst die Goethesche Dichtung intakt ließ.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist das Werk, wie vorliegend, anzusehen.
Durch die Einteilung des I. Teiles in 2 Abende ist es möglich, die einzelnen, oft sehr kurzen Scenen durch musikalische Zwischenspiele, die die vorhergehende Scene ausklingen lassen und in die folgende stimmungegemäß überleiten, zu verbinden. Es wird dadurch, abgesehen von der so erleichterten Verwandlung der Decoration, möglich sein, im Gemüt des Zuschauers die früher gesehene Handlung sich vertiefen zu lassen, und ihn halb traumhaft auf der Musikwelle in die Stimmung der folgenden Scene hinüberzutragen, sein Empfindungsvermögen von neuem spannend, ihn empfänglich zu machen, die Poesie der herrlichen Sprache ganz und voll zu genießen und in sich aufzunehmen.
Grade also eine ruhige, statt einer überhasteten Verwandlung der Scene, (wie dieses letztere bisher der Fall war), dürfte das Richtige sein; eine Musiküberleitung als Brücke von einer zur andern Scene, stets dem Inhalt beider Scenen gemäß. Man sehe sich als Beispiele die Gartenscene und Gartenhäuschenscene an; darauf folgend Wald und Höhle, Gretchen am Spinnrad, in Marthen’s Garten, Gretchen und Lieschen am Brunnen, Gretchen vor der Mater dolorosa, Zwinger und Valentinscene u. s. w.
Es sei nun hier gleich bemerkt, daß bei der Komposition, wie z. B. des Liedes: Gretchen am Spinnrad, der König in Thule, u. s. w. die idealste Besetzung gedacht ist, und daß nach Möglichkeit jeder Bühne den vorhandenen Darstellern gemäß sich einrichten wird.
Daß Goethe das ganze Werk gewissermaßen in Musik getaucht sich gedacht hat, geht aus unzähligen Stellen auf das evidenteste hervor. Auch stimmen darin wol sämtliche Kommentare überein. Sagt doch sogar der Dichter im II. Teil in der Euphorionscene: „Von hier an mit vollstimmiger Musik!“ [Anm. von Bungert: Wie gewaltig diese Scene in vorliegender Form wirkte, ersehe man aus den Berichten.] Er wünscht hier (und nun gar im Schlußakt des Werkes!) tatsächlich die Form der Oper. Des Näheren darauf einzugehen und dieses zu beweisen mag einem besonderen Aufsatz vorbehalten sein.
Es möchte, nebenbei bemerkt, in der ganzen dramatischen Litteratur kaum eine Gestalt geben, wo, wie bei der des Euphorion, in der Reihenfolge von Stimmungen und Scenen, das gesprochene Wort der innern Erregung gemäß so natürlich in das gesungene Wort übergeht; wo das Wort so zur Melodie sich gestaltet, gleichsam wie selbstverständlich; und wo ebenso natürlich und von sich selbst ergebend das gesungene Wort wieder in das gesprochene zurücktreten kann.
Man mag aus den kritischen Stimmen lesen, bis zu welcher gewaltigen, ergreifenden Wirkung sich dieser Akt in den Düsseldorfer Festaufführungen aufbaute.
Zum ersten Male findet man hier auch die 4teiligen Chöre am Schluß der Helena-Tragödie komponiert, beginnend mit dem Chore „Zurückgegeben sind wir dem Tageslicht“. Goethe hat zweifellos die Scene hier, nach dem erschütternden Akt, als ein Satyrspiel ähnliches Ausklingen sich gedacht. Daß bei richtiger glänzender Ausführung dieser Schluß bei Gesang und bacchantischem Tanz von grandioser Wirkung sein würde, ist zweifellos. Soll doch „an Prospekten und an Maschienen, an groß[en] und kleinen Himmelslichtern, Sternen, an Wasser, Feuern, Felsenwänden, an Tier und Vögeln nicht gespart werden – um mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle zu schreiten.“
Ganz verkehrt aber erscheint es, die obigen Chöre in den wundervollen Poesie-Worten sprechen und dann mit etwa 16 Takten Musik, die die Scene musikalisch illustriert, jämmerlich nachhumpeln zu lassen. Dann ist es schon richtiger und dramatisch gewaltig wirksamer, gleich mit den Worten der Helena oder des Phorkias „Wir sehn uns wieder, weit gar weit von hier“, zu schließen.
In den überall eingestreuten Liedern galt es, (natürlich immer mit Berücksichtigung auf den darzustellenden Charakter und auch der betreffenden Situation), vor allen Dingen den Volkston zu treffen, den Goethe, wie auch Shakespeare in den eingelegten Liedern beabsichtigt hat [Anm. von Bungert: Daß Goethe im Lemurengesang einen andern Vers des Totengräberlieds im Hamlet (ein altes Volkslied) aufnahm, darf als bekannt vorausgesetzt werden.]. –
Wie weit nun das melodramatische Element im vorliegenden Material benutzt wird, steht dahin. Als Grundsatz stellte sich der Tondichter die Aufgabe, durchweg das Übersinnliche, Geheimnisvolle, das Spukhafte, Fantastische, das Erhabene, vielfach auch das Dämonische mit Musik zu begleiten; es wird natürlich ganz von der Regie eines jeglichen Theaters abhängen, das sich eignende aus der vorhandenen Fülle zu bringen oder auszulassen; ebenso mag an der Hand der Regie und des Kapellmeisters oft die Komposition einer Stelle (möglichst leise gespielt) melodramatisch benutzt werden.
Auf den ersten Blick wird man sehen, daß (und wol zum ersten Mal) die melodramatischen Stellen sämtlich so im Auszug eingetragen sind, daß zu jeder Zeile, ja bis aufs Wort, genau die Musik, Takt für Takt angegeben ist. Da ebenso genau der Text der Dichtung in die Partitur eingetragen ist, bleibt dem Darsteller durchaus seine völlige Freiheit eines hier und da rascheren Tempos; es liegt in der Hand des Dirigenten, dem Darsteller bis in die kleinsten Abtönungen des Ausdrucks, leicht und ihm sich schmiegend, zu folgen, seine Worte und Gebärden zu illustrieren, zu tragen und noch zu haben [Anm. von Bungert: In den Düsseldorfer Festspielen erreichte dieses Kapellmeister Fröhlig in vorzüglicher Weise.].
Es wird zuträglich sein, das Orchester nach Notwendigkeit, der Akustik des Saales gemäß, teilweise zu decken.
Im Übrigen wird das Studium des Auszuges, mit der Partitur zur Hand und bei der Vertiefung in die Dichtung alles andere ergeben.
Nur über die Besetzung der Engel im Prolog im Himmel durch männliche Darsteller noch einige Worte [Anm. von Bungert: Hierüber wird demnächst ein größerer Aufsatz vom Verfasser erscheinen.].
Die bisherige Besetzung der Engel durch Frauenstimmen erscheint ein großer Irrtum. Die drei Gestalten sind hier gewissermaßen die Verkörperung der Gott untergebenen Naturgewalten, wie auch (trotz der Anschauung der Geschlechtslosigkeit der Engel) durch ihre Namen es angedeutet ist. In den darauf bezüglichen Bibelstellen ist durchaus nicht von der Weiblichkeit der Gestalten die Rede. Es sind hier gewissermaßen die dem Throne des höchsten Herrschers der Welten unterstellten Fürstenengel (s. v. w.), sie sind seinem Throne nahegestellt, sind Ausübende seiner Macht; sie entstammen nicht der Region der himmlischen Heerscharen, von denen Mephisto sagt „die Racker sind doch gar zu appetitlich.“ So dachte sich der Verfasser dieselben etwa auf das Schwert gestützt und gewappnet. Gesprochen erscheinen die unvergleichlichen Worte, von der Scene und Situation abgesehen, ohnehin schon zu gewaltig und breit, um auch nur annähernd ihrer Bedeutung gemäß Wirkung zu geben [Anm. von Bungert: Übrigens fand meine Auffassung auch in Düsseldorf die volle Zustimmung und den Beifall der Maler Jensen, Gebhard, Achenbach u. s. w.].
Daß durchweg in der Musik die Benutzung des Leitmotiv’s herrscht, daß dadurch viele Scenen eine eindringlichere Wirkung erreichen konnten, sei dem Urteil der aufmerksamen Zuhörer überlassen.
So wurde z. B. der Ostergesang als Motiv mehrfach angewandt, in der Beschwörung des Pudels im Studierzimmer [Anm. von Bungert: „Kannst du ihn lesen? / Den nie Ausgesprochenen.“] und insbesondere in der Schlußscene, da die Worte des Mephisto: „Sie ist gerichtet!“ und der Stimme von oben „Ist gerettet!“ als Gegensatz erklingend, gesprochen fast zu rasch und nicht eindringlich genug erscheinen dürften. Hier erschien die Benutzung des Ostergesanges des Chor’s der Engel:
„Christ ist erstanden!
Freude dem Sterblichen,
Den die verderblichen
Schleichenden, erblichen
Mängel umwandeln!“
als Unterlage für die Worte Gretchens:
„Dein bin ich Vater! Rette mich!
Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen!“
mit dem Gedanken also des Opfertodes des Heilands für die sündige, reuige Menschheit, bei Gretchens Rettung, geradezu geboten. Abgesehen davon, daß dadurch im Werke, auch insbesondere in Goethe’schem Sinne glücklich „Anfang und Ende sich in Eins zusammenziehen“. Es lag nahe, daß das melodramatische Motiv zu den Worten im I. Teil:
„Werd’ ich zum Augenblicke sagen
Verweile doch, du bist schön!“
dasselbe sein mußte im II. Teil zu den Worten:
„Zum Augenblicke dürft’ ich sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!“
Als interessante, durch die Leitmotive glücklich zusammengestellte, in Parallele gebrachte Scenen seien erwähnt die Raubscene (II. Teil) des Habebald und Eilebeute in des Kaisers Zelt und die des Erzbischofs mit dem Kaiser; wo dasselbe Leitmotiv in der Verlängerung in pathetischer Fassung erscheint.
Daß die Hälfte des V. Aktes des II. Teiles ganz für Musik gedacht ist, wer wollte das verkennen!
Bisher wurden die Worte des Mephisto mehr oder weniger mit Musik unterstrichen, d. h. es wurde versucht, seine Worte durch Musik noch teuflischer im Ausdruck zu machen und dennoch war es logisch hier, vom umgekehrten Standpunkt auszugehen, da er doch meistens während der ewig-rein aus himmlischer Sphäre erklingenden Engelschöre, dann sich ihm nahend, und ihn täuschend, spricht und daß gerade dadurch, während der reinen keuschen Gesänge, des Teufels Sprache und niedrig klingendes Organ am stärksten in Gegensatz dazu treten wird.
Die Schlußscene der ganzen Tragödie, ist in zwei Lesarten komponiert. De eine wird mit dem Chorus mysticus schließen, wie angegeben. Die andere Lesart bringt nach Schließung des Vorhanges den Gedanken zur Ausführung, daß das Publikum sich erhebt und die letzten Worte des Chorus, gleichsam als Bestätigung, als Bejahung des Gesehenen, Gehörten, Erlebten, singend wiederholt. Fast möchte es nach diesem Schauspiel ohnegleichen, nach dieser Menschheitstragödie psychologisch den Zuschauern als Bedürfniss erscheinen, gleichsam als antiker Chor die Worte des Chores zu wiederholen. Goethes Faust wird in dieser Form einer Tetralogie stets mehr oder weniger ein Festspiel, ein Bühnenweihespiel bleiben, während jeder Abend, einzeln aufgeführt, die Leistungsfähigkeit eines guten Theaters nicht übersteigt.
Düsseldorf, Juli 1903.
Aug. Bungert.
[Transkription: Christoph Hust]
Johanna Steinborn: „Christoph Schaffrath und die Triosonate“
Johanna Steinborn (Bamberg / Leipzig)
Christoph Schaffrath und die Triosonate:
Ästhetik, Kompositionstechnik und Rezeption
Leben und Werk des preußischen Komponisten Christoph Schaffrath stellen trotz der in den letzten Jahren erfolgten Wissenszuwächse noch immer eine Forschungslücke dar (vgl. Hartmut Grosch, Christoph Schaffrath – Cembalist, Komponist, Lehrmeister, in: Die Rheinsberger Hofkapelle von Friedrich II., Musiker auf dem Weg zum Berliner „Capell-Bedienten“, hrsg. von Ulrike Liedtke, Rheinsberg 2005, sowie Reinhard Oestreichs Vorwort zu seinem Verzeichnis der Werke Christoph Schaffraths, Beeskow 2012, S. 7–16). Wenig ist über die Biographie des langjährigen musikalischen Untergebenen Friedrichs II. bekannt, und weite Teile seines handschriftlich überlieferten Œuvres harren noch der Erschließung. Der vorliegende Beitrag soll ein neues Detail zur Schaffrath-Forschung ergänzen und an einem Beispiel nach dem Verhältnis von Kompositionstechnik und Gattungsästhetik zur Mitte des 18. Jahrhunderts fragen. Die erst seit kurzem edierte Triosonate g-Moll für Oboe, Violine und Basso continuo CSW:E:18 macht exemplarisch deutlich, wie Schaffrath seine Musik in der Relation zu zeitgenössischen, streng kontrapunktischen Kompositionsprinzipien verortete (die Edition, hrsg. von Bernhard Päuler, ist bei Aurea Amadeus unter der Nummer 265 erschienen). Dies kann zwei miteinander verbundene Fragen klären. Erstens erhellt es, wie eng Theorie und Praxis in der Berliner Musikkultur des 18. Jahrhunderts miteinander verbunden waren, die in der öffentlichen Wahrnehmung bekanntlich nicht zuletzt aus der Überblendung dieser Bereiche definiert war. Zweitens lassen sich an diesem Beispiel Gründe dafür aufzeigen, weshalb Schaffrath, zu seiner Zeit immerhin einer der namhaftetesten Musiker Berlins, im späteren Musikleben so weitgehend vergessen wurde.
Schaffraths kompositorisches Schaffen umfasste ausschließlich Instrumentalwerke. Sie reichen in der Besetzung von Solosonaten bis zum Konzert. Die Trios bildeten darunter wahrscheinlich den größten Teil der einstmals schriftlich fixierten Kompositionen. Heute sind jedoch nur noch sieben Sonaten für verschiedene Holzbläser- und Streichinstrumentenensembles erhalten. Selbst unter diesen sieben Sonaten kann Schaffraths Autorenschaft nicht immer zweifelsfrei angenommen werden. Oestreich vermutet aufgrund zeitgenössischer Werkverzeichnisse die Existenz von ehemals 60 bis 80 Trios (Verzeichnis der Werke Christoph Schaffraths, siehe oben, S. 23). Dass sich die Triosonate in ihrer Besetzung mit zwei Oberstimmen und Basso continuo in Berlin großer Beliebtheit erfreute, zeigen neben Schaffraths Werken auch die fast aller seiner Berliner Kollegen: In so gut wie jedem Werkverzeichnis von Komponisten aus diesem kulturellen Kontext finden sich Trios, wenn auch meist in geringerer Anzahl als bei Schaffrath vermutet (beispielsweise bei Johann Gottlieb Graun, Carl Heinrich Graun oder Johann Joachim Quantz).
Grundlage der vorliegenden Untersuchung ist Schaffraths Trio CSW:E:18, D-B AmB 495/II. Grundsätzlich sind einige Autographen und Abschriften von Schaffrath seit 2006 datiert, so auch eine Abschrift dieser Komposition in der Sammlung Thulemeier (Tobias Schwinger, Die Musikaliensammlung Thulemeier und die Berliner Musiküberlieferung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (ortus studien 3), Beeskow 2012). Demnach wäre das Trio vermutlich in den 1750er Jahren (zwischen „vor 1751“ und ca. 1760) entstanden. Zu dieser Zeit war Schaffrath bereits von seiner Position als Hofcembalist Friedrichs II. an den Hof der Prinzessin Anna Amalia gewechselt. Wie ihr Bruder war auch sie eine begeisterte Musikerin. Als Dienstherrin mehrerer Musiker nahm sie auf die Geschmacksbildung Einfluss und förderte eine Schreibart, die – vor allem außerhalb Berlins – zu dieser Zeit eigentlich schon anachronistisch erschien (ebd., S. 3). Sicherlich wurde sie darin von ihrem Lehrer Johann Philipp Kirnberger und seinem Beharren auf der streng kontrapunktischen Satzlehre bestärkt (ebd., S. 86f.). Nach diesem tradierten Regelwerk stellten die Vorherrschaft des Basses über der Melodie und die Regelgerechtigkeit des Satzes die Weichen zur Vollkommenheit eines Stückes. Dass zur gleichen Zeit anderswo schon andere Modelle diskutiert wurden, nahm Kirnberger durchaus wahr, verstand dies jedoch als den Gegensatz zweier Schreibarten:
„Jene strenge Schreibart wird vornämlich in der Kirchenmusik […] gebraucht; diese [die „freye oder leichtere Schreibart“] aber ist vornehmlich der Schaubühne und den Concerten eigen, wo man mehr die Ergötzung des Gehörs, als die Erweckung ernsthafter oder feyerlicher Empfindungen zur Absicht hat. Sie wird deswegen insgemein die galante Schreibart genennt, und man gestattet ihr verschiedene zierliche Ausschweiffungen, und mancherley Abweichung von den Regeln.“ (Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Berlin 1771–1779, hrsg. von Gregor Herzfeld, Kassel 2004, S. 80.)
Zu Schaffraths Stellung im Berliner Musikleben
Grundsätzlich gliedert Schaffraths Œuvre sich fast nahtlos in das Raster seines Berliner Umfelds ein. Obwohl über seine Ausbildung fast nichts bekannt ist, lässt auch die vorliegende Triosonate im Speziellen seine Verpflichtung zur kontrapunktischen Tradition erkennen. Es sei dahingestellt, ob man Gerhard Poppes These folgen möchte, Schaffrath sei Schüler Jan Dismas Zelenkas gewesen (Gerhard Poppe, Die Schüler des Jan Dismas Zelenka, in: Musikkonzepte – Konzepte der Musikwissenschaft. Bericht über den Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung Halle (Saale) 1998, hrsg. von Kathrin Eberl und Wolfgang Ruf, Kassel 2000, Bd. 2, S. 292f.) und stünde damit direkt in der Tradition der traditionellen Kontrapunktlehre nach Johann Joseph Fux – auf jeden Fall reflektiert sein Werk diese Art der gediegenen Ausbildung, auch wenn er sich neueren Stilelementen und ungewöhnlichen melodischen Wendungen nicht grundsätzlich verschloss.
Vor allem als Mitglied des Ruppiner und später Rheinsberger Hofmusikensembles des Kronprinzen Friedrich II. hatte Schaffrath an aktuellen musikalischen Experimenten teil. Neue Besetzungsvarianten wurden ebenso erprobt wie die moderne Spielart des Solokonzerts (in seinem Fall: des Cembalokonzerts) und rezente Stilmittel (Hartmut Grosch, Christoph Schaffrath. Komponist – Cembalist – Lehrmeister, in: Die Rheinsberger Hofkapelle von Friedrich II. Musiker auf dem Weg zum Capell-Bedienten, hrsg. Ulrike Liedtke, Rheinsberg 2005, S. 217). Dabei war diese Musikpraxis alles andere als regional engstirnig. Viele Musiker dieser beiden Vorläufer der späteren königlich-preußischen Hofkapelle waren weit gereist und reisten auch zur Zeit ihrer Tätigkeit für Friedrich II. noch. Zudem ließ Friedrich sich Musik aus dem Ausland schicken (Sabine Henze-Döhring, Friedrich der Große. Musiker und Monarch, München 2012, S. 30), informierte sich also durchaus über die musikalischen Entwicklungen außerhalb Preußens, und ließ im begrenzten Rahmen einen Austausch mit anderen regionalen Musiksprachen zu.
Schaffrath war auf musikpraktischem und -theoretischem Gebiet vielfältig aktiv. Zeitgenössische Dokumente nennen ihn als engagierten, gründlichen Lehrer. Ausdruck dafür ist noch der ihm gewidmete Artikel in Gerbers Tonkünstlerlexikon:
„Schafrath […] ist einer unserer würdigsten Contrapunktisten gewesen. Mehrere der merkwürdigsten Komponisten, Virtuosen und Sänger, welche in diesem Buch vorkommen, waren seine Schüler. Überdies hat er auch verschiedene schöne und so gründliche Kompositionen, als man sie von einem Schafrath erwarten konnte, hinterlassen.“ (GerberATL, Bd. 2, S. 404.)
Das Zitat zeigt deutlich: Als Lehrer genoss Schaffrath noch zu Gerbers Zeit einen hervorragenden Ruf. Neben einer erheblichen Anzahl an heute unbekannteren Musikern hatte er auch einige Berühmtheiten seiner Zeit unterrichtet. Seinen Kompositionen wird in der Generation nach ihm dagegen schon weniger enthusiastische als vielmehr pflichtbewusste Anerkennung gezollt; sie galten lediglich als „gründlich“ und korrekt, mehr lehrreich intendiert denn inspirierend.
Zusätzlich zu dieser kompositorischen und pädagogischen Arbeit war Schaffrath sein ganzes Leben lang als Cembalist tätig. Im Einklang mit Berliner Idealen widmete er sich wenigstens sporadisch auch der musiktheoretischen Schriftstellerei; überliefert ist das Manuskript einer unvollendeten Kompositionslehre (Theorie und Praxis der Musik, D-B AMB 605/6). Schaffraths in der Summe herausgehobene Position und übergeordnete Funktion im Kreise der Hofmusiker belegt vor allem seine Lehrtätigkeit; auf König Friedrichs Wunsch unterrichtete er einige andere Kapellmitglieder ebenso wie manche Sänger. Durch seine frühere Tätigkeit in der Kapelle Augusts des Starken war er ebenso bewandert in italienischer Gesangsdiminution. (Der damals sehr berühmte Kastraten-Sopran Felice Samnini erhielt bei Schaffrath Unterricht. Hiller äußert sich darüber folgendermaßen: „Samnini war es gelungen, auf seine wohlbekannte, bewegende Weise, das Adagio mit schönen und wohlüberlegten Verzierungen zu singen. Dabei kam ihm zugute, daß er sich bestens in den Grundharmonien auskannte und daß er bei Schaffrath studiert hatte“ (zitiert nach Grosch, Christoph Schaffrath, in: Die Rheinsberger Hofkapelle, siehe oben, S. 222).) Schaffrath war also kein einfaches Capell-Mitglied, sondern ein Mentor und umfassend informierter musikalischer Ausbilder für viele der Musiker. Da Friedrich II. selbst diesen Unterricht anwies, kann dessen Bedeutung gar nicht hoch genug geschätzt werden. Der Monarch selbst erkannte Schaffrath demnach in der Musik als einen Kollegen an, der es würdig war, ihn in dieser pädagogischen Mission zu vertreten.
1741 wechselte Schaffrath von der Position als erster Cembalist der königlichen Hofkapelle an den Hof der Prinzessin Anna Amalia. Seine dortige Tätigkeit als Kammermusiker scheint eher nebenberuflicher Natur gewesen zu sein, da sich bislang keine Gehaltsnachweise finden ließen (Christoph Henzel, Agricola und andere, in: Jahrbuch des staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, hrsg. von Günther Wagner, Stuttgart 2003, S. 56). Der Brotberuf hingegen war wohl seine Lehrtätigkeit. Anna Amalia allerdings erhielt keinen Unterricht von ihm; sie hatte Kirnberger als Lehrer gewählt. Mit ihm teilte Schaffrath sich auch die Aufgabe, sich um die Bibliothek seiner Dienstherrin zu kümmern, in die nach seinem Tod auch seine eigene Musikaliensammlung eingegliedert wurde (Renate Blechschmidt, Die Amalien-Bibliothek, Berlin 1965, S. 25).
Schaffraths Trio g-Moll vor dem Hintergrund der Gattungsästhetik
Zeitzeugnisse belegen zur Genüge, dass Schaffrath als Komponist zu seinen Lebzeiten – anders als in der posthumen Rezeption – nicht nur bekannt, sondern auch geschätzt war (Grosch, Christoph Schaffrath, in: Die Rheinsberger Hofkapelle, siehe oben, S. 217). Nur ein Beispiel unter vielen ist der ihm geltende Artikel bei Ledebur, der den „Kammermusikus der Prinzessin Amalie v. Pr. zu Berlin, Geb. 1709 zu Hohenstein bei Dresden“, als „tüchtige[n] Contrapunktist[en] und […] beliebte[n] Lehrer“ ausweist (Tonkünstler-Lexicon Berlins, von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, hrsg. von Karl Freiherr von Ledebur, Berlin 1861, S. 498). Trotzdem scheint eine Vorbildwirkung nicht so sehr wahrgenommen worden zu sein wie zum Beispiel bei Carl Heinrich Graun, dessen Kompositionen oft und mit großem Aufwand aufgeführt wurden – hervorgehoben sei vor allem sein Passionsoratorium Der Tod Jesu (Christoph Henzel, Das Konzertleben der preußischen Hauptstadt 1740–1786 im Spiegel der Berliner Presse (Teil I), in: Jahrbuch des staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, hrsg. von Günther Wagner, Mainz 2004, S. 216–291). In der Berichterstattung der Berliner Presse existiert aus den Jahren 1740 bis 1768 dagegen kein einziger Nachweis, in dem Schaffrath als Komponist eines aufgeführten Stückes namentlich erwähnt würde (ebd.). Ein Grund dafür könnte sein, dass bis heute innerhalb seines Œuvres keine Vokalkompositionen bekannt sind, denen durch eine Aufführung in Kirche oder Oper ein größeres Publikum vergönnt gewesen wäre. Sein instrumentalkompositorisches Schaffen betraf im wahrsten Sinne des Wortes „Kammermusik“ für einen intimen Rahmen und sperrte sich der öffentlichen und in der Folge medialen Wirksamkeit.
Das Trio in g-Moll soll nun in diesen hier nur in Umrissen skizzierten Rahmen eingebettet werden. Zu diesem Zweck wird eingangs eine Gattungsästhetik der Triosonate auf der Grundlage der Schriften von Johann Georg Sulzer, Johann Joachim Quantz und Heinrich Christoph Koch rekapituliert, also zweier Berliner und eines mitteldeutschen Musikschriftstellers der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
In Sulzers Allgemeiner Theorie der Schönen Künste aus dem Jahr 1771 stehen einige bemerkenswerte Sätze über die Kammermusik und ihren sowohl kompositionsgeschichtlichen als auch sozialen Ort. Sie werde demnach eher für Kenner zur Übung ihrer Fähigkeiten und Liebhaber mit geschulten Ohren als für Laien gemacht, und ihr Stil müsse sich folglich durch Reinheit des Satzes, durch Feinheit im Ausdruck und durch kunstvollere Wendungen auszeichnen als die Musik in der Kirche oder der Oper (Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Bd. 1, Leipzig 1771, S. 189). Gewissermaßen als Königsdisziplin der Komposition ist bei Sulzer in diesem Zusammenhang sodann die Triosonate angeführt. Gute Kammertriokompositionen werden (im Gegensatz zum formal und musikalisch strengeren Kirchentrio) als „leidenschaftliches Gespräch unter gleichen, oder gegeneinander abstechenden Charakteren in Tönen“ charakterisiert. Die größere formale Freiheit sollte der Komponist nutzen, um Abwechslung zu schaffen: Lockere Imitationen, überraschende Einsätze, aber auch korrekt angebrachte Kadenzen und muntere Zwischensätze sollten in ihrer Gesamtheit zu einem individuellen Charakterbild jedes einzelnen Triosatzes trotz der uniformen Gattungsästhetik beitragen. Höchste Erwartungen stellt Sulzer an den Komponisten: „Daher erfodert das Kammertrio eine Geschiklichkeit des Tonsezers, die Kunst hinter dem Ausdruk zu verbergen“ (ebd.).
In Quantz’ Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen gelten die ersten Paragraphen des XVIII. Hauptstücks (Wie ein Musikus und eine Musik zu beurtheilen sey) der Klage, dass die wenigsten Menschen in der Lage seien, Musik angemessen zu beurteilen:
„Nicht nur ein jeder Musikus, sondern auch ein jeder, der sich für einen Liebhaber derselben [der Musik] ausgiebt, will zugleich für einen Richter dessen, was er höret, angesehen werden“ (Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, Berlin 1752, Faksimile-Reprint, Kassel 2004, S. 275).
Im weiteren Verlauf folgen regelrechte Kataloge von Qualitätskriterien, die die unterschiedlichen Musikgattungen zu erfüllen hätten, um Quantz’ Ansprüchen zu genügen. § 44 behandelt den „Quatuor“ mit drei solistisch agierenden Instrumenten und einer Generalbassstimme. Quantz bezeichnet ihn respektvoll als den „Probierstein eines echten Contrapunctisten“ und verweist auf Telemanns Pariser Quartette als Musterbeispiele der Gattung (ebd., S. 302).
§ 45, in dem Quantz nach dem Quatuor nun seine darauf aufbauenden Qualitätskriterien für das Trio niederlegt, sei im Folgenden vollständig wiedergegeben (ebd., S. 302f.). Dabei soll zugleich versucht werden, diesen spezifisch Berliner Kriterienkatalog des Trios mit Schaffraths kompositorischem Beitrag zur Gattung zu vergleichen und übereinstimmende Momente aufzudecken.
„Ein Trio erfordert zwar nicht eine so mühsame Arbeit, als ein Quatuor; doch aber von Seiten des Komponisten fast dieselbe Wissenschaft; wenn es anders von der rechten Art seyn soll. Doch hat es dieses voraus, daß man darinne galantere und gefälligere Gedanken anbringen kann, als im Quatuor: weil eine concertirende Stimme weniger ist. Es muß also in einem Trio 1) ein solcher Gesang erfunden werden, der eine singende Nebenstimme leidet. [Selbst für das eher sperrige Anfangsthema des Adagios findet Schaffrath eine melodiöse Gegenstimme (zweiter Satz (Adagio), T. 8–14; siehe Notenbeispiel.] 2) Der Vortrag beym Anfange eines jeden Satzes, besonders aber im Adagio, darf nicht zu lang seyn: weil solches bey der Wiederholung, so die zweyte Stimme machet, es sey in der Quinte, oder in der Quarte, oder im Einklange, leichtlich einen Ueberdruß erwecken könnte. [Der solistische Beginn des Adagios erstreckt sich lediglich über 7 Takte.] 3) Keine Stimme darf etwas vormachen, welches die andere nicht nachmachen könnte. [Das trifft zu – der Tonumfang der Oboe wird nur an wenigen Stellen von der Violine unter- oder überschritten (z. B. im ersten Satz (Allegro), T. 149). Schaffrath fordert keine instrumentenspezifischen Spieltechniken wie zum Beispiel Doppelgriffe.] 4) Die Imitationen müssen kurz gefasset, [Die Imitationen beschränken sich, außer zu Beginn der Sätze, auf kleine Motive von höchstens einem Takt Länge (zum Beispiel: erster Satz (Allegro), T. 29–32; siehe Notenbeispiel.] und die Passagien brillant seyn. [Die schnellen Läufe sind melodiös und ohne große Sprünge (zum Beispiel erster Satz (Allegro), T. 109–113; siehe Notenbeispiel).] 5) In Wiederholung der gefälligsten Gedanken muß eine gute Ordnung beobachtet werden. [Dafür sprechen zum Beispiel die Anfänge der zweiten Teile der Ecksätze, die jeweils das Anfangsthema in anderer Tonart wiederholen (erster Satz (Allegro), T. 82–96 bzw. dritter Satz (Presto), T. 70–84); siehe Notenbeispiel.] 6) Beyde Hauptstimmen müssen so gesetzet seyn, daß eine natürliche und wohlklingende Grundstimme darunter statt finden könne. [Die Bassstimme schreitet melodiös fort und enthält auch kleinere motivische Bestandteile (zum Beispiel erster Satz (Allegro), T. 43/3–48/1; siehe Notenbeispiel).] 7) Soferne eine Fuge darinne angebracht wird, muß selbige, eben wie beym Quatuor, nicht nur nach den Regeln der Setzkunst richtig, sondern auch schmackhaft, in allen Stimmen ausgeführet werden. Die Zwischensätze, sie mögen aus Passagien oder anderen Rahmungen bestehen, müssen gefällig und brillant seyn. [Dies trifft auf diese Sonate allerdings nicht zu, da sie keine strenge Fuge enthält.] 8) Obwohl die Terzen- und Sextengänge in den beyden Hauptstimmen eine Zierde des Trio sind; so müssen doch dieselben nicht zum Missbrauche gemachet, noch bis zum Ekel durchgepeitschet, sondern vielmehr immer durch Passagien oder andere Nachahmungen unterbrochen werden. [In den Ecksätzen kommen kaum ausgedehnte Terz- oder Sextgänge vor. Im Mittelsatz ist dies zum Beispiel in den Takten 31 bis 38 der Fall; siehe Notenbeispiel.] Das Trio muß endlich 9) so beschaffen seyn, daß man kaum errathen könne, welche Stimme von beyden die erste sey. [Beide Oberstimmen haben ungefähr den gleichen Spielanteil und Ambitus und spielen dieselben Motive (siehe auch Anm. 20).]“
Hiermit wird in der ästhetischen Theorie ein genaues Berliner Anforderungsprofil an das instrumentale Kammertrio definiert. Der Abgleich mit Schaffraths Komposition deckt ein Ausmaß der genauen Übereinstimmung auf, das über bloße Zufälligkeiten sicherlich weit hinaus geht. Es ist selbstverständlich heute nicht nachweisbar, ob Johann Joachim Quantz auch diese spezielle Triosonate von Schaffrath kannte und wie er sie möglicherweise eingeschätzt hatte. Hält man sich aber nur an seinen Kriterienkatalog, so kann man feststellen, dass Schaffraths Triosonate diesen Anforderungen in einer der zentralen Schriften der Berliner Ästhetik der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollständig genügt: Theorie und Kompositionspraxis fallen an dieser Stelle in nahezu idealer Weise zusammen.
Rezeption
Die ungebrochene Wirkungsmächtigkeit dieses ehemals Berliner Diskurses zeigt sich noch in den 1790er Jahren, wenn Koch Sulzers Anmerkungen über das Trio wörtlich zitiert. Allerdings konstatiert Koch, dass die bei Sulzer favorisierten Trios – mit drei gleichrangigen, kontrapunktisch geführten Stimmen – zu seiner Zeit bereits aus der Mode gekommen seien (Heinrich Christoph Koch, Versuch einer Anleitung zur Composition, Leipzig 1793, Studienausgabe, hrsg. von Jo Wilhelm Siebert, Hannover 2007, S. 528). Auch Trios mit zwei Haupt- und einer begleitenden Nebenstimme würden kaum noch geschrieben oder gespielt. Koch begründet diese Tatsache mit dem Aufkommen des virtuosen Konzerts und dem zu seiner Zeit beliebteren Quartett:
„Ohngefähr die Mitte dieses Jahrhunderts war derjenige Zeitpunkt, in welchem diese Gattung der Sonate am stärksten bearbeitet wurde, und in welchem viele Tonsetzer sehr schätzbare Producte dieser Art geliefert haben, die aber größtenteils nur durch Abschriften hier und da bekannt worden sind, und die theils wegen des anjetzt beliebten Quartets, theils auch wegen des allgemeinen Hanges der jetzigen Virtuosen zum Concertspielen, ungebraucht vermodern“ (ebd.).
Außerdem erwähnt er noch eine andere Art des Trios, in der nur eine Hauptstimme vom Bass und der zweiten Oberstimme (als einer „Füllstimme“) begleitet wird. Diese Art ist ihm allerdings nur die kurze Bemerkung wert, dass sie „in der Hauptstimme einen sehr reizenden und ausdrucksvollen Gesang“ erfordert (ebd.). Aus der Kürze der Bemerkung könnte darauf zu schließen sein, dass Koch nur wenige erwähnenswerte Beispiele hierfür kannte. Doch war auch diese Kompositionsweise keineswegs neu, wie zum Beispiel der Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner in seinem ca. 1744 entstandenen Trio h-Moll GWV 219 (hrsg. von Vanessa Mayer, Edition Schott, Mainz 2007) für Flöte, Violine und Basso continuo beweist, in dem er der Violine eindeutig die Hauptstimme zuerkennt und die Flöte nur im kurzen Mittelteil des zweiten Satzes „solistisch“ in Erscheinung tritt. Graupner wirkte in Hessen – an der Diskrepanz der musikalischen Tonfälle wird deutlich, wie in sich geschlossen die Berliner und mitteldeutsche Musikwelt im 18. Jahrhundert gewirkt haben muss. Schaffraths Musik müsste für die von Koch imaginierten Zuhörer der 1790er Jahre also bereits damals in jeder Hinsicht veraltet, aber kontrapunktisch gelehrt (und insofern kompositionstechnisch auch „lehrreich“) geklungen haben.
Zweifelsohne lässt sich die Frage bejahen, ob Schaffraths g-Moll-Trio gleichsam in die Berliner Musikästhetik seiner Zeit hineinkomponiert worden sei. Der Vergleich mit allen angeführten Autorenmeinungen ergab keine Differenzen. Gerade weil wir um Christoph Schaffraths pädagogische Interessen wissen, erscheint es nicht fern, auch seinen Kompositionen wenn schon nicht einen klar belehrenden Impetus, so doch wenigstens den Wunsch nach einer gewissen Musterhaftigkeit zu attestieren. Im Nichtabweichen von vorgegebenen Formen und Mustern, im Ausreizen der durch so viele Traditionen klar definierten Grenzen liegt ein wesentlicher Reiz seiner Stücke. Es kommt zu keinem großen Ausbruch, keiner offenen Verletzung der Regeln. Also entscheiden, auch hier der Theorie der Gattung gemäß, gerade die Details über die musikalische Unverwechselbarkeit. Eben diese ästhetische Passgenauigkeit auf allen Ebenen des Tonsatzes und seiner sozialen Einbettung erklärt dann aber auch, warum Schaffrath vor allem nach dem Tode seines Dienstherren Friedrich II. im Jahr 1786, dessen Musikgeschmack schon zu Lebzeiten als überholt gegolten hatte, so schnell und bis vor kurzer Zeit in Vergessenheit geriet.
[Dieser Artikel basiert auf der 2013 geschriebenen Diplomarbeit der Verfasserin.]
Über die Deklamation im 18. Jahrhundert
Anlässlich der Aufführung des Melodrams “Ariadne auf Naxos” von Johann Christian Brandes und Georg Anton Benda an der HMT Leipzig im April 2013 entstand dieser Programmhefttext von Marie Kuijken.
Heutzutage wird in der deutschen Prosodie, also auch beim Vortag oder der Deklamation eines Textes, nicht mehr mit Längen und Kürzen der Silben gerechnet, sondern lediglich mit betonten und unbetonten Silben. Deutsch wird als eine Sprache aufgefasst, in der nur das akzentuierende Prinzip gilt, nicht das quantitierende wie im Altgriechischen und Lateinischen. Im 18. Jahrhundert dachte man anders darüber. Man hat beide Prinzipien im Deutschen klar empfunden und bewusst gelten lassen und in einem speziellen Wissensgebiet, der Metrik, Regeln dazu zusammengestellt. Man wollte verstehen, welche Silben beim Sprechen (eher) lang und welche (eher) kurz seien und welche Verhältnisse zwischen der Dauer und dem Ton einer Silbe wirkten (Betonung oder Tonlosigkeit). Dies alles hatte zum Ziel, bei der Deklamation »Wohlklang und gefällige Bewegung« zu befördern, »der Schönheit wegen, für sich und durchaus« (Johann Heinrich Voß, Zeitmessung der deutschen Sprache [Königsberg 1802], hrsg. von Abraham Voß, Königsberg 1831, S. 3 und S. 109). Man suchte in dem »Gewühl von Wortfüssen […] die höchste, in ihnen mögliche Mannigfaltigkeit« (ebd., S. 108). Friedrich Gottlieb Klopstock meinte dazu: »Sylbenmaß ist Mitausdruck durch Bewegung« (Friedrich Gottlieb Klopstock, Grammatische Gespräche [Altona 1794], in: Klopstock’s sämmtliche Werke, Bd. 9, Leipzig: Göschen 1857, S. 93): Die Bewegung der Wortfüße im rhythmischen Vortrag war seiner Meinung nach nicht nur ästhetisch wichtig, sondern auch ein direktes Hilfsmittel zum Ausdruck und Verständnis des Textinhaltes.
Auch heute kann man diese Wortfüße wieder finden und bewusst ausnutzen, sogar in der Prosa, vielmehr noch in der rhythmischen, ›erhabenen‹ Sprache wie in diesem Melodram von Brandes und Benda. Somit lassen sich bei der Deklamation Abwechslung, größere Kontraste, Bewegung, ein klares Verständnis und eine engere Beziehung zur Musik gewinnen.
Ich selbst habe mich mit dieser Materie seit zirka 15 Jahren in verschiedenen Sprachen und auch mit Bezug auf das gesungene Rezitativ oder auf gesprochene Dialoge in Singspielen beschäftigt. So habe mich gefreut, als ich gebeten wurde, an der HMT Leipzig einen Kurs dazu zu leiten. Das Seminar Die Kunst der Deklamation im 18. Jahrhundert anhand des Melodrams »Ariadne auf Naxos«, das am 18. März 2013 stattfand und das mir Gelegenheit gab, einige Stunden mit den beiden Sängern zu arbeiten, die bei der heutigen Veranstaltung deklamieren werden, war ein erster Schritt in der Richtung, die Schönheit des Deklamierens wieder zu beleben.
Goethe hat einmal vom »deklamatorischen Halbgesang« gesprochen (zitiert nach Emil Palleske, Die Kunst des Vortrags, Stuttgart 1880, S. 129). In der Tat wird die Stimme dabei mit einem größeren Tonumfang angewandt als beim Reden. Rhythmisch ergeben sich deutliche Unterschiede in der Dauer der wichtigen und unwichtigen Silben, durch welche dann sozusagen rhythmische Zellen entstehen, Klopstocks »Wortfüße«. Das alles mag für heutige Ohren zunächst einmal ›künstlich‹ klingen. Aber wenn man sich dafür öffnet, kann einem gerade im Kontext eines Melodrams die zurückgefundene Schönheit und Würde sowie die größere Einheit der Sprache mit der Musik nicht entgehen.
Marie Kuijken
Johann Christian Brandes, Georg Anton Benda und das Melodram „Ariadne auf Naxos“ von 1775
Anlässlich der Aufführung des Melodrams “Ariadne auf Naxos” von Johann Christian Brandes und Georg Anton Benda an der HMT Leipzig im April 2013 entstand dieser Programmhefttext von Michaela Bieglerová.
Die Geschichte des griechischen Mythos von Theseus und Ariadne, der Tochter des kretischen Königs Minos, faszinierte schon lange vor Bendas Melodram Künstler aller Sparten. Ariadnes Schicksal bildete die Vorlage vieler bekannter Werke und inspirierte so bekannte Maler wie Tizian, Peter Paul Rubens und viele andere. Aber nicht nur die Malerei und die Bildhauerkunst griffen den Stoff auf. Auch in der Musik erwachte die Geschichte immer wieder zum Leben, so zum Beispiel in Claudio Monteverdis L’Arianna von 1608 oder in Georg Friedrich Händels Ariadna von 1733.
Die griechische Mythologie überliefert mehrere Versionen der Geschichte und lässt das Ende des Mythos teilweise unerklärt – weshalb Theseus Ariadne auf Naxos zurücklässt, bleibt letztlich im Dunkeln. Bendas Librettist Johann Christian Brandes wählte gerade diese finalen Momente der Handlung für sein Textbuch aus, das auf einer ursprünglich für Weimar geschriebenen Kantate beruhte. In der Vorrede seiner Sämtlichen dramatischen Schriften (Hamburg 1790, neu hrsg. als Meine Lebensgeschichte von Willibald Franke, München 1923) schrieb er zur Entstehung des Textes selbst:
Um […] meiner Gattinn, welche sich durch natürliche Talente und Studium in ihrer Kunst zu dem Range einer beyfallswürdigen Schauspielerinn emporgeschwungen hatte, Gelegenheit zu geben, sich in einer ihren Kräften angemessenen glänzenden Rolle zeigen zu können, schrieb ich das Duodrama »Ariadne auf Naxos«, nach dem Inhalte der bekannten Cantate gleichen Namens, von unserm vortrefflichen Dichter Herrn von Gerstenberg […]. Durch den schmeichelhaften Beyfall, womit die verwittwete Herzogin von Weimar dieß kleine Schauspiel beehrte, ermuntert, gab ich es Schweitzern [Anton Schweitzer] zur Composition. Er arbeitete daran mit Fleiß und Glück, und hatte bereits einige Proben dieses musikalischen Fragments in Gegenwart verschiedener Musikkenner mit dem größten Beyfall aufgeführt, als der unglückliche Schloßbrand in Weimar dem dortigen Schauspiel ein Ende machte, und zugleich eine gänzliche Störung aller Kunstgeschäfte verursachte. Schweitzers musikalisches Meisterwerk blieb unvollendet.
Weiter berichtet Brandes, Schweitzer habe die ursprünglich für Ariadne geschriebene Musik dann 1773 in seiner Alceste verwendet. Gleich nach Brandes’ Ankunft in Gotha habe Georg Anton Benda das noch immer unkomponierte Libretto gelesen
und empfahl das Stück der Durchl. Herzoginn und der weiland Durchl. Prinzessinn Luise. Beyde erhabne Kennerinnen beehrten den Text mit den schmeichelhaftesten Lobsprüchen und wünschten es baldmöglichst mit Musikbegleitung auf der Bühne vorgestellt zu sehn.
Da Schweitzer gerade anderweitig beschäftigt war,
wurde an dessen Stelle Benda aufgefordert, die Composition dieses Duodrama zu übernehmen. Der Durchlauchtige Herzog gab selbst die Idee zu der Kleidung Ariadnens nach altgriechischem Geschmack an; die Dekoration zur Vorstellung wurde zweckmäßig geordnet; in einigen Wochen hatte auch Benda die Composition vollendet, und so wurde diese neue Erscheinung im Januar 1775 in Gotha zum erstenmale, in Gegenwart des ganzen Hofes, auf dem Hoftheater vorgestellt, und mit dem größten Beyfall aufgenommen.
Brandes’ Libretto schildert nicht so sehr die äußere Handlung der Geschichte von der verlassenen Ariadne, sondern lässt das Publikum das innere Drama des Liebespaares erleben. Ausgedrückt werden die Gedanken und Gefühle des Theseus, der, um sie zu beschützen, Ariadne gerade trotz seiner Liebe zu ihr verlassen muss, und die der wehrlosen Ariadne, die im Traum schon eine schlechte Vorahnung des Geschehens erhält. Damit bietet das Libretto eine Deutung der Motivation Theseus’ an, die im Mythos offen bleibt. Brandes lässt sich hingegen nicht von der Version der Geschichte inspirieren, nach der Ariadne verlassen wird, damit sie Bacchus bzw. Dionysos heiraten könne – obwohl gerade diese Interpretation oft in der Bildenden Kunst zum Thema geworden war, beispielsweise in Jacopo Tintorettos Gemälde Bacchus und Ariadne von 1576/78:
Im Vorbericht zum Libretto schreibt Brandes zu seiner neu gefundenen Begründung:
Diese, größtentheils nach dem Diodor ausgezeichnete Fabel, ist in gegenwärtigem Duodrama dahin abgeändert, daß Theseus nicht den höchsten Grad von Undankbarkeit gegen Ariadnen äußert; er verläßt sie nicht so wohl aus Leichtsinn, als vielmehr ihr Leben gegen die Wuth der auf Naxus angelandeten Griechen in Sicherheit zu setzen.
Trotz dieser Änderung entbehrt das Libretto nicht der Wirkung von schicksalhaften, himmlischen oder göttlichen Kräften. Somit wird die Erzählung nicht zum Märchen, sondern behält den Charakter des Mythos:
THESEUS. Ariadne!
Er will sie umarmen, fährt aber zurück.
Welche Gewalt, welche unwiderstehbare Zauberkraft reißt mich zurück?
Will es das Schicksal?
Indem Brandes auf den Ausdruck der Gefühle, des inneren Affektes der Personen, fokussiert, entwickelt er die antike Geschichte aus einem zeitgemäß empfindsamen Blickwinkel neu. Die Antike wird rezipiert, indem Brandes sie für die Ausdrucks- und Gefühlswelt seiner Zeit aktualisiert.
Die erste Aufführung von Bendas Musik zu Brandes’ Melodram erfolgte am 27. Januar 1775 im Schlosstheater Gotha. Die Darsteller waren Brandes Frau Charlotte als Ariadne und Michael Boek als Theseus. Der Hof unterstützte das Vorhaben nach Kräften: Die Herzogin beförderte das Manuskript zum Druck, der Weimarer Maler Georg Melchior Kraus fertigte für Herzog Ernst Skizzen aus, Kostüme und Dekorationen wurden in der damaligen Vorstellung des altgriechischen Stils gestaltet. Nicht nur die Leistungen von Benda und Brandes wurden nach den Aufführungen gelobt, auch die Schauspieler erhielten glänzende Kritiken. August Wilhelm Iffland hielt fest: »Dies war ein Tag des Ruhms für Mme Brandes« (Dramatische Werke, Leipzig 1798, S. 104).
Die Häufigkeit der Aufführungen demonstriert den großen Erfolg von Ariadne aus Naxos. Allein in Gotha war Ariadne zwischen 1775 und 1779 17 Mal zum hören. Weitere 36 Vorstellungen kam in Berlin dazu, die so gut besucht waren, dass das Melodram in das größere Monbijoutheater verlegt werden musste, wo 49 zusätzliche Wiederholungen folgten. Ariadne auf Naxos wurde eine Inspiration für andere Komponisten und veränderte den Umgang mit der Konzeption von Rezitativen. Aber es wurde auch Kritik laut. In seinen Sämtlichen Schriften schilderte Brandes rückblickend die kontroverse ästhetische Debatte, die Benda und er mit Ariadne auf Naxos losgetreten hatten:
Bey allem Beyfall, den dieß Stück, sogleich bey seiner ersten Erscheinung, erhielt, fand es auch strenge Tadler. Sie nannten einen mit Musik verwebten prosaischen Text, der nicht gesungen sondern gesprochen wurde, Unsinn – und sie hatten, wie ich weiter unten bemerken werde, gewissermaßen Recht. Andre behaupteten das Gegentheil, glaubten daß der Ausdruck der Empfindungen und Leidenschaften durch diese musikalischen Zwischensätze mehr Leben und Kraft gewänne. Man stritt und kämpfte, sprach und schrieb so lange für und wider die Sache, bis man endlich darin übereinkam, ein Melodrama wäre zwar Unsinn, aber ein sehenswürdiger anziehender Unsinn, der trotz aller Kritik auf der Bühne eine große Wirkung hervorbrächte […].
Diese »große Wirkung« wollte Brandes dann auch nicht für sich allein reklamieren, sondern war sich sowohl seiner Vorbilder als auch der essenziellen Rolle von Bendas Musik am Erfolg der Ariadne bewusst:
Den durch dieß Stück erworbenen Beyfall muß ich billig mit meinem alten Freunde Benda theilen; auch fordert die Wahrheit das Geständniß, daß ich mir nicht die Ehre der Erfindung dieser neuen Gattung von Dramen zueignen kann; diese gehört eigentlich dem berühmten Rousseau, der schon einige Zeit zuvor seinen Pygmalion, das erste Stück dieser Art, schrieb […]. Nur bin ich der Erste unter den deutschen Dichtern, welcher es wagte, diese Gattung Schauspiele auf die vaterländische Bühne zu bringen.
Michaela Bieglerová
„Furcht und Freude, Leben und Entsetzen“: Die Geburtsstunde des Melodrams in deutscher Sprache
Anlässlich der Aufführung des Melodrams “Ariadne auf Naxos” von Johann Christian Brandes und Georg Anton Benda an der HMT Leipzig im April 2013 entstand dieser Programmhefttext von Felicitas Freieck.
Die Rezeptionsgeschichte antiker Dramen in der Musik ist lang – und wenn der Mythos von Ariadne und Theseus auch nicht am Anfang des modernen Musiktheaters stand, so repräsentiert er doch einen ersten Meilenstein in seinem weiteren Werdegang: Bereits im Jahre 1608 nämlich vertonte Claudio Monteverdi den Stoff in seinem Werk L’Arianna und bestätigte damit endgültig das dramaturgische Potenzial der Oper als Theatergenre. Ende des 18. Jahrhunderts dann nahm sich die Weimarer Schauspieltruppe von Abel Seyler des antiken Mythos wieder einmal an und setzte einen weiteren Meilenstein, indem sie mit Ariadne auf Naxos das Fundament für die Entwicklung und Verbreitung einer im deutschsprachigen Raum neu aufkommenden Gattung legte. Der Gothaer Hofkapellmeister Georg Anton Benda, welcher nach einigen Verwicklungen mit der musikalischen Ausgestaltung dieses Melodrams beauftragt war, unterlegte die Textvorlage von Johann Christian Brandes so mit Musik, dass die Rezitation der Akteure einerseits immer wieder den bildhaften, tonmalerischen Einwürfen des Orchesters zu weichen hatte, andererseits mit charakterisierender Musik unterstützt wurde:
Dieses Prinzip von minutiös aufeinander abgestimmten reduzierten, plötzlich abbrechenden musikalischen Gesten und deklamiertem Text setzte einen komplett neuen ästhetischen Anspruch voraus, welcher nicht nur auf kompositorischer, sondern besonders auf dramaturgischer Ebene den Maßstab des Musiktheaters um einiges höher legte als bisher. Die Spannweite des subjektiven Gefühlsausdrucks umfasste zudem neben dem »Schönen und Erhabenen« nun auch das »Schreckliche und Grauenerregende« als der ästhetischen Gestaltung angemessenem Parameter – ganz im Sinne der nur wenige Jahre zuvor von Gotthold Ephraim Lessing verfassten Hamburgischen Dramaturgie, welche sich auf Aristoteles berief und das »Mitleiden« des Publikums als wesentlichste Wirkung eines Theaterstücks auf den Zuschauer deklarierte. Ariadnes Sturz in den Tod ist ein prägnanter Ausdruck dieses Topos:
Innerhalb Europas war Bendas und Brandes’ Ariadne jedoch nicht der erste Entwurf dieser Theatergattung gewesen. Bereits 1762 hatte Jean Jacques Rousseau bei der Arbeit an seinem Bühnenwerk Pygmalion an eine ähnliche Art der Vertonung gedacht und gesprochene Szenen mit musikalischen Intermezzi abwechseln lassen. Wie genau Benda damit vertraut war, ist unklar. Die Kenntnis erscheint immerhin möglich, wenn man um das große Interesse des Gothaer Hofs an der französischen, in erster Linie der Pariser Kultur weiß. Brandes jedenfalls hatte von Rousseaus Experiment gehört und benannte es im Vorwort einer späteren Ausgabe seines Librettos als einen Vorläufer des eigenen Textes.
Die Uraufführung der Ariadne fand in Gotha unter Beteiligung der gesamten Hofkapelle statt und wurde sowohl für die (ungewöhnlicherweise) weibliche Hauptdarstellerin als auch für Benda ein triumphaler Erfolg. Bei Schwickert in Leipzig erschien das Werk im Druck, nach einigen Jahren »zum Gebrauche gesellschaftlicher Theater« auch in einer Bearbeitung mit solistischer Streichquartettbegleitung und bezeichnenderweise mit alternativer französischer Textfassung. 
In den Bestandskatalogen von Breitkopf wurde mehrere Jahre vorher bereits die Partitur und ein Klavierauszug angezeigt. Ariadne auf Naxos konnte damit überall studiert und aufgeführt werden. Bedenkt man, in welchem Ausmaß das Werk bisherige Normen des deutschen Musiktheaters sprengte, ist dies keinesfalls als selbstverständlich anzusehen. Die Kritik fiel dennoch weitgehend positiv aus. So beurteilte Johann Nikolaus Forkel die neuartige Symbiose von Musik und Dialog im Gegensatz zum bisher Gewohnten als weitaus »begreiflicher und faßlicher«, während im Gothaer Theaterjournal gar von »Bewunderung und Ehrfurcht« für Bendas und Brandes’ Melodram die Rede war. Ähnlich euphorisch gab sich der Musikalische Almanach auf das Jahr 1772: »Eine so echt genialische Musik war in den Mauern unserer deutschen Schauspielhäuser noch nicht erschollen. Wem ist nicht beim Anhören der Ariadne Furcht und Freude, Leben und Entsetzen angekommen? Herr Benda brachte uns die neue Kunst des Melodramas, worinnen nicht gesungen wird, wo aber das Orchester gleichsam beständig den Pinsel in der Hand hält, diejenigen Empfindungen auszumalen, welche die Deklamation des Akteurs beseelen.«
Dass selbst eine schöpferische Koryphäe wie Wolfgang Amadé Mozart mehrmals seine Bewunderung für die neuartigen Kompositionstechniken Bendas aussprach, lässt erkennen, welchen Eindruck die Neuerungen hinterlassen hatten. In einem Brief vom 12. November 1778 schreibt er: »In der That, mich hat noch niemals etwas so surprenirt! Denn ich bildete mir immer ein, so was würde keinen Effect machen«. Er habe die Ariadne jedoch »mit dem größten Vergnügen aufführen gesehen«.
Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus erwies sich die Adaption als attraktiv – so sehr, dass die bereits genannten Fassungen mit geringerer Instrumentierung für den »Gebrauch gesellschaftlicher Theater« eingerichtet wurden und es in den Folgejahren eine Reihe weiterer Melodram-Neukompositionen gab. Teilweise versuchte man, die Melodramtechnik in Opern umzusetzen, um den statischen, wenig dramatischen Charakter der Arie aufzulockern (z. B. bei Mozart und Carl Maria von Weber). Ariadnes Tod erwies sich für das Musiktheater um 1800 also als ein temporärer Neuanfang…
Felicitas Freieck