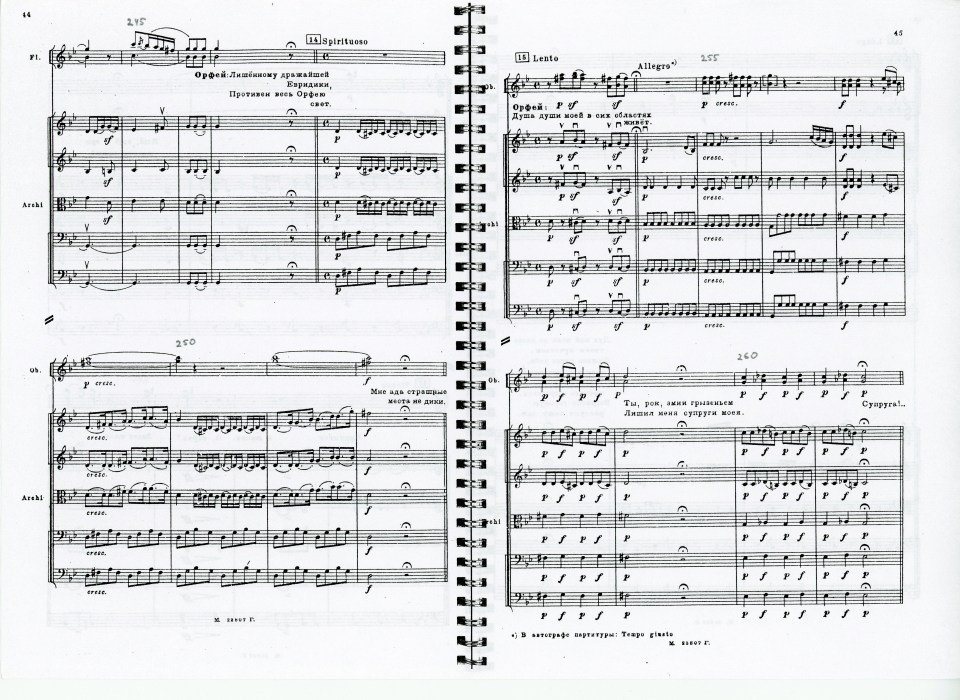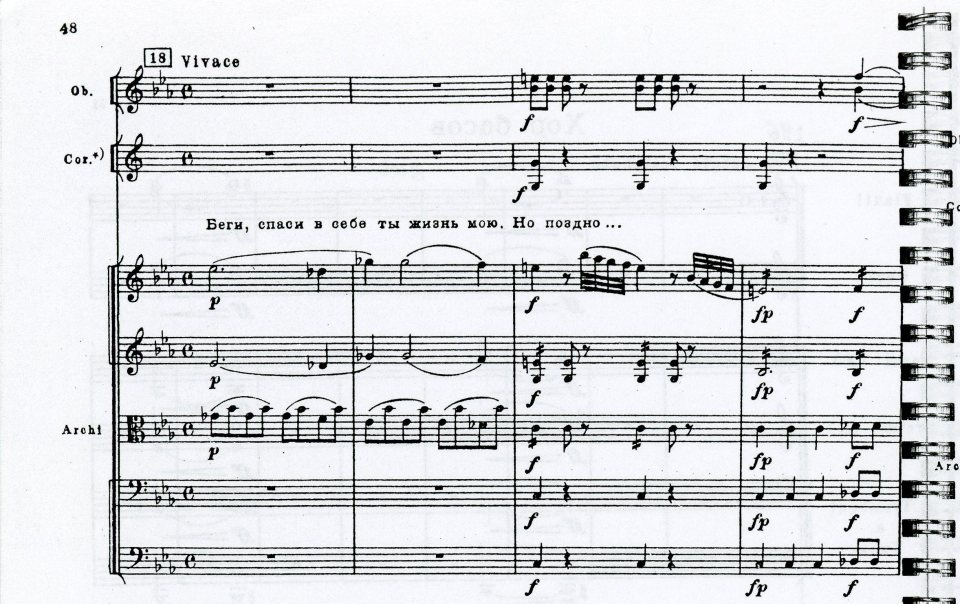Startseite » Beitrag veröffentlicht von muwileipzig (Seite 5)
Archiv des Autors: muwileipzig
Stephan Krehl, „Musikerelend“, Teil VII

Stephan Krehl (1864–1924)
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephanKrehl.jpg
Im Jahre 1912 erschien das Buch »Musikerelend« des Komponisten und Musiktheoretikers Stephan Krehl (1864–1924). Krehl, seit 1902 am Leipziger Konservatorium tätig und von 1907 bis zu seinem Tod Leiter der Institution, stellte dort laut Untertitel »Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf« an. Sie sind polemisch formuliert und geben unmittelbare, heute teils kurios anmutende Einblicke in seine Sicht des Musiklebens, insbesondere mit Blick auf die soziale Stellung der Musiker_innen, in einer Zeit des Umbruchs.
Stephan Krehl (1864–1924):
Musikerelend
Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf
[Teil VII – Schluss]
Leipzig: C. F. W. Siegel [1912].
[99] 6. Mehr Liebe.
Erscheint es nicht sonderbar, den Künstlern, welche schon genug von Liebesaffären aller Art in Bewegung gehalten werden, noch mehr Liebe wünschen zu wollen? Davon, daß die geschlechtliche Zuneigung sich mit größerer Wärme entfalte, soll aber wahrhaftig auch nicht die Rede sein. Diese Liebe könnte eher von Zeit zu Zeit zur Beruhigung kalt übergossen werden. In guter oder übler Weise bricht sie ja doch immer wieder stark genug von selbst hervor. Eine reine und edle Zuneigung zwischen jungen Leuten ist gewiß etwas Herrliches. Ohne Liebe wird der Mensch, vor allem der künstlerisch veranlagte Mensch, fast stets ein armes und unvollkommenes Geschöpf sein. Zwischen Liebe und Liebe ist aber ein gewaltiger Unterschied. Fast häufiger als eine echte, beseligende Liebe läßt sich ein unangenehmes Flirten, ein Profanieren der Liebesgefühle beobachten. Oft genug auch dringt die Kunde von skandalösen Betätigungen perverser Neigungen zu uns, woran die öffentliche Meinung unglaublicherweise sehr wenig Anstoß nimmt. Müßte nicht viel energischer gegen die falschen und unsauberen Triebe angekämpft werden? Sind sie doch unschön, enorm schädlich und empörend. Wer es allerdings für unpassend erachtet, mit der Jugend über sexuelle Probleme zu sprechen, wird lieber zusehen, wie im stillen eine Vergiftung und Zerstörung weiter schreitet, als daß er selbst an öffentlicher Aufklärung teilnimmt und zur Aufdeckung von Schäden auch nur einen Finger rührt. Die Ansichten über Moral und Schicklichkeit sind leider gerade in den Kreisen recht verworren, welche viel auf äußeren Anstand geben. Begegnet man doch Leuten, die nichts darin finden, mit Lebemännern, Ehebrechern, perversen Naturen aller Art zu verkehren, solange diese Ehrenmänner nur behaupten »Gentlemen« zu sein und solange sie der sogenannten guten Gesellschaft angehören. Einen armen [100] aber sittenreinen Atheisten der unteren Klassen weisen diese empfindsamen Naturen schroff von sich und verdammen ihn. Doch gleichgültig wie die Liebeleien beschaffen sind. Nur gar zu leicht üben sie einen ungünstigen Einfluß aus. Wieviel Zeit, wieviel Kraft, wieviel Arbeitslust wird bei all den scheinbar unschuldigen Liebeständeleien unnütz vergeudet. Für viele Jünglinge ist »von Liebe erfaßt« gleichbedeutend wie »mit Blindheit geschlagen«. Und in der Blindheit tappt der Betörte hin und her, ohne zu wissen, was war und was kommen wird, ohne entschlußfähig zu sein, ohne vernünftig arbeiten zu können. Auf irrige Bahnen wird die Jugend nur zu leicht durch falsche Vorbilder gelockt. Unglaubliche Beispiele grober Sinnlichkeit und unkultivierter Liebe werden in der modernen Literatur ausgiebig genug als scheinbar ideale Muster vorgeführt. Ist es schließlich verwunderlich, daß auf kritiklose und lüsterne Anbeter des Modernismus die rohen Naturschilderungen intensiver als vornehme Idealbilder wirken? Sollte der Künstlerjugend ein Vortrag über die geschlechtliche Liebe gehalten werden, dann wäre wohl in erster Linie zu größter Mäßigung, zur Zähmung allen Ungestüms aufzufordern.
Eine andere Liebe könnte aber mehr erstarken: die echte Hingabe an die Kunst, die Aufopferung für eine große und heilige Sache. Leider ist nicht zu bestreiten, daß die neuerdings allgemeinere Beschäftigung mit den Künsten die Liebe zu ihnen nicht vermehrt hat. Begegnet man doch jetzt einer spekulationslosen Liebe zur Kunst selten genug. In unausstehlicher Manier brüsten sich die einen mit ihrer Kunstbegeisterung; andere geben deutlich zu erkennen, daß ihnen die Beschäftigung mit der Kunst nur der Vorwand für irgendeine Machenschaft ist. Selbst begabte Künstler neigen dazu, aus der Kunst ein Geschäft zu machen. An dem jüngsten Künstlernachwuchs ist unleugbar eine unangenehme Blasiertheit, ein verletzender Indifferentismus auffallend. Überall ist [101] der Mangel an bescheidener, aber inniger und ehrlicher Hingabe an die Kunst zu spüren. Wie die Künstler kalt und berechnend, so sind ihre Werke frostig und berechnet. Alle eigenartigen Dissonanzfolgen würden ja gar nicht weiter stören, wenn nur in ihnen eine große melodische Bewegung zu verspüren wäre. Vom wahren musikalischen Ausdruck, welcher in seiner melodischen Folge den Hörer zwingt, ist aber da gar nichts zu konstatieren. Die musikalische Rede ist nicht fließend; nur ein Lallen, ein Stammeln in unzusammenhängenden Phrasen wird vernommen. Durch ein ganz apartes Verfahren im Auszieren und Verbinden unbedeutender Floskeln vertuscht der Tonkünstler die Hilflosigkeit in der großen Diktion. Die Sache wird auch dadurch nicht geistreich, daß von unverständigen Schwärmern die Unkultur in solchen liebeleeren Werken als Impressionismus entschuldigt und verherrlicht wird. Mag das auch sehr gelehrt klingen: impressionistische Musik; die Bezeichnung bessert doch an einer verfehlten Tonschöpfung nichts. Für die Musik ist es überhaupt durchaus sinnlos, von Impressionismus zu sprechen.
Die Maler hatten wohl seinerzeit vollkommen recht, als sie die Rückkehr zur Natur verlangten und an Stelle der Atelierbeleuchtung die freie Belichtung in der Natur forderten. Die Musik gibt aber nichts, wie es ist, wieder, sondern deutet alles mir symbolisch aus. Wenn das malerische Verfahren in der Musik überhaupt zur Anwendung kommen sollte, könnte höchstens von einer impressionistischen Symbolik oder einem symbolischen Impressionismus gesprochen werden. Die Zeloten unter den impressionistischen Malern begnügen sich ja aber nicht einmal damit, eine größere Natürlichkeit zu erzielen, sie streben noch eine Spezialität an. Als ob sie die Natur mit halbgeschlossenen Augen oder wie Kurzsichtige betrachtet hätten, so lassen sie in den Gemälden alle scharfen Konturen verschwinden und in den Nebeln vergehen. Der Zuschauer soll die absonderlich verschwommenen Darstellungen gleich[102]falls mit getrübtem Blick genießen. Bei den extrem impressionistischen Musikschöpfungen müßte dementsprechend der Zuhörer die Ohren zukneifen. Am besten wäre es vielleicht, sie vollkommen zu verstopfen. Das ist wohl aber gar nicht die Ambition der neuen Musikheiligen, nur halb gehört oder gar überhört zu werden. Sie kommen im Gegenteil in aufdringlicher Art dem Hörer näher und belästigen ihn über Gebühr. Klingen Tonfolgen außergewöhnlich bizarr, so glauben Überkluge deshalb auf Exotik schließen zu müssen. Allerdings sind in letzter Zeit neuerungssüchtige Tonpoeten nicht selten orientalischer Abstammung gewesen. Solchen geschäftsklugen Exoten mag das rein germanische Musikempfinden bisweilen abgehen. Im Grunde ist aber doch all die polyphone Musik, mag sie genannt werden wie sie will, als eine Variierung unseres Tonsystems zu erklären, von ihm aus abzuurteilen. Die Tonfolgen in neuzeitlichen Musikwerken fallen nicht auf, weil sie impressionistisch oder exotisch, sondern weil sie gekünstelt und unnatürlich sind. Das Gefühl, der Komponist habe nur aus Reklamebedürfnis geschrieben, läßt den Hörer nicht los. Spürt derselbe die sensationelle Mache, so wird er nicht gepackt und begeistert, er wird abgestoßen und verärgert. Den absonderlichen Schöpfungen fehlt eben zu sehr die erwärmende Liebe. Jeder Kundige weiß ja, daß sich Dissonanzfolgen, wie sie neuerdings in der Musik üblich sind, ungleich leichter als Folgen von Konsonanzen, Kontrapunkte, welche harmonisch nicht übereinstimmen, sich schneller als harmonsichc Gegenstimmen bilden lassen. Nicht wenige Tonsetzer experimentieren ganz unbekümmert; sie empfinden genau, wieviel sie sich leisten können, ohne als Ignoranten verschrien zu werden. Man ist raffiniert nachsichtig. Werden doch selbst ungesund frühreifen Wunderkindern die Fehler, die sie begehen, nicht angerechnet und ihnen dadurch Augenblickserfolge verschafft, wie sie selbst ausgereifte Künstler selten zu verzeichnen haben. [103] Auch in solchen Fällen wird der Dilettantismus in der Arbeit, das Ungeschick im Kontrapunktischen, die Fahrlässigkeit in der Klangverbindung als genialer Impressionismus bezeichnet. Und damit ist die Kritik vollendet.
Bei jeder geschäftlichen Unternehmung spielt die Inszenierung eine gewichtige Rolle. Kunstschöpfungen sind jetzt bisweilen scheinbar nichts anderes als geschäftliche Unternehmungen. Da müssen die Komponisten sich vorsorglich um eine geschickte Aufmachung kümmern. Viele Musiker sinnen und sinnen auf Reklamemittel, um sich bemerkbar zu machen. In der Musik ist es natürlich viel schwerer als auf anderen Gebieten, für die man schon mit einem einfachen Polizeiverbot werben kann, Aufsehen zu erregen. Ein Boxer, eine Nackttänzerin, ein unpassendes Possenspiel, denen das öffentliche Erscheinen anfangs versagt war, finden nach Aufhebung der über sie verhängten Sperre einen ungeahnten Zulauf. In der Musik hat man Polizeiverbote noch nicht zu Reklamezwecken ausnutzen können, weil die Behörden ein gemeingefährliches Treiben in den Kompositionen zurzeit nicht feststellen konnten. Ohne Zweifel sind aber viele Musikwerke wenn auch nicht gemeingefährlich, so doch durchaus anrüchig und verwerflich. Da nützen alle Rechtfertigungen nichts, die Musik wolle wie andere Künste zur Natürlichkeit oder gar zur naivprimitiven Einfachheit zurückkehren. Unterscheidet sich doch die Musik vollständig darin von den anderen Künsten, daß ihre Sprechweise nichts der Natur Abgelauschtes, sondern ein Kunstprodukt ist, an dessen Vervollkommnung Genies jahrhundertelang gearbeitet haben. Die Hauptherrlichkeit dieses kunstreichen, mit solch unendlicher Liebe konstruierten Aufbaues, die Selbständigkeit der Stimmführung, die Melodie soll mit einem Male beiseite gelassen werden und Ersatz in einem ganz törichten, lieblosen, harmonischen Verfahren finden. Nein! So äußert sich niemals die echte Kunstbegeisterung. Das sind nur Schwindelmanöver, um [104] Originalität vorzutäuschen. Die Nichtigkeit der inneren Anlage entgeht einem achtsamen Menschen nicht, mag der Autor dank einer glücklichen technischen Begabung seiner Schöpfung auch ein glänzendes Äußere verliehen haben. Lieblos erfundene Kompositionen werden niemals imstande sein, bei dem Hörer Liebe zu erwecken.
Mögen größere Werke noch so kalt und unempfunden erscheinen, sie sind doch immerhin erfunden worden. Zum Komponieren gehört stets technisches Geschick, welchem wir bei allem Jammer über den Mangel an Herz und Seele unsere Bewunderung nicht vollständig versagen können. Wie tief beklagenswert sind nun erst alle Personen, die sich ohne Liebe und ohne Begabung der Kunst widmen. Unglückliche werden der Kunst zugeführt, weil sie für andere Berufe zu dumm sind. Von denen wollen wir nicht weiter sprechen. Können diese doch keine ernste Zuneigung zum Beruf haben; denn selbst dazu sind sie zu unbegabt. Mehr wie genug arme Schlucker werden aber Künstler, nur um das tägliche Brot zu verdienen. Diesen Bedauernswerten fehlt zu fruchtbringender Beschäftigung mit der Kunst in vielen Fällen seelische und geistige Bildung, ferner aber auch fast stets die echte Liebe zur Kunst. Und selbst die jungen Leute, welche sich angeblich aus freier Wahl dem Künstlerberuf zuwenden, sind bisweilen entsetzlich lau in ihren Bestrebungen. Wäre es bei flammender Begeisterung möglich, daß die Studien so einseitig, ja interesselos betrieben würden, wie wir es nicht selten festzustellen verpflichtet sind. Was sich nicht als direkt nutzbringend erweist, wird von vielen Schülern ignoriert. Für die Geschichte der Musik, für die Entwicklung der Formen, für die Kunst des Vortrags, der Phrasierung ist nicht eine Spur von Teilnahme zu bemerken. Nur der törichte Ehrgeiz, sich einmal als Sänger, als Virtuos auf dem Podium zu zeigen, mit irgend etwas vor der großen Menge zu prahlen, gibt einen äußeren Anlaß zur Beschäftigung mit der Kunst. In ihrem Aufbau, nach ihrer [105] Herkunft sind die Musikstücke für den Vortragenden bedeutungslos. Der kümmert sich ja doch nur darum, ob die Werke ihm gelegen sind, ob er damit Erfolg haben kann. Auf die Frage nach der Liebe zur Kunst würde man wohl von einem solchen Enthusiasten mehr wie einmal zu hören bekommen: »Die Kunst liebe ich nur so lange, als sie mir dienlich ist. Was habe ich denn auch von ihr zu erwarten? Sie kann mir doch nicht alles ersetzen, was ich für sie aufwende!«
Wenn sich allerdings die Liebe zur Kunst immer nach dem äußeren Nutzen richtet, der aus dem Verhältnis zu ihr resultieren kann, dann wird es eventuell schlecht um sie bestellt sein. Was sollen da Komponisten sagen, die Jahrzehnte lang arbeiten, Dutzende von guten Werken veröffentlichen, ohne auch nur das geringste damit zu verdienen? Es ist ja immerhin denkbar, daß diese Strebsamen in der Absicht arbeiten, doch einmal ein Geschäft machen zu können. Bewundernswert bleibt jedenfalls die Beharrlichkeit, mit welcher solche Autoren weiterschaffen, mögen sie auch schlecht gemacht werden, sowie sie sich an die Öffentlichkeit wagen.
Der Uneingeweihte ahnt freilich nicht, was den wahren Künstler, dem man selten genug begegnet, zwingt, selbst dann unermüdlich zu schaffen, wenn er auch nicht anerkannt, wenn er mißverstanden oder gar verunglimpft wird. Es ist die innige, heiße Liebe zur Kunst, die anspruchslose Hingabe, die nichts fordert. Tausendfach wird sie aber doch belohnt. Kann jemand größere und reinere Wonnen durchkosten als ein Künstler, der ganz in dem Erschaffen eines Werkes aufgeht? Welch unendliche Seligkeit überkommt einen so von Gott Begnadeten! Gar mancher würde sicher gern ein eben vollendetes Kunstwerk hinopfern, wenn er nur durch dieses Opfer seinen heißen Dank für die Stunden höchsten Glückes, höchster Befriedigung abstatten könnte, welche ihm beim Komponieren zu teil geworden sind. Die reine Liebe zur Kunst wird dem [106] echten Künstler wahrhaftig köstlich vergolten, wenn er auch kein Geld verdient und keinen Ruhm gewinnt.
Eine selbstlose Liebe soll aber keineswegs als Spezialität einzelner Komponisten gepriesen werden. Auch praktische Musiker aller Art sind schwärmerisch ihrer Kunst ergeben und wirken in rührender Aufopferung, ohne Klagen laut werden zu lassen, wenn für alle verwendete Mühe eine Entschädigung äußerlich nicht erzielt wird. Innerlich sind sie ja doch unermeßlich reich belohnt worden. Die Denkweise, der Empfindungsreichtum solch hingebungsvoller Naturen müßte der Jugend immer von neuem zum Muster vorgehalten werden. Leider ist nur zu häufig der äußere Lebenslauf der stillen Arbeiter so unendlich einfach, daß seine Beschreibung als nicht lohnend erscheint. Die Welt erfährt daher nichts von dieser wirklichen Vornehmheit und Größe der Gesinnung. An den Beispielen von Aufopferungsfreudigkeit, von unspekulativem Sichversenken könnten die jungen Leute gewiß gar viel lernen. Wird jemals etwas Gutes entstehen, wenn die Liebe zum Beruf fehlt? Liegt es nicht jedem Verständigen unbedingt am Herzen, nach Kräften alle Mitstrebenden durch Wort und Tat zu hingebender Aufopferung anzufeuern? Der Kampf gegen die Kalten und Begeisterungslosen, welche der Kunst nichts nützen, muß mit Energie geführt werden. Gewissenlose versuchen durch Vernichtung des Gefühls der Pietät die verehrungsvolle Liebe zur Kunst im Keime zu ersticken. Solch verderblichem Treiben gilt es Einhalt zu tun. Die Ehrfurcht vor der erhabenen Größe der Meisterschöpfungen früherer Zeiten darf uns niemand in frevelhaftem Leichtsinn rauben wollen. Eine traurige Richtung in der modernen Kunst will sich durch Verunglimpfen anerkannter Werke bemerkbar machen und damit etwas zur Selbstverherrlichung bei tragen. Das kann zu keinem guten Ende führen. Baut doch jede neue Richtung auf einer vergangenen auf. Wer die Vergangenheit mißachtet, zieht sich selbst den Boden unter den Füßen fort.
[107] Vielleicht ist der Mangel an vornehmer Gesinnung, das Fehlen einer aufrichtigen Liebe zur Kunst ein Hauptgrund für all die elenden Zustände im Beruf des Musikers. Uns dünkt es daher eine Pflicht zu sein, in allen Kreisen, welche sich ernstlich mit der Musik befassen wollen, zu einer aufrichtigen Begeisterung anzufeuern. Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit, laue Empfindungen taugen nichts für Kunsteleven. Wer nicht einen innern heißen Drang zur Betätigung auf künstlerischem Gebiete spürt, der bleibe fern. Zum Lebensberuf wähle er irgend etwas anderes als die Kunst. In ihr läßt sich nichts leisten, wenn nicht alles Tun in rührender Aufopferung durch eine grenzenlose Zuneigung bestimmt wird. Ganz gleichgültig, ob jemand nur eine bescheidene Stellung auszufüllen hat oder dank seiner hervorragenden Anlagen zu Großem berufen ist: die himmlische Kunst verträgt keinen Kleinmut. Vom Publikum wird der Wert eines Künstlers nach dem Ruf, den er hat, taxiert. Daß ein äußeres Renommee, eventuell durch Reklame hergestellt, mit dem inneren Wert des Menschen nichts zu tun hat, wissen die Einsichtigen. In ihrer idealen Bedeutung sind alle Künstler, die es von Grund aus ehrlich meinen, gleich hoch einzuschätzen. »Meister ist jeder und gleich ein jeder der Größten und Besten, wenn er das Eigenste gibt, was er wie Keiner vermag«. Das Eigenste zu geben, wird ihm nur glücken, wenn er sich in schwärmerischer Liebe, ohne jeden Vorbehalt der Kunst hinopfert. Von dem reichen Empfindungsleben etwas auf die mitstrebenden Kunstgenüssen zu übertragen, muß ein herrliches Bewußtsein für ihn werden. Die Werke sind ja doch vergänglich; nur Kunstschöpfungen eines Genies ist ein längeres Dasein beschieden. Die Liebe aber lebet in Ewigkeit fort. Wer ihrer teilhaftig gewesen ist, dessen Wirken wird auch für alle Zeiten gesegnet sein.
Stephan Krehl, „Musikerelend“, Teil VI

Stephan Krehl (1864–1924)
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephanKrehl.jpg
Im Jahre 1912 erschien das Buch »Musikerelend« des Komponisten und Musiktheoretikers Stephan Krehl (1864–1924). Krehl, seit 1902 am Leipziger Konservatorium tätig und von 1907 bis zu seinem Tod Leiter der Institution, stellte dort laut Untertitel »Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf« an. Sie sind polemisch formuliert und geben unmittelbare, heute teils kurios anmutende Einblicke in seine Sicht des Musiklebens, insbesondere mit Blick auf die soziale Stellung der Musiker_innen, in einer Zeit des Umbruchs.
Stephan Krehl (1864–1924):
Musikerelend
Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf
[Teil VI]
Leipzig: C. F. W. Siegel [1912].
[86] 5. Unwissende Musikschüler.
Einen großen Teil der Schuld an den so unerfreulichen Zuständen in der Musik trägt die schlechte allgemeine, musikalische Ausbildung. Dafür werden kurzerhand den Musikschulen schwere Vorwürfe gemacht. Ihre Unzulänglichkeit soll das Elend bedeutsam fördern helfen. Natürlich meint man bei den Angriffen auf die Musikschulen die Lehrkräfte, welche an diesen tätig sind. Konservatoriumslehrer sind in den Augen kritisierender Nörgler nichts anderes als rückschrittliche Pedanten, die für ihre Schüler nur einen Hemmschuh bilden, ihnen zum Ärgernis gereichen. Gar mancher schimpfende Kritikaster entblödet sich freilich nicht, trotzdem im Geheimen um eine Stelle an einer Musikschule nachzusuchen und eine Berufung an eine solche als höchst vorteilhaft anzusehen.
Das ist zunächst außer Zweifel, daß die Unterrichtstätigkeit ohne Aufhören fortschrittlich sein soll. Verlangt doch die einfache Logik, daß die Schüler bei ihrem Unterricht eine Musik betreiben, die mit derjenigen, welche ihnen tagtäglich in Konzerten, im Theater zu Gehör kommt, halbwegs im Einklang steht. Es brauchen ja nicht gleich die Werke von zweifelhaften Stürmern in Betracht gezogen zu werden. An den gewissermaßen klassischen Werken des musikalischen Fortschrittes kann man aber doch nicht taub und stumm vorübergehen. Nach landläufigen Begriffen sind klassisch allerdings nur Werke, welche nach langer Zeit noch frisch am Leben sind. Wir stehen aber nicht an, auch diejenigen Werke als klassisch zu bezeichnen, welche dank ihrer Vollkommenheit augenscheinlich ein langes Leben vor sich haben. Nichts kann dagegen sprechen, den von jeher als klassisch bezeichneten Kompositionen etwa eine »Faustsymphonie« von Liszt, eine F-dur-Symphonie von [87] Brahms oder einen »Till Eulenspiegel« von Strauß ebenbürtig an die Seite zu stellen. Sind das doch Werke, in denen sich rein musikalisch alle Teile wunderbar zum Ganzen fügen.
Sicherlich stehen mehr wie genug Lehrer allen Fortschritten teilnahmlos gegenüber. Dadurch befinden sie sich bedauerlicherweise nicht nur zur Musik, sondern auch zur Jugend, die stets, wenn auch kritiklos, so doch mit Begeisterung an jeder Neuerscheinung festhält, in Opposition. Wohl ist die Rückständigkeit nicht überall gleichstark. Bei Ausbildung in der praktischen Musik beispielsweise liegen die Verhältnisse regulär nicht so ungünstig, wie bei Ausbildung in der Theorie. Schon durch die Verhältnisse werden Klavierspieler, Geigenvirtuosen gezwungen, neuere Literatur zu studieren. Auf theoretischem Gebiete kommt es buchstäblich vor, daß noch nach einem System weiter unterrichtet wird, in welches die Musik, wie sie etwa vor 150 Jahren existierte, nicht einmal hineingepaßt hat. Die letzten Jahrzehnte musikgeschichtlicher Entwicklung sind an den in diesem Sinne aufgestellten Theoremen spurlos vorübergegangen. Erklärungen, deren Sinnlosigkeit längst erwiesen ist, werden ruhig weiter abgegeben. Zustände derart scheinen nur in der Musik möglich zu sein. Ist es denkbar, daß in irgendeiner Wissenschaft wirklich bestehende, nachgewiesene Fortschritte einfach ignoriert werden? Da würde ein rückständiges Lehrbuch sofort der Lächerlichkeit anheimfallen. Noch jetzt werden Harmonielehrbücher veröffentlicht, in denen nachgewiesene Unrichtigkeiten von neuem zum Vortrag gelangen; Formenlehren bringen falsche Erklärungen der Elementarbildungen; Kontrapunktschriften erscheinen, in denen Stimmführungen, welche die Praxis längst als richtig erkannt und verwendet hat, verboten werden. Zu welchem Zweck geschieht das alles? Warum wird die natürliche freie Entwicklung so unnütz aufgehalten?
Nun ist aber doch festzustellen, daß die Rückständigkeit kein [88] spezifisches Zeichen der Musikschullehrer ist. Überall begegnet uns solch lästige konservative Gesinnung. Grund dafür ist eine gewisse Bequemlichkeit, eine Trägheit. Hat ein Musiker eine Lehrweise einmal kennen gelernt, so behält er sie bei, komme, was da kommen will. Er sträubt sich dagegen, in späteren Lebensjahren umzulernen. Nicht selten fehlt auch die geistige Beweglichkeit, bedeutsamen neuen Doktrinen freudig zustimmen zu können. Nur ein geringer Teil der Musikschüler erhält ja eine genügende Ausbildung. Die Zeit, welche dem Studium gewidmet wird, ist meist viel zu kurz. Nicht wenige lernen lediglich die Harmonielehre kennen oder bleiben wenigstens schon in den Anfängen des Kontrapunktes stecken. Da kommt ihnen dann gar nicht recht zum Bewußtsein, wieviel, namentlich nach Absolvierung einer veralteten Methode, zum Verständnis, zur Erklärung der neuen Musik noch fehlt. Will wirklich einmal ein Musiker, der in der Jugend versäumt hat die Elemente der Musik richtig zu erlernen oder dem eine praktische Erziehung vorenthalten worden ist, in späteren Lebensjahren gern das Versäumte nachholen, dann mangelt es fast immer an Zeit, an Ruhe, an Geduld, um die Lücken auszufüllen. Auch die Mittel zu erneutem Studium sind nicht ohne weiteres vorhanden. Unzufriedenheit, das Gefühl der Unzugänglichkeit beherrscht nun solch armen Menschen und verkümmert ihm die Freude an der Arbeit, den Genuß an der Kunst. Ein hervorragend begabter und einsichtiger Lehrer wird höchst wahrscheinlich in kurzer Zeit seine Schüler besser als ein mißmutiger Musikant fördern können. Was liegt einem Menschen, der am Unterrichten kein Interesse hat und nur aus Verzweiflung Stunden gibt, an seinen Schülern? Weder der eine noch der andere vermag aber schließlich etwas auszurichten, wenn die Ausbildungszeit überhaupt zu kurz bemessen ist. In wenigen Monaten kann man die enorm schwierige Kunst weder lehren noch lernen. Schon bei Seminarmusiklehrerprüfungen werden recht beträchtliche Anforderungen [89] gestellt. Ein Pianist beispielsweise hat nicht nur durch Vortrag von Klavierstücken aller Art seine technische Fertigkeit darzutun, er muß auch in der Geschichte des Klavieres, in den Stilarten der Spielweisen, in der formellen Gestaltung der Klavierkompositionen genau Bescheid wissen. Die Anatomie der Hände, die Grundlage der Akustik, die Eigenart der Orchesterinstrumente, die eventuell mit dem Klavier zum Vortrag verbunden werden, darf nicht unbekannt sein. Die Kenntnis der Elementarlehre, Harmonielehre, Formenlehre, des Kontrapunktes, der Instrumentationslehre, der Musikgeschichte, wird dabei als selbstverständlich vorausgesetzt.
Ein Genie braucht sich vielleicht um all das nicht zu kümmern. Große einzigartige Geister eignen sich die notwendigen Kenntnisse mit der Zeit von selbst an. Eine Musikschule ist ja aber keine Ausbildungstätte für Genies. Wenn sie das sein sollte, müßte wahrscheinlich nur zu häufig ihre Schließung veranlaßt werden, weil sich das erwartete Genie nicht einstellen will. Im wesentlichen wird hier der gute Mittelstand, wenn man so sagen soll, seine Ausbildung suchen. Das ist doch genau dieselbe Sache auf den anden Schulen auch. Ist etwa das Gymnasium eine Bildungstätte ausschließlich für Genies? Tausende beenden jährlich die Gymnasialstudien, ohne sich in ganz frappanter Weise bei der Prüfung hervorzutun. Hier wiegen gleichfalls die tüchtigen Durchschnittsleistungen vor. Und wie viel Zeit, wie viel Arbeit, wie viel Schwierigkeit kostet es, bis die Gymnasiasten das Ziel erreicht haben, zum Abiturientenexamen zugelassen zu werden. Neun Jahre lang müssen sie danach streben. Bei gar manchen werden durch die Anhänglichkeit an Schule und Lehrer aus den neun Jahren zehn oder elf Jahre. Mit eiserner Strenge wird auf die Absolvierung der einzelnen Partien gehalten. Durch diesen Zwang allein wird ein halbwegs befriedigendes Resultat gezeitigt.
[90] Wie traurig liegen demgegenüber die Verhältnisse bei der musikalischen Ausbildung, gleichgültig ob dieselbe an Musikschulen oder von Privatlehrern geleitet wird. Nirgends existiert ein Zwang, niemals ist von einer Verpflichtung, eine bestimmte Zeit beim Unterricht auszuhalten, die Rede. Daraus resultieren böse Erscheinungen. Einige wenige Beispiele mögen zur Beleuchtung der Mißstände dienen.
Bei einem Musiklehrer meldet sich ein Geiger, der hofft, wenn seine Mittel reichen, zwei Jahre studieren zu können. Im Violinspiel besitzt er eine gewisse Fertigkeit; daran ist nicht so viel auszusetzen. Es liegt dem jungen Manne nun am Herzen, sich einige Kenntnisse in der Theorie, einige Fertigkeit im Klavierspiel zu erwerben. Auf dem Klavier vermag er wohl Klänge zu greifen, einfachste Kompositionen jedoch im mäßigsten Tempo zu spielen, glückt ihm nicht. Nicht wenig Geduld und Arbeit wird nötig sein, bis er primitive Begleitungen korrekt zu spielen imstande sein wird. In der Theorie der Musik ist er vollständiger Ignorant. Mit dem Studium der Harmonielehre möchte er beginnen, muß sich aber vorerst noch die Elementarlehre zu eigen machen. Weiß er doch keine exakte Auskunft zu geben, was Takt, was Rhythmus ist; auf die Frage nach der Begründung der Konsonanz und Dissonanz der Intervalle bleibt er jede Antwort schuldig. Warum ein g-Mollsatz bei Bach nur ein b vorgezeichnet hat, ist ihm durchaus unverständlich. Nach Absolvierung der Elementarlehre will es mit dem Studium der Harmonie nicht so recht vorwärtsgehen. Der Geiger, welcher nur seine Violinstimmen zu sehen gewohnt ist, hat Schwierigkeiten mit der Vorstellung des polyphonen Satzes. Auch hört er nicht exakt, was er schreibt, und hat Mühe, die Klänge auf dem Klavier fließend hintereinander zu spielen. Nun kommt dazu, daß der Bedauernswerte, da er nicht bemittelt ist, seine Abende zum Geldverdienen verwenden muß. Dadurch ist er [91] nicht selten müde und abgespannt und besitzt nicht die geistige Elastizität, um theoretische Erklärungen schnell zu fassen. Nach dreiviertel Jahren qualvoller Arbeit ist er plötzlich aus den Stunden verschwunden. Seine pekuniären Mittel waren gänzlich erschöpft. Er sah sich gezwungen, eine Stellung in einem kleinen Orchester anzunehmen.
Eine Klavierspielerin, die schon Jahre lang Instrumentalstudien betrieben hat und in der Technik des Klavierspieles einigermaßen Bescheid weiß – sie spielt Werke von Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt nicht ohne Geschmack –, entschließt sich, da sie durch Unglück in der Familie plötzlich auf Gelderwerb angewiesen ist, Klavierlehrerin zu werden. Sie fühlt selbst, wie notwendig harmonische Kenntnisse, kontrapunktische Schulung sind, damit sie die Kompositionen, welche beim Unterricht zu erklären sind, sich selber erst einmal klar machen kann. Studien in der Harmonielehre werden zu diesen Zweck begonnen, Vorträge über Formenlehre, Methodik, Akustik usw. besucht. Gewissenhaft und eifrig betreibt das strebsame Mädchen ihre Studien. Nun stürmt aber soviel auf die Lernbegierige ein, daß sie all den Stoff nicht genügend auf einmal verarbeiten kann. In nervöser Hast werden die Sachen verschlungen, ohne daß es zur Freude an dem Genossenen kommt. Auch in diesem Fall hören wir von einem plötzlichen Abbruch der Ausbildung, weil die Schülerin zur Lehrerin avanciert. Sie nimmt, um einen Unterhalt zu haben, eine Stellung als Klavierlehrerin in einem Pensionat an, ohne auch nur im geringsten die notwendigen Studien beendet zu haben.
Und schließlich die Geschichte eines jungen Mannes, der erst nach vielen Schwierigkeiten die Zustimmung seiner Eltern erwirkte, sich der Kunst widmen zu dürfen, obwohl er in jungen Jahren schon bedeutsame Kompositionsbegabung und klavieristisches Geschick zeigte. Vor dem Übertritt zur Kunst war er im wesentlichen Autodidakt. Der Musik konnte er [92] während des Schulbesuches und der Lehrlingszeit in einem Bankhaus nur wenige kostbare Mußestunden widmen. Bei Beginn des ernsten künstlerischen Studiums muß der Jüngling auf allen Gebieten zunächst das Elementare kennen lernen. Soll doch auf einem soliden Grund etwas wirklich Gutes weiter aufgebaut werden. Der junge Kunsteleve zeigt sich auch anfangs allenthalben recht strebsam. In die Stunde trägt er regelmäßig seine simplen Harmoniearbeiten, seine Gedanken jedoch sind stets bei der Arbeit, die ihn zu Hause ganz in Anspruch nimmt: einer tragischen Oper, von welcher er natürlich Erstaunliches erwartet. Nicht lange währen die Freuden der musikalischen Ausbildung. Kühn, in frechem Selbstvertrauen nimmt der »Unerzogene« die Stelle als Kapellmeister an einem kleinen Theater an und kehrt ohne Zaudern seinem Lehrmeister den Rücken.
An Beispielen in großer Zahl könnte so gezeigt werden, wie nach kurzer Zeit dem künstlerischen Studium ein Ende bereitet wird. In solchen Fällen darf aber doch nicht den Lehrern die Schuld beigemessen werden. Selbst wenn dieselben erster Qualität sind, wird an ein Verweilen der Schüler nicht zu denken sein. Zunächst sind scheinbar die Flüchtlinge vielleicht auch gar nicht einmal schlecht an ihrem Platze. Der Geiger füllt mit jugendlichem Eifer seine Stelle recht ordentlich aus, die Klavierlehrerin unterrichtet mit regem Interesse und der neue Kapellmeister dirigiert, voll künstlerischer Pläne, nur so darauf los, als ob er schon lange Generalmusikdirektor wäre. Aber natürlich mit der Zeit wird sich der Mangel an ernster Ausbildung bedenklich bemerkbar machen.
Was läßt sich da sagen? Der Schüler hat für sein Vorgehen die Verantwortung selbst zu tragen. Die Verhältnisse liegen nun einmal so, daß der Musikstudierende die Dauer seiner Studienzeit jetzt allein bestimmt. Er gibt seine Studien auf, wenn er genug davon hat, oder wenn er aus äußerlichen [93] Gründen zur Beendigung gezwungen wird. Musiklehrer kann er ja doch jeden Moment werden, er braucht nur zu wollen. Niemandes Erlaubnis ist dazu einzuholen. Ein Befähigungsnachweis wird nicht abverlangt. Läßt sich etwas Bequemeres und Einfacheres denken? Später wird sich freilich – das ist sicher vorauszusagen – bei all diesen Flüchtlingen die Kürze der Studienzeit bitter rächen. Sie selbst werden am schmerzlichsten den Mangel einer gründlichen musikalischen Erziehung empfinden.
Einstweilen bleibt es eben dabei, daß kein Musiklehrer, keine Musikschule einen Schüler zu halten vermag, sowie derselbe selbstherrlich erklärt: »Meine Studien sind beendet«. Auf die Ausstellung eines Zeugnisses verzichtet er, wenn er voreilig davonspringt, freimütig, weil er sich nicht mit Unrecht sagt, daß Zeugnisse jetzt nicht viel nützen. Solange der Staat nicht das Vorlegen von Zeugnissen verlangt, sind alle Bescheinigungen nur Privatgarantiescheine. Solche werden aber leider von vielen Leuten in so rührender, weitherziger Art ausgestellt, daß niemand dieser Garantie recht traut.
Wie kommt es überhaupt, daß Musikschulen Zöglinge nur für kurze Zeit annehmen? Sollte es nicht einfach zur Bedingung gemacht werden, daß Neueintretende sich für eine bestimmte Zahl von Jahren verpflichten? Erziehungsanstalten mit einem festen und gesicherten Etat können wohl so handeln. Die meisten Musikschulen, mögen sie sich auch einer Protektion von oben aus erfreuen oder einen glänzenden Namen führen dürfen, sind Privatanstalten ohne größeres persönliches Vermögen. Bleiben die zahlenden Schüler aus, so fehlen die Mittel zur Unterhaltung des Betriebes. Mithin sind die Vorstände der Musikanstalten direkt darauf angewiesen, Schüler, wie sie kommen, aufzunehmen. Daß Privatlehrer in den seltensten Fällen detaillierte Bedingungen für die Aufnahme von Schülern stellen können, ist selbstverständlich. Müssen [94] sie doch nur zu oft froh sein, wenn sich überhaupt Schüler bei ihnen melden.
Ein beliebtes Mittel der Lehrer, die Schüler zu fesseln, ist das Aufstellen einer ganz bestimmten Lehrmethode. Bemerkenswertes sollen bisweilen Gesanglehrer darin leisten, die skrupellos behaupten, andere singende Kollegen hätten beim Unterricht eine falsche Methode. Daher das geflügelte Wort: »Jeder Gesanglehrer sagt vom anderen, er habe eine falsche Methode. Die meisten Gesanglehrer möchten wohl in diesem Punkte vollkommen recht haben.« In Wahrheit sollte es nicht so viele Methoden wie Lehrer, sondern so viele Methoden wie Schüler geben. Studierende von durchaus verschiedenartiger Anlage, andersartiger Begabung erheischen eine andersartige Manier der Behandlung. Die Kunst beim Unterricht besteht ja darin, daß der Lehrer den Schüler zu packen weiß, nicht aber wartet, bis der Schüler sich ihm nähert. Naturgemäß legt sich jeder Lehrer ein System, nach welchem er am praktischsten anleiten kann, zurecht. Niemals aber wird er doch in starrem Egoismus an der, als am besten zum Ziele führenden Manier festhalten, sondern die Ausbildung bald so, bald so, wie es eben die Eigenart des Schülers als wünschenswert erscheinen läßt, betreiben. Wahrscheinlich sogar wird sich seine sogenannte Methode, je nachdem er sich selbst weiter entwickelt, immer umgestalten. Ein gewissenhafter Lehrer hat ohne Anhalten alle Neuerscheinungen auf dem Gebiete des Unterrichts zu studieren. Gar mancherlei wird sich da als verwendenswert erweisen. Wie der Mensch im Laufe des Lebens bei innerer Klärung und Vervollkommnung seine Ansichten korrigiert, so wird auch der Künstler mit der Zeit an Einsicht zunehmen und an seiner Lehrweise schadhafte Teile durch neue ersetzen, veraltete in kluger Einsicht umwandeln. Die Schüler sind ja keineswegs über die Art der Methode, nach welcher sie gerade lernen und von welcher sie ununterbrochen sprechen, voll[95]kommen unterrichtet. Größeren Eindruck als das Lehrsystem des Erziehers macht doch die Persönlichkeit desselben. Es ist gar nichts Ungewöhnliches, daß hervorragende Musiker, die nur nebenbei etwas Unterricht geben und keine spezielle Methode zugrunde legen, durch die Macht ihrer Persönlichkeit auf die Schüler bedeutsam einwirken. Das Schlimmste ist es wohl wenn bei der ohnehin kurzen Zeit der Ausbildung die Schüler nach verschiedenen Methoden nacheinander lernen sollen. Lehrer, welche auf ihre Methode pochen, verlangen auch, daß die Schüler in ihr von Grund aus zu lernen anfangen. Neueintretende müssen mithin, selbst wenn sie in einer anderen Methode schon ausgebildet waren, in der neu erwählten noch einmal von vorn anfangen. Was hat das für Sinn, vorgeschrittene Schüler auf eine Elementarstufe zurückzudrängen? Tut man das nur, um zu zeigen, wie herrlich weit die neue Methode führen kann? Solch eine fixe Idee des Lehrers ist durchaus verwerflich. Nur wer nachweislich im Elementaren nicht Bescheid weiß, muß zum Nachlernen verpflichtet werden. Zu Extravaganzen ist bei der so kurz bemessenen künstlerischen Ausbildungszeit keine Gelegenheit.
Mag man die Sache ansehen, wie man will, mögen an Musikschulen oder beim Privatunterricht Lehrversehen vorkommen, mögen rückständige Lehrkräfte einer vernünftigen Lehrgestaltung hinderlich sein, mögen übertriebene Methoden einen Hemmschuh bilden, der bedeutsamste Grund für ein so häufiges Mißlingen der musikalischen Ausbildung ist unbedingt die ungenügende Dauer der Studienzeit. Für die praktischen Fächer läßt sich ja wohl eine genaue Dauer der Ausbildung überhaupt nicht bestimmen. Da wird so lange zu lehren und zu lernen sein, bis das wünschenswerte Ziel erreicht ist. Gründliche Naturen, welche einen exquisiten Elementarunterricht genossen haben, werden bei hervorragender musikalischer Veranlagung am sichersten und schnellsten vorwärts kommen. Für alle [96] Fächer, in welchen regulär an den Schulen klassenweise unterrichtet wird, ist ein Zeitraum zur Bewältigung zu fixieren. Musikschulen ohne Elementarklassen lassen den Schüler zunächst die Harmonielehre erlernen, dann Kontrapunkt und Fuge studieren. Für jeden Kursus wird zur Absolvierung ein Jahr verlangt. Nicht selten erweist es sich freilich selbst bei technisch schon vorgerückten Schülern als notwendig, die Elementarlehre zu wiederholen und zu befestigen. Dadurch beansprucht die theoretische Ausbildung noch mehr als drei Jahre. In dieser knappen Zeit vermag man nur das Notdürftigste der genannten theoretischen Disziplinen zu erläutern. Modulation, Kontrapunkt vertrügen fast stets eine ausführlichere Bearbeitung. Neben den drei oben erwähnten Hauptgebieten soll noch Musikgeschichte, Formenlehre, Ästhetik, Akustik, Musikdiktat unbedingt gründlich Berücksichtigung finden.
Von Melodiebildungslehre, Studium des freien Satzes und Übung in der freien Komposition ist bei alledem noch gar nicht die Rede gewesen. Wie viele Mühe allein bereitet die Erlernung des freien Satzes. Durch Übung im strengen Satz kommt man keineswegs auch zum Verständnis der Eigenheiten des freien Satzes. Da ist noch ein Spezialstudium dringend wünschenswert. Daß die Bildung der Melodie im Einzelnen lange geübt werden muß, wird leider meist viel zu wenig beachtet. Fast alle Musiker sind darauf angewiesen, Unterricht zu erteilen. Kenntnisse in der Pädagogik sind daher für sie durchaus erforderlich. Diese komplizierten Gebiete in kurzer Zeit beherrschen zu lernen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und selbst angenommen, es wird drei Jahre lang studiert, so ist doch für diese Zeit der Stoff zur Bewältigung viel zu groß. Zahlreiche Schüler wenden ja aber die hier als Mindestmaß erklärte Zeit gar nicht auf. Einzelne Spezialgebiete ignorieren die Studierenden meistens auch vollständig; besteht doch kein direkter Zwang zu deren Kultivierung. Wie soll es auf [97] diese Weise möglich sein, zu einem wirklichen Können in der Kunst zu gelangen ? Daß nur zu viele Musiker aus Interesselosigkeit, aus Stumpfheit selbstzufrieden auf dem Niveau, welches sie bei der Ausbildung erreicht haben, stehen bleiben, wurde schon erwähnt. Zögen sich die Leute dann in die Einsamkeit zurück und verweilten still im Verborgenen, so wäre ihr geringes Wissen und Können bedauerlich. Schaden könnte daraus nicht erwachsen. Ungebildete Musiker geben aber ebenso wie gebildete Unterricht und haben außerdem nicht selten noch die Ambition, Sachen zu publizieren. Kompositionsversuche, Bearbeitungen aller Art legen dann schmerzendes Zeugnis für die Unfähigkeit dieser Musikanten ab.
Ach, wüßten die Musikstudierenden immer, wie unwissend sie sind! Hielten sie doch für das Erforderliche, sich wirklich zum Musiker zu erziehen und nicht nur zum Musikanten auszubilden. Eine glänzende Spezialbegabung täuscht ja nur zu häufig über die allgemeine musikalische Bildung hinweg. Virtuosen können uns durch eine außerordentliche Fingerfertigkeit auf ihrem Instrument verblüffen. Sollen diese Scheingroßen über Phrasierungsprobleme, metrisch komplizierte Umbildungen, kompositionstechnische Fragen Auskunft geben, so versagen sie nicht selten vollkommen. Routinierte Podiumshelden sind eventuell unfähig, einen reinen Quartettsatz zu liefern. Kenntnisse in der Akustik oder Musikgeschichte sind selbst bei namhaften Sängern bisweilen verzweifelt dürftig. Oft genug kommt es vor, daß ein Klavierlehrer niemals Kullaks »Ästhetik des Klavierspiels« in der Hand gehabt hat, daß ein Theorielehrer nichts von Riemanns »Geschichte der Musiktheorie« weiß. Das Hauptstreben in der musikalischen Ausbildung muß dahin gehen, vielseitige Kenntnisse zu erwerben. In kurzer Zeit ist es unmöglich, sich in den zahlreichen Einzelabteilungen heimisch zu fühlen. Von langer Dauer hat daher die Studienzeit zu sein. Eine Prüfung [98] allein vermag den Zwang zur Vornahme der Studien abzugeben.
Wenn der Staat den Musikern nicht zur Hilfe kommt, so verbleibt den Musikern nichts anderes, als sich selbst zu helfen. Möchten sie sich doch zusammentun und einen künstlerischen Staat gründen, in dem die Bürger freie Bürger sind, deren Arbeit nicht durch lästige Spekulationsgeschäfte geschädigt werden darf. Das freie Bürgerrecht erhält nur der, welcher den Nachweis wahrer Künstlerschaft erbracht hat, die sich auf umfangreiches, allgemeines musikalisches Wissen und Können gründet.
Mag es auch schwere Kämpfe kosten, den Unterricht zeitgemäß zu gestalten, wir dürfen doch den Mut nicht verlieren und die Hoffnung auf den Sieg der guten Sache nicht aufgeben. Immer von neuem sind Versuche zu unternehmen, die Zeit der Ausbildung zu einer wirklichen Vorbereitung für das anständige Musikertum zu gestalten.
Wenn die Musikschüler über alle Ansprüche, welche an sie zu stellen sind, anfangs auch etwas ächzen werden, später danken sie doch von Grund ihres Herzens für das Wissen auf künstlerischem Gebiete, welches ihren Blick geweitet hat und den Musikerberuf erst genußreich macht.
Stephan Krehl, „Musikerelend“, Teil V

Stephan Krehl (1864–1924)
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephanKrehl.jpg
Im Jahre 1912 erschien das Buch »Musikerelend« des Komponisten und Musiktheoretikers Stephan Krehl (1864–1924). Krehl, seit 1902 am Leipziger Konservatorium tätig und von 1907 bis zu seinem Tod Leiter der Institution, stellte dort laut Untertitel »Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf« an. Sie sind polemisch formuliert und geben unmittelbare, heute teils kurios anmutende Einblicke in seine Sicht des Musiklebens, insbesondere mit Blick auf die soziale Stellung der Musiker_innen, in einer Zeit des Umbruchs.
Stephan Krehl (1864–1924):
Musikerelend
Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf
[Teil V]
Leipzig: C. F. W. Siegel [1912].
[63] 4. Die Musik auf Irrwegen.
»Mit der Kunst geht es bergab! Die große Zeit höchster Blüte ist längst vorüber. Wir befinden uns in der Zeit eines vollständigen Verfalles und steuern einem schlimmen Ende entgegen«.
Solche Klagen hat man in Perioden großer Umwälzungen immer vernommen. Namentlich sind sie stets ein übliches und billiges Vergnügen für Alle gewesen, welche die Entwicklung der Kunst nicht verfolgen konnten. Neuerscheinungen, nicht nur auf künstlerischem Gebiete, stoßen ja im Anfang unbedingt auf Widerspruch. Bieten sie doch soviel zum Nachdenken, zum Beobachten, daß im ersten Moment das Schwerverständliche als Sinnlosigkeit bezeichnet wird. Zudem sind viele Menschen, namentlich in den späteren Lebensjahren zu schwerfällig, um Abschwenkungen vom bisherigen Gang sofort mitzumachen. »Da kann ich nicht mit; das geht über meinen Horizont«, klagt der gealterte Pedant. Währenddem hat der Jüngling ein strittiges Novum längst kritiklos in leidenschaftlichem Taumel begrüßt und verherrlicht. Immer und immer wiederholt sich diese Erscheinung schließlich ohne sonderliches Aufsehen zu erregen. Wahrscheinlich wäre es auch viel sonderbarer, wenn zu Zeiten größerer Wendepunkte der Kampf der Meinungen nicht hin und her toben würde. Die Ruhe, ja vielleicht Öde einer gleichmäßigen kühlen Gesinnung würde befremdlicher als der laute Widerstreit der Meinungen wirken. Lernt doch zudem ein jeder viel mehr aus der wilden Entgegnung des Feindes, als aus der milden Zustimmung des Freundes. Schaden kann es aber nichts, wenn sich die Gegensätze etwas ausgleichen, nicht aus Rücksicht auf die feindlichen Parteien, deren Wohl oder Wehe der Geschichte [64] gleichgültig ist, nein, aus Rücksicht auf die Entwicklung der Kunst selbst. Der zu heftige Widerspruch der älteren konservativen Elemente drängt die fortschrittliche Jugend auf eine falsche Bahn. Die Kunst befreit sich schließlich selbst von allem Unrat, der sich ihr angehängt hat. Aber zeitweise wird ihr Glanz verdunkelt, ihre heilsame Wirkung geschwächt.
Die Älteren tun wirklich besser daran, wenn sie in dem Tanz um den Altar der künstlerischen Erkenntnis den Jüngeren die Hand reichen und sie in ihrem bacchantischen Taumel zu mäßigen suchen, dafür sich selbst aber etwas vorwärts reißen lassen. Schließlich erkennt man auch im tollen Wirbeltanz, daß auf diesem Altar niemals ein Bild von Sais, dessen Eigenart nicht enthüllt werden darf, sondern höchstens ein Heiligenbild, dessen Zeichen schwer zu deuten sind, steht.
Durch Teilnahme an dem Erkenntnisreigen wird ein Jeder unwillkürlich zur Gewöhnung an das Neue gezwungen. Über eine künstlerische Neuerscheinung muß man nicht allein nachdenken, auch gewöhnen muß man sich an sie. So erst können ihre eigenartigen Zeichnungen, ihre sonderbaren Linien der nachfühlenden Seele zum neuen Erlebnis werden.
Wer will bestreiten, daß in der Kunst jetzt alles vorwärts drängt, daß man neue Werte sucht, daß neue Wege, welche zu anderen Zielen führen sollen, eingeschlagen werden? Kann die Kunst von den Wandlungen, welche wir allüberall im Leben beobachten, unberührt bleiben? Ist es denkbar, daß sich die Musik, der herzinnigste Ausdruck menschlicher Empfindungen von den Wechseln des Menschenlebens loslöst? Kein Zweifel, wir leben in einer revolutionären Zeit. Auf religiösem Gebiet, in der Wissenschaft, in der Technik, wo man hinsieht, neue Ansichten, neue Forschungen, neue Probleme. Die Kunst spiegelt nur zu getreu diese Vorgänge wieder. Auch in ihr gärt und kocht es. Neue Gebilde entstehen, von Sensationslustigen jubelnd begrüßt, von konservativen Grämlingen schroff [65] abgelehnt. Sind mit der Zeit die Gegensätze ausgeglichen, dann zeigt sich erst bei ruhiger Überlegung, was wirklich Anrecht auf langes Leben hat. Üble Novitäten, mögen sie mit noch so viel Lärm eingeführt worden sein, vergehen in aller Stille. Der wilde Meinungskampf tobt aus und alles Für oder Wider erweist sich nun als bedeutungslos.
Wir wollen aus vollstem Herzen und mit Dankbarkeit jede Neuschöpfung begrüßen, mit welcher wir wirklich einen Schritt vorwärts tun. Auf das Energischste müssen aber die scheinbaren Kunstäußerungeu zurückgewiesen werden, welche nichts mit der Heiligkeit der Muse zu tun haben, alle unsauberen Produktionen, unflätig im Geist, unrein in der Technik, kurzum jene Bestrebungen, welche nur scheinbar fortschrittlich sind, in Wahrheit aber lediglich das wunderbare Gebäude unserer Kunst zu besudeln und zu unterminieren drohen.
Mit möglichster Schnelligkeit Neuerscheinungen richtig einschätzen zu lernen, das wird von der größten Tragweite sein. Wie empfindet man das doch beim musikalischen Unterricht. Stellen sich rückschrittlich gesinnte Lehrer durch unmotivierte Absprechungen neuer Schöpfungen zur fortschrittlichen Jugend in schroffen Gegensatz, so entfremden sie sich nicht nur die Schüler, sie machen auch den Wert des Unterrichts, der sich doch auf gegenseitiges Vertrauen stützen soll, illusorisch.
Ist es denn schließlich für den gebildeten Musiker so schwer, Vorzüge und Fehler einer Neuerscheinung festzustellen? Gewiß, nach dem ersten Anhören kann man keine definitive Kritik üben. Es bedarf einer Zeit, um das Musikstück kennen und würdigen zu lernen. Ist dieselbe aber geopfert worden, so muß es doch möglich sein, klar die Situation zu überschauen. Kümmern wir uns nicht um die Behauptung, daß in neuen Werken die Autoren die bisher gezogenen Grenzen überschreiten und eine vom üblichen abweichende Begutachtung für sich fordern. Das sind nur Ausflüchte, um jeder Bekrittelung [66] zu begegnen. Solange die Werke das übliche Material benutzen und mit den bewährten Mitteln arbeiten, kann und muß man auch die seit lange begründeten Gesetze der Logik, der Schönheit anwenden können. Schwierig allein eigentlich ist es, Form und Inhalt im Verhältnis zu einander, in ihrer gegenseitigen Bedeutung strikte zu würdigen. Denn mitunter gebärden sich die Komponisten in ihren Schöpfungen so sonderbar, daß der Hörer im ersten Moment vollständig frappiert wird und, sei es ob abgestoßen oder angezogen, eine große Originalität zu bemerken glaubt. Phantastische Naturen lassen sich willenlos in Banden schlagen und zur Bewunderung hinreißen. Eine Zahl sonderbarer Schwärmer nimmt stets nur zu gern alle Neuigkeiten gläubig hin und macht die Unparteiischen durch ödes Geschrei irre. Rechenschaft über die Konstruktion der Werke wird nicht abgelegt. Es entsteht nur Staunen über die scheinbar unglaubliche neue Ausschmückung des Aufbaues. An Kraft zur Beurteilung, ob die Neuheit nur in äußerer Allüre oder in innerer Umgestaltung besteht, gebricht es den Schwärmern in den meisten Fällen vollständig.
Sie beachten gar nicht, daß es der Kunst wie der Menschheit selbst geht. Der Mensch verändert sich nicht in einem neuen Gewände. Das Menschlich-Allzumenschliche bleibt ihm anhaften, solange er aus dem Mutterleibe geboren wird und die Erbsünde in ihm steckt. Die Musik, ein Spiegel der menschlichen Leidenschaften und Gefühle, hängt zu innig mit dem Menschengeschlecht zusammen, als daß sie sich in ihrem Grundprinzipien wandeln könnte. Mögen in den verschiedenen Nationen noch so mannigfaltige Erscheinungen der Gefühlswelt vorhanden sein, immer kehren bestimmte Momente wieder, nach denen eine Schematisierung erfolgen kann. In der Musik herrscht einmal Vorliebe für Mehrstimmigkeit, einmal für Einstimmigkeit, bald wird der Durdreiklang, bald der Molldreiklang bevorzugt. Stets kommen wir auf die Grundlage: Dur- oder Mollsystem zurück. [67] »Auch die absolut einstimmige Melodie hört zweifellos der Hörer von heute, wahrscheinlich aber der Hörer aller Zeiten im Sinne von Harmonien (Tonkomplexen). Die beiden einzigen Arten aber, in deren Sinn man einzelne Töne so gut wie zwei-, drei- und mehrtönige Akkorde hören kann, sind der Durakkord und der Mollakkord«. (Hugo Riemann.)
Im Laufe der Zeit haben sich nun allerdings in den Dur- und Mollsystemen die dissonierenden Zusammenstellungen beträchtlich geändert. Die Beurteilung dissonierender Töne ist mit der Zunahme allgemeiner freier Lebensanschauungen entschieden eine andere geworden. Melodische Linienführungen, rhythmische Anordnungen gestalten sich ungezwungener. Die Temperierung der Instrumente, die Verfeinerung der Technik ist nicht ohne Einfluß auf die musikalische Sprechweise gewesen. All die Wandlungen sind gewiß nicht gering. Schließlich entsprechen sie aber doch nur den Einkleidungen. Die Grundeigenart, das Elementare ist unverändert bestehen geblieben.
Spüren wir zunächst dem leitenden Gedanken, welcher ein ganzes Musikstück durchzieht, nach. Von einer Symphonie, ja von einer Oper läßt sich ein Auszug herstellen. Die wesentliche melodische Linie, die nun aus dem Auszug, den sie wie ein roter Faden durchzieht, herausgenommen werden kann, ist das Eigentümliche, das Charakteristische, dasjenige, was vornehmlich in der Erinnerung haften bleibt. Beethoven hat in seinen Skizzenbüchern einen Sonatensatz, einen Symphoniesatz meist in einstimmigem Verlauf angedeutet. Diese gedrängte Inhaltsangabe ist für jedes Musikstück hoch bedeutsam. Der Gesamteindruck davon muß treffend und schön sein, mögen Einzelheiten auch gar nicht übermäßig originell klingen. In so vielen neuen Werken ist nun diese melodische Hauptlinie betrübend armselig, erschreckend öde, häufig sogar bedauernswert ungeschickt. Durch absonderliches Verfahren in Einzel[68]heiten suchen die Komponisten dann die Schwächen in der Grundgestaltung zu verdecken. Da werden Stimmführungen gebracht, welche den Hörer einen Augenblick in Staunen setzen. Solche Verplüffung [sic] in Einzelheiten ist aber nichts anderes als Unkenntnis, Ungeschick in der großen Arbeit. Wie unendlich viele neuere Klavierstücke sind voll von Torheiten aller Art. Von wahnwitzigen Verteidigern des Modernismus wird das als Stimmungseigenart gepriesen. Ja, muß man denn roh werden, wenn man in Stimmung kommt? Das sind doch nicht die angenehmsten Zeitgenossen, die sich in Stimmung von ihrer schlechten Seite zeigen! Mag sein, daß in der Klaviermusik der Satz gerade extra lässig behandelt wird, während der Orchestersatz für größere Sorgfalt zu sprechen scheint. Im Orchestersatz täuscht aber doch die verschiedenartige Klangfarbe über vielerlei hinweg.
Kompositionslehrer können da aus ihrer Praxis von sonderbaren Sachen berichten. Häufig genug sagen jetzt Schüler, daß sie nicht geneigt seien, einfache Klaviersachen zu schreiben. Der Satz für großes Orchester, das sei ihr Fall, da würden sie sich wohl fühlen und wirklich komponieren können. Faktisch schreiben dann auch Leute, die nicht imstande sind, einen vierstimmigen Satz garantiert fehlerfrei herzustellen, nicht übelklingende Orchesterwerke. Betrachtet man freilich die Partituren in ihren Einzelheiten, so finden sich genug Fehler in der Stimmführung. Im Grunde sind es dann dieselben Versehen, welche auch dem Klaviersatz anhaften. Im Strudel des modernen Orchesterklanges gehen alle Mängel unter, ebenso wie falsche Stimmen im großen Chor nicht gehört werden. Mangelhafte kontrapunktische Durchbildung trägt hier die Hauptschuld.
Gute Musikstücke sollen sich durch Selbständigkeit in der Stimmführung auszeichnen. Die plumpe Art der Fortschreitungen, wie sie in früherer Zeit mitunter bei harmonischen Stücken zu beobachten war, galt neuerdings als Zeichen einer Unkultur.
[69] Selbst in dem einfachsten Tanzstück bestrebte sich der Komponist, eigenartige Bewegungen durchzuführen. Die wundersamen lyrischen Stücke, welche wir den Meistern der romantischen Schule verdanken, sind wohl in erster Linie in melodischer und harmonischer Hinsicht bedeutsam. Bewundernswert an ihnen bleibt aber gleicherweise die Exaktheit in der Stimmenführung. Daß die Segnungen der kontrapunktischen Schreibweise allen Zweigen der Tonkunst zugute kommen, muß doch wahrhaftig als ein wesentlicher Fortschritt der Musik des 18. und 19. Jahrhunderts bezeichnet werden. Die feine Zeichnung in einem Kunstwerk ist nicht nur ein Beweis für das Können des Schöpfers, sondern auch ein Schönheitszeichen, auf dessen Vorhandensein der verständige Hörer keinesfalls verzichtet. Beim Studium des Kontrapunktes wird deshalb in der neuesten Zeit scharf betont, daß es sich nicht etwa um die Pflege irgendeiner Spezialität, sondern einer jeden vernünftigen Musik handelt. Alle Vorschriften der freien Komposition für Melodiebildung, Harmonisierung, rhythmische Gestaltung, sind ohne wesentliche Einschränkung auch für den Kontrapunkt maßgebend. Hier wie dort dreht sich ja alles doch nur um musikalischen Aufbau.
Absonderliche Tonsetzer beginnen in allerneuster Zeit mit einem Male von dem schönen Brauch, sich des Kontrapunktes allenthalben zu bedienen, abzuweichen. Und zwar versehen sie nicht nur illustrierende Stücke, sondern auch Stimmungspoesien mit unglaublichen Roheiten des Satzes. Für gewisse beabsichtigte naive Schilderungen möchte ja der Verzicht auf Selbständigkeit in der Stimmenführung noch hingenommen werden. In einem Opus, welches »Tanz der Zentauren« oder »Lappländischer Hochzeitsreigen« überschrieben ist, läßt man in kindlichem Vergnügen zugunsten der urwüchsigen Zentauren und Lappländer gar mancherlei passieren. Das erscheint dann wohl äußerlich programmatisch erklärlich, ist jedoch innerlich musikalisch ästhetisch schwer zu rechtfertigen. Jedenfalls aber [70] gehören in ein Präludium, in eine Sarabande oder sonst in ein elegantes Tanzstück Unfeinheiten des Satzes niemals hinein. Wie kann ein Tonsetzer sich so aller musikalischen Kultur begeben? Macht er das aus krasser Unkenntnis oder aus widerwärtiger Reklamesucht? Will er zeigen, daß die Musik vorwärts gebracht wird, indem man ihr die Schönheit nimmt? Dem Kenner und Verehrer kontrapunktischen Stils wird es nach scharfem Eindringen in den Geist einer Komposition nicht schwer fallen zu erkennen, wie weit die Vernachlässigung der Stimmführung mit Unebenheiten der melodischen Linie Hand in Hand geht. Die Irrwege, auf denen hier die Neuerer vorwärts kommen wollen und doch nur zurückschreiten, sind nicht schwer zu verfolgen.
Ein großer Irrtum ist es entschieden auch, wenn neuerdings so häufig auf natürliche Melodie vollständig Verzicht geleistet wird. Mag der Dilettant noch so oft in süßem Verzücken flöten: »Ach, die Melodie!« Der modernste Komponist flucht eben doch: »Pfui, die Melodie!« Unsere musikalische Erziehung hat das Ihrige dazu beigetragen, den Sinn für Melodie nicht zu wecken. Lange Zeit wurde Harmonie und Kontrapunkt überhaupt losgelöst von allem Melodischen betrieben. Von einer gesonderen [sic] Melodielehre war nicht die Rede. Der Musikschüler erfuhr eine Menge Sachen von Akkordverbindungen aller Art, von Bewegungen der Stimmen mit und gegeneinander, von der Schönheit motivischer Entwicklung dagegen nichts. Ist es da ein Wunder, wenn er entweder dachte, die Melodie sei ein Gnadengeschenk, welches die Natur wenigen Auserwählten mit auf den Lebensweg gegeben hat, oder wenn er die Beschäftigung mit der Konstruktion der Melodien für etwas Überflüssiges hielt. Auch hat hier das unverzeihliche Cliquenwesen der letzten Jahrzehnte viel Schaden gestiftet. Der Neuling heult in der Clique mit, weil es einmal so Sitte ist und weil er dafür belohnt und protegiert wird. Immer von neuem hören [71] und sehen wir es ja, wie in einer großen Koterie die Verachtung der Hauptvertreter der romantischen Schule großgezogen wird. Die Jugend hält man von der Beschäftigung mit den Werken unserer großen Romantiker ab, von vornherein verekelt man ihnen die Schöpfungen. »Die Lieder ohne Worte von Mendelssohn, an denen Geschlechter sich den Geschmack verdarben, singen und sagen uns nicht mehr viel«. Wie ist aber gerade in diesen Stücken das Melodische, Harmonische und Kontrapunktische abgerundet! Mendelssohn’sche Eigentümlichkeiten nachgeahmt wirken gewiß nicht immer gut. Da darf man aber nicht dem Urheber, sondern muß dem Nachahmer einen Vorwurf machen. In Isoldens Liebestod sind wohl die Vorhaltstöne, die Doppelschläge bei Steigerung über den langen Quartsextakkorden von treffender Wirkung. Nachgeahmt wirken diese Sachen noch viel schlimmer als die Nonenklänge von Mendelssohn.
Wohin der Verzicht auf die Melodie in so vielen ernst gedachten Werken der neueren Zeit führt, sehen wir nur zu genau in der Geschmacksrichtung des Publikums. Die Leute hören geduldig die tiefsinnigen, eventuell auch stumpfsinnigen, großen modernen Orchesterwerke an. Die Kompositionen sind mode [sic]; da darf man seinen Unwillen nicht laut werden lassen, sonst stellt man sich bloß. Im Geheimen aber freut sich der scheinbar so tief berührte Konzertbesucher schon auf die nächste Operette, in der es wieder einmal natürlich und ungezwungen musikalisch, melodisch hergeht. Der geradezu fabelhafte Erfolg der Operette in jüngster Zeit wäre wohl nicht denkbar, wenn Spielopern, komische Opern, Singspiele guter Konstruktion in größerer Zahl entständen. Spielopern wollen die Komponisten aber nicht schreiben, denn da läßt sich nichts Sensationelles, Schlüpfriges oder Perverses anbringen. Und ohne solche Sachen darf es doch in einem »anständigen« Theaterstück nicht abgehen. Einer geht dem andern mit dem guten Beispiel voran.
[72] Was für seltsame Vorbilder, bizarre Idole hat die Jugend jetzt! Womit begeistert, oder besser gesagt, woran entgeistert sie sich? Das Verständnis für das Leben der Kunst und die Kunst des Lebens fehlt ebenso wie die Freude am Leben. Kurzerhand bereiten oft unreife Menschen diesem Jammerdasein eigenmächtig ein Ende. Mit Sicherheit läßt sich erwarten, daß bei einem jugendlichen Selbstmörder ein Band Nietzsche gefunden wird. Er ist mit dem Bekenntnis gestorben: »Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will«. Würden diese Lebensverächter es doch lieber für das beste erachten: »im Kampfe zu sterben und eine große Seele zu verschwenden«. Ach, eine große Seele ist bei diesen Menschen nicht zu finden; hier hat sich nur eine kleine kranke Seele müde hingeschleppt.
Junge Komponisten tragen nun nicht nur unverstandenen Nietzsche, sondern auch noch unverstandenen Hugo Wolf mit sich herum. Die Werke zweier Sonderlinge, die leider so früh in Geisteskrankheit verfielen, betören die Jugend nur zu rasch. Falsch verstanden richten dieselben eine heillose Verwirrung an. Von Wolf werden natürlich die krankhaften Werke, die rein musikalisch absolut nicht als seine besten Schöpfungen zu gelten haben, als Grund, auf welchem man weiter aufbaut, genommen. Für die Liedkompositionen hegen ja alle jungen Komponisten eine aufrichtige Begeisterung. Publikum und Verleger haben nicht viel Interesse an den einstimmigen Liedern. Von der großen Zahl veröffentlichter Nummern sind nur ganz wenige wirklich gangbar. Gedichte zu vertonen ist aber ein herrliches Vergnügen. Da läßt man seiner Phantasie so ungehindert die Zügel schießen. In musikalischen Gefühlen wühlen, welch ein herrliches Pläsier! Ehemals wurden in der musikalischen Formenlehre verschiedene Liedformen unterschieden. Für die neuere Zeit ist diese Bestimmung durchaus hinfällig geworden. Lieder modernster Tendenz haben keine musikalische Form mehr. Die harmonisch-melodische Ge[73]staltung wird lediglich durch den Text bestimmt. Ehedem galt es für wünschenswert, auch bei Verbindung von Wort und Ton die musikalische Linie verständig zu führen. Neuerdings wird auf solches Prinzip verzichtet. Die Musik übermalt nur noch den Text. Den Intentionen des Dichters folgt sie häufig zeilen-, ja wortweise und kümmert sich nicht um logische musikalische Entwicklung oder um symbolische Ausdeutung des textlichen Inhaltes. Verblüffende Harmonien fügen sich blindlings aneinander, das ist alles.
Hätte die moderne Poesie nun wenigstens eine geschlossene Form, dann würde die Musik sich ja auch natürlich anordnen. Wir finden gewiß in neuester Zeit eine Zahl poetischer Eingebungen in abgerundeter Form, trefflich geeignet zur musikalischen Ausführung. Die eigentlich Modernen aber, welche nicht mehr »im Kotau vor Goethe liegen«, bringen neue, ungewöhnliche Formen. In dem Bestreben, originell zu sein, kommen sie zu den sonderbarsten Resultaten. Texte entstehen, die mindestens zum Vertonen ungeeignet sind. So wird »die Dämmerung« neuerdings in folgenden Worten geschildert [Alfred Lichtenstein, Die Dämmerung, 1913]:
Ein dicker Junge spielt mit einem Teich,
Der Wind hat sich in einem Baum gefangen,
Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich,
Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.Auf langen Krücken schief herabgebückt
Und schwatzend kriechen auf dem Feld zwei Lahme,
Ein blonder Dichter wird vielleicht verrückt,
Ein Pferdchen stolpert über eine Dame.An einem Fenster klebt ein fetter Mann,
Ein Jüngling will ein weiches Weib besuchen,
Ein grauer Klown zieht sich die Stiefeln an,
Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen.
Jede Zeile bringt eine neue Situation, eine neue Stimmung. Mag auch die Überschrift »Dämmerung« eine Gesamtstimmung vortäuschen; an einen inneren Zusammenhang ist nicht zu [74] denken. Wenn sich die Musik nun bei einer Vertonung eng an die Dichtung anschließt, dieselbe, möchte man sagen, Wort für Wort illustriert, so wird sie versuchen, erst mit einem Teich zu spielen, dann sich in einem Baum zu fangen, über das Feld zu hinken, über eine Dame zu stolpern und, nachdem sie graue Stiefel angezogen hat, mit dem Hunde zu fluchen. Was muß das für eine Musik geben! Unbeschreibliche Idee!
Über die Formlosigkeit, in der sie sich hier äußern können, sind die jungen Komponisten aber überaus beseligt. Das ist ihr Element. Ob die Sache künstlerisch ästhetisch gerechtfertigt werden kann, darauf kommt es ja gar nicht an. Bleibt doch die Hauptsache bei allem: verrückt, originell. Das mag nun aber alles noch gehen, wenn die Sinnlosigkeit der Musik durch den Text begründet wird. Böse sieht die Sache erst bei Übertragung dieses Kompositionsprinzips auf textlose Musik aus. Dann gibt der Komponist bald Gefühle wieder, bald illustriert er einen Vorgang. Jetzt schildert er naturgetreu, um sofort darauf symbolisch zu vertonen. Ein Durcheinander entsteht, ein Vermischen verschiedenartigster Elemente, das den Zuhörer durchaus unzufrieden und verwirrt macht.
Die größte Verwirrung hat freilich beim Komponisten geherrscht. Mutet er doch der Musik Sachen zu, die sie einfach nicht imstande ist, zu leisten. Aber da mangelt es eben zu häufig an der Einsicht, daß für eine Menge von Erscheinungen tonliche Symbole nicht gefunden werden können. Wenn auch ein Titel, eine ganze textliche Vorrede auf den Inhalt der Musik hindeutet, das Verständnis wird doch nicht gefördert, solange der innere musikalische Zusammenhang fehlt. Der Musik werden jetzt aber nicht nur sonderbare Sachen zur Darstellung zugemutet, auch die Mittel zur Wiedergabe werden häufig total verkannt.
Bewegung ist Ausdruck. Harmonische, melodische, rhythmische, dynamische Wechsel stehen als die wesentlichsten Mittel zur musikalischen Darstellung zur Verfügung. Jeder Wechsel, jede [75] Bewegung vermag doch aber nur von einem Ruhepunkt aus gefaßt zu werden. Bewegungen wirken nur im Gegensatz zur Ruhe, Gruppen nur gegen Einzelerscheinungen. Phantasten konstruieren jetzt melodische Linien im Zickzack ohne Anhalten, Rhythmen in vollständigem Wirrwarr, Harmonisierungen in Dissonanzketten ohne Auflösung.
Ein Musikstück, in Folgen von Dissonanzen unter Vermeidung aller Konsonanzen aufgebaut, ist eine ästhetische Unmöglichkeit. Die Literatur weist wohl Werke dieser Art auf. Man möchte solche Musik mit einem Drama vergleichen, in dem eine Unzahl von Persönlichkeiten auftritt. Niemand aber vermag bedeutungsvoll zu wirken, keine großzügige Handlung kann entstehen, weil stets jede unmotiviert neu auftretende Persönlichkeit unmotiviert die bereits auf der Bühne Agierende totschlägt. Niemals eine Einführung, niemals eine Begründung. Hat das noch einen Sinn? Woraus will man zu einem solchen Vorgehen die Berechtigung ableiten? Es ist doch kein alter Zopf, daß in der Musik die Einheit des tonischen Dreiklangs gewahrt wird. Wer will eine Modulation, die doch Ausdruck sein soll, verstehen, wenn kein Ausgangspunkt, kein Ziel zu sehen ist? Hat ein musikalischer Satz, der nicht durch eine Kadenz gegliedert und gefestigt wird, Logik? Durch Gegensätzlichkeiten allein wird der Ausdruck in den Bewegungen verstanden. Der Tag ist nicht wirksam ohne Nacht, das Gute schätzen wir nur mit stillem Grauen vor dem Bösen. Wenn die Musik wirklich Gemütszustände schildert, dann ist eine Komposition voller Dissonanzen das Abbild eines kranken, eines nervös überspannten Gemüts, aus dem alle Ruhe gewichen ist. Wer aber wünscht sich in der Musik Symbole für Gemütsleiden zu finden?
Ein Kapellmeister Moroni soll wohl versucht haben, in einer symphonischen Dichtung »Influenza« alle Stadien dieser Krankheit bis zur völligen Appetitlosigkeit und dem schwersten Fieberanfall zu schildern. Der Himmel bewahre uns aber vor [76] ferneren derartigen Krankheitssymphonien, namentlich wenn sie Magen- und Darmleiden betreffen. Krank ist in solchem Falle wiederum nur der Komponist, der sich einbildet, in Tönen dergleichen schildern zu können.
An diese Auswüchse braucht aber gar nicht gedacht zu werden. Es genügt vollständig, lyrische Stellen, ruhige Themen aus modernen Werken in Betracht zu ziehen. Schon da zeigt sich diese sonderbare Unstetigkeit, die Hast, dieses ungesunde neurasthenische Hin- und Herschwanken in den Tonarten. Man will und vor allem man kann nicht einfache Melodiebildung in der Tonart herstellen. An Stelle davon tritt ein unschönes Durcheinander von Harmonien. Die Angst, einmal etwas Bekanntes zu wiederholen, ist so groß, daß ein jeder vorzieht, manieriert zu werden. Haben denn die großen Meister der Tonkunst immer nur Neues gebracht? Ihnen wird nur – das ist allerdings eine gewisse Ungerechtigkeit – ein Nachempfinden nicht zum Nachteil angerechnet. Schreibt jetzt ein Musiker eine Melodie, erst mit Terzen, dann mit Sexten begleitet, sofort heißt es: Potztausend, wie kann der so unoriginell sein, das ist ja durchaus brahmsisch. Brahms hat gewiß diese Manier gern und häufig benutzt. Sie ist doch aber ebenso bei Schubert, bei Beethoven und anderen schon anzutreffen. Der Beginn einer Melodie mit Sprung von der Terz der Tonika zur Terz der Dominante und Auflösung nach dem tonischen Grundton wird stets als ein Abschreiben des Anfangs vom Preislied aus den »Meistersingern« verurteilt. Wagner hat doch aber diese Stelle nur Beethoven und dieser wieder Ph. E. Bach oder sonst jemand nachempfunden. Das lästige Herausstechen kleiner Eigentümlichkeiten aus Kompositionen führt zu gar nichts. Das ist eine müßige Beschäftigung von Eintagskritikern, denen an neuen Werken nichts anderes auffällt, als was ihnen gerade anklingt. Melodische Motive müssen sich eben wiederholen, solange wir mit unserem geringen Tonmaterial arbeiten. Die [77] Hauptkunst besteht ja darin, aus den Motiven Sätze zu bilden. Mögen alle, welche aus Angst bekannte Blüten darzureichen, einen Melodienstrauß nicht geben wollen und statt dessen das Unkraut der Dissonanzen bringen, bedenken, daß auch unter dem Unkraut sich nicht immer etwas Neues finden läßt. Sicherlich überrascht die moderne Häufung von Dissonanzen im Augenblick und blendet. Als Ausdruck ist sie an lyrischen Stellen nur zu häufig durchaus verfehlt. Ein Schlummerlied, das einem Kind zur Beruhigung beim Einschlummern gesungen werden soll, vollgepfropft mit dissonierenden Klängen, wirkt so aufregend und beunruhigend, daß das bißchen Schlaf, welches eventuell schon vorhanden war, vollständig verscheucht wird. Ein Menuett, mit Folgen bizarrster Harmonien, gestaltet den gravitätischen Tanz zu einem ganz exzentrischen Cancan. Die Verwendung unglaublichster Klangwechsel und Modulationen an den lyrischen Stellen von Sonatensätzen zeigt nur, daß der Komponist sich von der nervösen Unruhe der Zeit nicht freizumachen imstande war, daß er es nicht über sich gewann, in Ruhe vornehmen und edlen Empfindungen Raum zu geben. Wie ein gehetzter und gequälter Sünder erscheint er, verfolgt von einem wilden Durcheinander häßlicher und böser Empfindungen.
Nur für wenige Menschen ist die harmonisch gequälte Musik der neueren Zeit wirklicher Ausdruck. Das sind die Nervösüberreizten, die Überempfindlichen, die leicht Gemütskranken. Viel häufiger ist die musikalische Unnatur Marotte, Pose oder Neuerungssucht. Einfach, weil behauptet wird, es ließe sich nicht mehr so wie früher komponieren, wird in törichter Weise in Akkorden gesündigt. Die Behauptung, daß nicht mehr wie früher komponiert wird, kann man wohl gelten lassen, wenn damit gemeint ist, daß gar viele nicht mehr die sublime Kunst des Komponierens besitzen. Der Nachweis, daß Melodie, Satzbildung, Entwicklung zu geschlossener Form unmodern sind, der müßte doch erst erbracht werden. Dilettantische Kunst[78]beflissene sehen in dem Aufgeben der Form – das ist der springende Punkt – ein bequemes Mittel, die Unfähigkeit in der Handhabung der strengen Form zu verdecken. Nicht nur in der Musik können wir das jetzt beobachten; jede Kunstbetätigung weist Erscheinungen gleicher Art auf. In der Malerei begnügen sich die Künstler damit, Farben nebeneinander zu stellen. Zeichnung, Form, das sind überwundene Dinge. Allerhöchstens deuten schwache Konturen auf etwas Greifbares hin. Die malerische Schöpfungsgeschichte lautet:
»Im Anfang war das Chaos und aus dem Chaos wurden Kleckse. Und der Maler gab den Klecksen einen Sinn.« So entgeht man der schwierigen und mühsamen Zeichnerei. Und gleicherweise ist ja für den modernen Dichter die Formlosigkeit das Ideal. Logik, Metrik, Sprachschönheit usw. das sind alte Dummheiten. Neuerdings faßt man die Sache anders an. Hört doch, wie ein moderner Dichter von seinem wilden Pegasus aus die Frage nach dem erlösenden Glück beantwortet [Friederike Kempner, Der der, das das, die die]:
»Wie, fragt ihr, wie?
»Wer macht dich frei?
»Es ist die die
»Die Poesei!
Die holde Dichtkunst scheint freilich unserem Dichter nicht durchaus die glückliche Freiheit bei seiner Beschäftigung gebracht zu haben, denn in der Nacht wird er von folgenden Gedanken gepeinigt [ebenfalls von Friederike Kempner]:
Einsam wachend lieg’ ich im Bette,
Wo selbst doch Mörder ruh’n,
O, daß ich nur Gutes begangen hätte!
Ob Mörder Gutes tun?
Ob Mörder ein Gewissen haben?
Nur Gott es weiß –
Sind Nachtigallen gleich die Raben?!
Mein Bett ist weiß…
Wie herrlich muß es sein, wenn diese Worte modern charakteristisch in Musik gesetzt werden. In feinster Manier ist das [79] Motiv des Dichters mit dem des Mörders zu verknüpfen. Die Nachtigallen und Raben haben sich vorzusehen, daß sie nicht das weiße Bett beschmutzen. Schwer zwischen alledem fällt es, Gott musikalisch zu bedenken. Doch darüber braucht sich der Musiker keine Sorge zu machen. Die neue Kunst verfährt ja mit dem lieben Gott nicht sehr rücksichtsvoll. So wird er z. B. von einem Dichter als Bettler in Berlin N. geschildert, als armer Schlucker, der sich mit Tränen für einen ihm in den Hut geworfenen Groschen bedankt. Rührende Worte allein findet der Dichter, um zum Schluß den Abgang des also beglückten Gottes zu schildern [Arno Holz, 1916]:
Dann hängt er sich zitternd in seine Krücken,
drückt gegen das rechte Nasloch den Daumen, schneuzt sich
und humpelt durch blühenden Flieder und Goldregen,
verfolgt von den Kindern,
schräg über den Damm hinter den Droschkenstand
in die nächste Destille.
Ach wie viel humpelt jetzt nicht in die Destille und kommt in den Dunstkreis, der ihr gleicht. Die Musik nimmt, wie die anderen Künste, Gewohnheiten höchst sonderbarer Art an. Viele Leute lachen darüber und nennen das mit Naserümpfen »modern«. Es ist aber nicht zum Lachen, zum Weinen ist es. Nur mit tiefer Trauer vermag man solchen Verirrungen in der Kunst zuzusehen. Die Kunst ist, das merken so viele Kurzsichtige gar nicht, wirklich nicht mehr eine vornehme und edle Herrin, sondern eine schmutzige Magd, eine verdrehte und ehrlose Person.
In der Musik ist man auf Irrwege leider gar häufig auch durch Mißverständnisse gekommen. Zu welchen Mißverständnissen haben doch irrige Auslegungen der Werke von Beethoven, der Werke von Liszt geführt.
»Beethoven konnte sich nicht mehr durch Instrumentalmusik aussprechen, er bedurfte, wie die neunte Symphonie zeigt, des Wortes. Nun mußt du doch auch in deinen Werken Solo[80]stimmen und Chöre verwenden; du bist doch viel fortgeschrittener als Beethoven«. So sagt sich in richtiger Selbsterkenntnis manch moderner Komponist.
Ob der Text einen Zusammenhang mit der übrigen Musik hat oder nicht, darauf kommt es ja gar nicht an. Die Hauptsache bei allen ist der Effekt. Etwas muß man der Menschheit natürlich entgegenkommen. In einen Satz wird unbedingt ein christlicher Choral eingeflochten. Der wirkt stets gut und macht bei dem besseren Publikum einen soliden Eindruck Die Jugend und die modernen Übermenschen werden dann mit etwas Nietzsche, etwas unverstandenem »Zarathustra« entschädigt. So wird der unzeitgemäße Beethoven überboten. Unzeitgemäß? Ja, unzeitgemäß, weil er viel zu viel Musik machte.
Und nun auch der Liszt! Er hat denselben Fehler wie Beethoven begangen. Durch die Wahl zu allgemeiner Titel für seine symphonischen Werke wurde er veranlaßt, melodische Musik zu schreiben. Bisweilen gab er wohl dem Zuhörer zum Verständnis nicht nur eine Überschrift sondern ein voll ständiges Gedicht. Viel zu sehr war er aber immer bestrebt, die einzelnen Momente tonsymbolisch auszulegen, er schrieb Melodien. Wer sich noch untersteht, Melodien zu schreiben, der wird boykottiert, erklären Überkluge. Die Musik ist vorgeschritten genug, sie vermag jetzt Sachen zu schildern, wie sie sind, gleichgültig ob sie sich mit Vorgängen aus der Natur oder etwa Handlungen von Persönlichkeiten beschäftigt; nicht nur Gefühlsmomente, nein Denkakte, Schriften ihrem Inhalt nach erläutert sie uns.
Uns ist ein Musiker bekannt, Tonathlet oder Musikschweizer nennen wir ihn scherzweise, der seit 3 Jahren an einer Riesensymphonie: »Die Bibel« arbeitet. Bis jetzt ist er aber nicht über die Vertonung des zweiten Verses, Buch Mose 1, Kapitel 1, hinausgekommen: »Und die Erde war wüste und leer«. Die Schilderung des Chaos in Dissonanzen unglaublichster Zu[81]sammenstellung, mit Instrumenten verwegenster Art fesselt ihn dermaßen, daß er diesen, doch eigentlich vorbereitenden, Teil mehr und mehr ausdehnt. Auch kann er sich nicht entschließen, den 3. Vers: »Es werde Licht« zu komponieren. Für die Lichtschilderung wird ein Dreiklang nicht zu umgehen sein, das fühlt der Bedauernswerte. Den Dreiklang aber haßt er wie den Tod. So wächst einstweilen die Schilderung des Chaos. Herrliche Nummern entstehen da: »Reigen des Urschleims«, »Protoplasmatisches Ständchen«, »Intermezzo Zellensonderung« usw. Wir haben dem Tonpoeten, damit die Arbeit endlich einmal avanciert, geraten, die Bibel nicht in Totalität, sondern nur in einzelnen Teilen zu schildern. Vom Chaos wäre direkt zum Sündenfall, dem Brudermord und der babylonischen Verwirrung überzugehen. Genug damit vom alten Testament! Die Propheten dürften am besten durch die Klagelieder Jeremiä, die Apokryphen durch den Gesang der drei Männer im Feuer zu charakterisieren sein. Als Abschluß wäre dann aus dem neuen Testament die Offenbarung Johannis herauszugreifen. Und das alles nur durch Dissonanzen, ohne störende Dreiklänge! Der Phantast ist nun selig, nach diesem Vorschlag sein Werk zu Ende führen zu können. Er lebt in dem sonderbaren Wahn, die Bibel auf diese Art glänzend musikalisch wiederzugeben. Im Grunde genommen ist die Musik hier weiter nichts als eine abstruse Sammlung scheusäligster Kakophonien. Der Reigen des Urschleims gewährt vielleicht allein vergnügliche Momente. Schließlich erachtet der Hörer diese Nummer als für die Bibel bedeutungsvoll.
Welch leuchtender Blödsinn! Ist etwas Sinnloseres denkbar?
Der Musik werden Sachen zugemutet, die sie niemals zu leisten imstande ist. Bei den mißglückten Versuchen bleiben die Tonsetzer an Nebensächlichkeiten hängen; bedeutungslosen Dingen, die zwar gerade zur musikalischen Wiedergabe geeignet sind, mit der Grundidee des Werkes aber nur neben[82]sächlich zusammenhängen, wird der Vorzug gegeben. Zu welchem Zweck wird überhaupt etwas in Tönen geschildert, was bereits in Worten viel besser und ausführlicher erzählt und erklärt worden ist. Entschieden soll die Poesie überboten werden. Und die Musik ist zu solchem Übertreffen gar nicht fähig. Sie vermag nicht alles zu berichten und zu durchdenken, wie es in einer gewöhnlichen Umgangssprache möglich ist.
Die Jugend glaubt, nicht nur die geschwätzigen Schwachköpfe der Romantik überholt zu haben, sie dünkt sich auch über die Klassiker, über einen Wagner, einen Liszt erhaben, kurz über alle jene Meister, denen wir herrliche Musik, wundersame Melodien verdanken. Die Klassiker haben für alles, was ihnen musikalisch ausdruckswert erschien, tonliche Symbole gestaltet und dadurch eine Musiksprache entstehen lassen, innig und wahr, formvollendet und schön, bei welcher sich Inhalt und Form in kongenialer Art decken.
Die Wut der musikalischen Anarchisten richtet sich nicht nur gegen die Melodie, sondern auch gegen die Form. Die üblichen musikalischen Formen sollen modernen Ansprüchen nicht mehr genügen. Ganz gut! Wenn die Form nicht mehr wie früher in Anwendung kommen kann, so wandelt man sie eben um. Hat nicht jener Beethoven, den manche für überwunden halten, zu dessen richtigem Verständnis sie aber noch nicht einmal vorgedrungen sind, uns in seinen letzten Quartetten gezeigt, wohin neue Wege führen können. Das kümmert ja aber die Leute nicht; denn leider hat Beethoven auch dann, wenn er neue Wege wandelte, noch Musik gemacht. Das war ein seniles Zeichen bei ihm. Ihm fehlte die bewußte Idee, das Programm, durch welches den Tonkomplexen erst die richtige Form, der Sinn gegeben wird.
Muß denn die Musik ihres ureigensten Wesens entkleidet werden, um wirken zu können? Ließe man doch endlich einmal diese törichte Bezeichnung Programmusik bei Seite. Es [83] existiert ja keine vernünftige Musik, die nicht ein Programm hat. Mag ein solches auch nicht verzeichnet sein, so steckt es doch in einer geordneten Musik darin. Was soll das heißen, »absolute Musik«? Wer hat schon Töne erklingen hören, die nicht absolut gewesen sind. Mit diesen Bezeichnungen wird in der Musik jetzt ein derartiger Unfug getrieben, daß Uneingeweihte wirklich glauben, es gäbe zweierlei Art Musik. Dilettantische Konzertbesucher sind wohl der Meinung, dann Programmusik zu vernehmen, wenn ihnen beim Eintritt in den Konzertsaal ein Programmbuch verabreicht worden ist. Darüber freuen sie sich doch nun aber nicht der Musik wegen, sondern weil sie sich durch Lektüre die Zeit vertreiben können.
Der feinfühlige Hörer, der sich nicht durch ein Programm irre machen lassen will und die Komposition ohne Kenntnis des Titels, der Überschrift genießt, deutet nur die Musik an sich aus! Ob der Komponist an einzelnen Stellen spezielle Vorstellungen gehabt hat, kann ihm gleichgültig sein. Lediglich die Töne sprechen zu ihm; sie allein künden in den Symbolen von all den geheimen Empfindungen, all dem Wohl und Wehe, welches den Komponisten beim Erschaffen des Werkes durchzittert hat. Jede Musikform, ihre Linien mögen sich bewegen wie sie wollen, muß musikalisch verständlich sein, sonst ist sie hinfällig. Nur die Logik der Entwicklung zwingt zum richtigen Nachempfinden. Es ist gewiß sehr zweckmäßig, die Charakterisierung von Musikstücken durch Überschriften, durch die Betitelung einzelner Teile vorzunehmen. Eventuell wird so dem Zuhörer das Verständnis erleichtert. Niemals aber darf die Auffassung des Musikstückes nur nach Kenntnisnahme des Titels möglich sein. Übrigens ist wohl die Bedeutung von Überschriften für das große Publikum nicht zu hoch zu bewerten. Wie viele Konzertbesucher haben eine klare Vorstellung, worum es sich eigentlich handelt, wenn sie z.B. lesen: »Les adieux«, »Kreisleriana«, »Preludes«, »Penthesilea« usw.
[84] Ist die Musik denn so armselig, daß sie nicht aus sich heraus Formen entwickeln kann? Warum muß jetzt immer an etwas anderes gedacht werden, von außen Hilfe kommen, um das scheinbar zu schwache musikalische Gerüst zu stützen?
Bei der jetzt so beliebten Verbindung der Künste büßt sicher eine jede an Selbständigkeit ein. Die Schuld an dem Mißlingen eines Kunstgebildes schieben sich die Musen natürlich dann gegenseitig zu. Mit der fortschreitenden, vielleicht sogar ausartenden Technik hat die Tiefe des Musiksinnes abgenommen, und zum Auffrischen werden Hilfskräfte requiriert. Je intensiver eine Angelegenheit betrieben wird, um so rücksichtsloser wird vorgegangen. Kommt es nicht oft genug vor, daß der zärtlichste Liebhaber im Laufe der Ehe gegen seine Frau brutal wird? Ähnlich verfährt gar mancher Komponist mit der Musik, die er doch scheinbar anfangs so lieb gehabt hat und zum Schluß so niederträchtig behandelt.
Häßliches Sensationsbedürfnis, mangelndes musikalisches, melodisches Empfinden, geringe ästhetische Ausbildung tragen an alledem viel Schuld. Der unglückselige Zeitgeschmack schwebt als leitender Geist allen künstlerischen Bestrebungen voran. Ein Segen wenigstens ist es, daß in der Musik nicht wie in der Malerei cliquenweise gearbeitet wird. Es gibt wohl Cliquen genug. Innerhalb derselben aber schafft ein jeder gesondert für sich, liefert die Extravaganzen allein. Man denke sich nur, wie es in der Malerei jetzt Kubisten gibt, die alles in Kuben malen, in der Musik Sekundisten, nur Sekundintervalle oder Sekundakkorde verwendend, Quintisten, ausschließlich an Quintfortschreitungen festhaltend. Sehr weit sind wir übrigens von solchen Extremen nicht entfernt. Je weniger Verständnis für die eigentliche Natur der Kunst vorhanden ist, um so mehr greift der Unfug aller Art um sich. Gar lustig wandelt man auf Irrwegen, die niemals zu einem Ziele führen können.
[85] Der Gesundbrunnen, in welchem Erholung zu suchen ist, wird die Erkenntnis des wahren Wesens, der Bestimmung der Kunst sein. Zu der Erkenntnis gelangt man sicherlich nur durch die Erwerbung und Verwertung von Kenntnissen. Niemandem soll es verargt werden, neue Gebilde hinzustellen oder für Neuerscheinungen einzutreten. Der Neuerer muß aber unbedingt im Besitze eines großen Könnens sein. Das Neue, Extravagante darf ihm nicht als Deckmantel für seine Unfähigkeit dienen. Unangenehm, lästig, ja direkt schädlich wirken die Leute, welche auf formvollendete Werke vergangener Zeiten verächtlich herabsehen, selbst aber unfähig sind, unvorbereitet einen strengen Satz fehlerfrei auszuarbeiten oder ein Rondo korrekt zu improvisieren. Die Bedingung aufzustellen, daß an der Tradition zähe festgehalten werden soll, wäre töricht genug. Aber nur im Bewußtsein und unter Rücksichtnahme auf unsere große Vergangenheit und nicht in Mißachtung derselben wollen wir vorwärts streben. Dann allein wird uns ein gütiges Geschick vor allen Irrwegen gnädig bewahren.
Stephan Krehl, „Musikerelend“, Teil IV

Stephan Krehl (1864–1924)
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephanKrehl.jpg
Im Jahre 1912 erschien das Buch »Musikerelend« des Komponisten und Musiktheoretikers Stephan Krehl (1864–1924). Krehl, seit 1902 am Leipziger Konservatorium tätig und von 1907 bis zu seinem Tod Leiter der Institution, stellte dort laut Untertitel »Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf« an. Sie sind polemisch formuliert und geben unmittelbare, heute teils kurios anmutende Einblicke in seine Sicht des Musiklebens, insbesondere mit Blick auf die soziale Stellung der Musiker_innen, in einer Zeit des Umbruchs.
Stephan Krehl (1864–1924):
Musikerelend
Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf
[Teil IV]
Leipzig: C. F. W. Siegel [1912].
[46] 3. Kritische Bedenken.
Welch gewaltige Verbreitung hat die Musik in unseren Tagen gefunden. Wir beobachten, daß nicht nur in Ländern, die sonst so gut wie unberührt von künstlerischen Bestrebungen blieben, die Beteiligung an der Kunst rege wird. Auch an den Stätten, welche seit alters her für ihr Kunstinteresse berühmt waren, strebt jetzt eine bei weitem größere Menge darnach, sich mit künstlerischer Bildung zu versehen. Ehemals galt wirklich die Musikwissenschaft als eine Geheimkunst. Nur wenige Auserwählte, die an den kunstsinnigen Höfen der Fürsten Unterstützung fanden oder in den der Kunst geneigten Klöstern und Klosterschulen, den kirchlichen Kongregationen aller Art Gesinnungsgenossen antrafen, konnten gemeinsam das musiktheoretische Gebiet kultivieren, im strengen Sinne musikalische Studien treiben. Jetzt sind in einer Stadt wie Berlin allein gegen 60 größere Musikschulen, von der Unmasse von kleineren Elementarschulen ganz abgesehen. Wenn es nun auch gar nicht denkbar ist, daß alle Schüler dieser Institute sich tiefgehende Kenntnisse erwerben, so werden doch immerhin einer ungleich größeren Zahl von Menschen als früher praktische oder theoretische Probleme der Kunst genauer vorgeführt. In den Leuten, welche einmal die Anregung erhalten haben, bleibt immer irgendein Interesse für künstlerische Erscheinungen vorhanden. Dieser gesteigerten allgemeinen Teilnahme in der großen Menge steht gleichwohl eine Abnahme an der Tiefe des Mitfühlens in den Kreisen, die seit langer Zeit sich mit der Kunst befassen, gegenüber. Nicht nur das sonst mit großem Ernst und Eifer gepflegte Vierhändigspielen ist stark im Rückgang begriffen, auch die Kammermusikpflege in den Familien fängt an zu verkümmern. [47] Gewiß, manche Häuser halten noch auf ihren künstlerischen Ruf; jetzt auch ist man auf die Pflege der Musik bedacht. Doch in einer etwas anderen Manier als früher. Abendliche Feste oder, was billiger ist, Tees werden durch musikalische Vorträge verschönt. Die Ausführung des musikalischen Teils wird dabei, vielleicht aus Protzentum oder der Einfachheit halber, Fachleuten übertragen. Die Sache ist freilich recht durchsichtig. Bleibt die Musik bei alledem doch nur ein Notbehelf. Durch gesellschaftliche Pflichten sind die Gäste im Winter meist überanstrengt und blasiert. Der Mühe ermüdender Konversation sollen sie nun für kurze Zeit überhoben werden. Nach den gereichten leiblichen Genüssen wird ihnen die Gelegenheit eines durch wollüstige Klänge verschönten Verdauungsschlafes geboten. Der große Fehler liegt hier darin, daß die Veranstalter der Feste, wie die Gäste nicht selbst Mitwirkende sind, sondern sich die Vorführung der Musikstücke von Leuten, die ihnen ganz gleichgültig gegenüberstehen, bereiten lassen. Je müheloser man zum Ziel kommt, umso oberflächlicher betrachtet man den zurückgelegten Weg. Wer mit einem Klavierspielapparat die Schwierigkeiten irgendeines hervorragenden Musikstückes überwindet, der wird sich wohl wenig Rechenschaft über die geniale Anlage, den Aufbau der Komposition ablegen.
Wir müssen ja immer und immer wieder staunen, welcher Grad von Vollkommenheit bei der Herstellung solcher Apparate erzielt werden kann. In manchen Fällen werden uns diese Instrumente in Zukunft von der größten Bedeutung sein. Doch läßt sich nicht verhehlen, daß bei dem außerordentlich starken Betonen und Hervortreten des Mechanischen das Innerliche, das Seelische abflacht, Schaden erleidet. Die zunehmende Oberflächlichkeit im Betrieb der Musik hat nun die sehr unangenehmen Folgen des oberflächlichen Aburteilens. Der Gesellschaftsmensch von heute will sich keineswegs in seinem [48] Urteil bescheiden, will nicht vornehm zurückstehen. Er hat Ambitionen. Möglichst rasch möchte er sich in den Besitz einer Kunstmeinung setzen. Über jedes Kunstwerk soll sofort präzis entschieden werden. Die Mitwelt muß erfahren, wie der Richterspruch lautet. Jeder geniert sich mit der Meinung zurückzuhalten oder gar einzugestehen, daß er die Sache nicht verstanden hat. Das ist ja gerade eine Eigentümlichkeit des Übermenschen der neuen Zeit, daß er sich einbildet, auf allen Gebieten beschlagen zu sein. Als Souffleur ist bei der Urteilsbildung in hervorragendem Maße die Tageszeitung beteiligt. Sie trägt kurz und schnell dasjenige, was man ja selbst schon gedacht hat, vor. Ohne dabei irgendwelche Skrupel zu empfinden deutet der Leser die Meinung der Zeitung zur eigenen um. Viele Leute haben bei der Lektüre der Morgenblätter das sichere Gefühl, daß hier ihre höchst eigene Meinung gedruckt worden ist. Ob eine Kunstbesprechung gut oder schlecht ist, darauf kommt es ja eigentlich gar nicht an. Die Hauptsache bleibt, daß das Urteil mühelos und schnell zustande kommt Bis zu einem gewissen Grade existiert für das a tempo-Beurteilen von Kunstwerken und Künstlern sowieso ein Prinzip. Schöpfungen, welche gerade dringend in der Mode sind und die Runde durch alle Konzertsäle machen, werden selbstverständlich gelobt. Neue Werke bekannter Tonsetzer begrüßt man respektvoll. In Uraufführungen unbekannter Autoren oder von Lokalgrößen stellt man sich erst angenehm berührt hin, verhält sich dann aber ablehnend. Künstler, für die viel Reklame gemacht worden ist, läßt man günstig passieren, ausländische Virtuosen, namentlich wenn sie aus Frankreich kommen (sehr schick!) werden ohne weiteres verherrlicht.
Eine Anzahl Anhaltspunkte zur Begutachtung ist vollständig gegeben. Grundirrtümer können da nicht so leicht vorkommen. Sind nun die Besprechungen in den Tageszeitungen derart, daß man sich wirklich von ihnen beeinflussen lassen darf? [49] Sind sie so tiefgründig, so echt, daß getrost ihre Meinung geteilt werden kann?
Wer macht diese Kritik?
Nach Chamberlain: »Verkommene Musiker, die in ihrer Kunst es zu nichts gebracht und in dem Amt des Kritikers eine Zuflucht gefunden haben, seltener Ästhetiker vom Fach, deren Grundprinzip ›die Rechtfertigung jeder Empfindung vor der Vernunft‹ ist«. Ein sonderlich scharfes Urteil aus dem Munde eines Vertreters jener Macht, die es doch ab und zu für zweckdienlich und nicht unter ihrer Würde hält, sich der Presse zu bedienen.
Es ist natürlich nicht in jeder Zeitung derselbe Usus vorhanden. Bald ist ein Blatt in der Lage und fühlt sich verpflichtet, für einzelne Gebiete, so für Kunst und Wissenschaft Spezialberichterstatter zu engagieren. Bald aber ist auch ein Redakteur »Mädchen für Alles«. Heute berichtet er über eine Flugkonkurrenz und ergeht sich in tiefsinnigen Betrachtungen über Flugtechnik usw. Am anderen Tage schreibt er über ein modernes Musikdrama; bald über eine Gemäldesammlung, dann wieder über eine landwirtschaftliche Ausstellung und über den Nutzen der Düngemittel. Daß eine derartige Berichterstattung nicht fachmännische Gutachten abgeben kann, ist selbstverständlich. Aber selbst, wenn für einzelne Gebiete Spezialberichterstatter verpflichtet sind, darf man keineswegs mit unbedingtem Vertrauen die gefällten Urteile hinnehmen. Nur zu häufig kritisieren da Leute, welche nicht berechtigt sind, zu Gericht zu sitzen, weil ihnen selbst das wahre Verständnis abgeht, weil sie über die Grundbegriffe vollständig im Unklaren sind.
Nirgends, in keiner Wissenschaft, in keiner Technik sind die Zustände möglich, welche in der Kunst, speziell in der Musik, herrschen.
Kann man sich vorstellen, daß eine raffinierte maschinelle [50] Einrichtung von Jemand begutachtet wird, der nicht selbst die Technik genau studiert hat, nicht selbst geprüfter Techniker ist? Ist es denkbar, daß ein Mensch ein chemisches Buch kritisiert, der nicht selbst auf das peinlichste Chemie studiert hat und genau darin Bescheid weiß?
Da sagt man wohl, daß die Verhältnisse in der Kunst ganz anders liegen. Die Kunst sei für die Allgemeinheit bestimmt. Zur Aburteilung bedürfe es nicht eines besonderen Studiums, wie in der Wissenschaft.
Doch das ist falsch, grundfalsch!
Sicher wird die Kunst einem ungleich größeren Publikum erschlossen, als jede Wissenschaft. Vielleicht ist sie, wenn wir es so ausdrücken sollen, der Menschheit zugeeignet. Damit ist doch nun aber noch lange nicht gesagt, daß die Widmungspersönlichkeit auch zum Schiedsrichter über das Werk angerufen wird. Jeder Autor will mit einer Widmung irgendeiner Persönlichkeit eine Freude machen, einen Dank abstatten, aber doch nicht lästige und kränkende Äußerungen veranlassen. Vergessen wir nicht, daß sich jedes Kunstwerk, und wenn es noch so klein ist, stets bei genauer Betrachtung als ein außerordentlich kompliziertes Gebilde erweist, dessen Technik nur der voll zu würdigen imstande ist, der selbst sich ausgiebig in dieser Technik versucht hat, dessen Sprache nur der vollständig auszulegen weiß, der ihre Symbole immer und immer wieder gedeutet hat. Sicherlich soll sich beispielsweise an einer Fuge jeder musikalisch empfindsame Hörer erfreuen. Die melodischen, die rhythmischen, die harmonischen Bewegungen, sie können einen Laien, er müßte denn vollständig amusisch sein, nicht unberührt lassen. Die Feinheit des Kontrapunktes wird aber schließlich eben nur ein gebildeter Musiker ihrem vollen Werte nach einschätzen. Um ein schriftliches Urteil über den wirklichen Wert der Fugenarbeit niederlegen zu dürfen, wird man sich selbst immer und immer wieder in [51] der Fugenform versucht haben müssen. Wie reich ist die Musik an Formen. Die Komponisten können sich auf das Verschiedenartigste ausdrücken. Da gehört nicht allein Begabung, auch Zeit gehört dazu, um auf allen Gebieten eine gewisse Meisterschaft zu erlangen. Gar viele Mühe kostet es, jede technische Eigenart der Instrumente zu beobachten, die man, um über sie urteilen zu können, kennen lernen muß. Die Gesangskunst fordert ein Spezialstudium. Jeder weiß, wie schwer es ist, sie richtig einzuschätzen, Fehler und Vorzüge von ihr genau würdigen zu lernen.
Um all das kümmert sich aber gar mancher, der sich als Kritiker aufspielen will, absolut nicht. Er erachtet nur eine schamlose Unverfrorenheit und ein loses Mundwerk als durchaus notwendig. Lehrer musikalischer Unterrichtsanstalten müssen häufig genug darüber Klage führen, daß Jünglinge, eben der Zuchtrute entlaufen, sich als die Herrn der Kritik aufspielen. Die ungünstigen Verhältnisse in der Musik und schlechte Momente in der Heranbildung der Jugend verleiten wohl zum vorzeitigen Kritisieren. Der Anstand müßte aber die Leute, welche gar nicht berechtigt sind, öffentlich Kritik zu üben, kritisch hervorzutreten, vor pietätlosem Vorgehen schützen.
Solche junge Herren, die doch nun wahrhaftig keine Erfahrung besitzen und überall unsicher hin- und hertasten, dürften höchstens schreiben: »Mir (in meiner Unschuld) hat es den Eindruck gemacht, als ob das zur Aufführung gelangte Musikstück so oder so sei. Selbst Leuten von großer Erfahrung und Urteilskraft dürfte es nicht zugestanden werden, sofort Kritik zu üben. Mir nun aber, der ich vollständiger Neuling bin, kann es nicht einfallen, endgültige Besprechungen zu liefern. Ich vermag jetzt nur vom Eindruck, den die Musik gemacht hat und vom äußern Erfolg zu sprechen«. Von solch zaghafter Schüchternheit in der Gesinnung ist aber nie etwas zu spüren. Wer auf der Walstatt erscheint, will Lärm machen, [52] damit er beachtet wird. Das Unvermögen, sachlich richtig abzusprechen, wird durch unsachlich persönliche Bemerkungen, durch gehässige Ausfälle aller Art, durch Anpöblungen niedriger Sorte verdeckt. Meinen doch Viele, daß ein ordinärer Ton eine Kritik wirksamer mache.
Dabei sind diese kritisierenden Herrn sehr sonderbar. Sie verunglimpfen ohne Skrupel jeden beliebigen Virtuosen oder Komponisten, sprechen ihm alle Begabung, alle Fertigkeit ab. Untersteht sich der Abgeurteilte seinerseits, den Kritiker als Ignoranten, als unfähigen Menschen öffentlich zu brandmarken, so wird das als Gemeinheit, als persönliche Beleidigung angesehen und führt sofort zu Skandal und Klage.
Die Pfuscher müssen aus dem Kritikerstand wie aus dem Musiklehrerstand erbarmungslos entfernt werden. Leugnen läßt sich ja freilich nicht, daß die Hast im Besprechen nur zu sehr zur Oberflächlichkeit den Anstoß gibt. Für rechtlich denkende Musiker ist es empörend zu wissen, daß über ein kompliziertes neues Kunstwerk nach wenigen Augenblicken durch einen Berichterstatter ein definitives Urteil gefällt wird. Die nervöse Unruhe des jetzigen Lebens läßt niemandem Zeit zur Besinnung zu kommen. Alles muß überstürzt erledigt werden. Die Kritiker werden direkt gezwungen, gleich nach einem Konzert, womöglich schon während der Aufführung ihre Ansichten schriftlich niederzulegen. Ein ehrlicher Musikant wird es grundsätzlich ablehnen, nach einmaligem Hören über ein Musikstück zum abschließenden Urteil zu kommen. Höchstens können da momentane Eindrücke wiedergegeben werden – und diese fallen, je nach dem man in guter oder schlechter Stimmung ist, sehr verschiedenartig aus – nicht aber Entscheidungen über den Wert oder Unwert der kompositorischen Anlage. Der Kritiker ist aber nicht nur Berichterstatter einer einzelnen Zeitung seines Wohnortes, er ist auch auswärtigen Blättern verpflichtet. An demselben Abend, an dem in minimaler [53] Zeit die einheimische Kritik gefällt worden ist, wird an mehrere Zeitungen anderer Städte ein Extrakt der Aburteilung telegraphiert. Je eigenartiger ein Musiker schreibt, je selbständiger, unabhängiger seine melodischen Gestaltungen, seine harmonischen Verbindungen sind, um so weniger werden seine Werke auf den ersten Augenblick ansprechen, nach einmaligem Hören zugänglich sein. Ja man kann ruhig sagen, daß es ausgeschlossen ist, nach dem ersten Anhören bestimmend abzusprechen. Ein jeder Musiker wird allerdings auch getrieben sein, sofort seine Ansicht zu äußern. Es ist doch aber ein kleiner Unterschied, ob man im Vorübergehen seine Meinung mündlich, d. h. unverbindlich sagt, oder ob man schriftlich der Mitwelt seinen Schiedsspruch verkündet. Da kommt nun dieses unreife Zeug heraus, dieses anmaßende, bösartige, empörende Geschreibsel. Ein scheinbar heller Kopf, der nicht ganz von der vorüberrauschenden Musik unberührt bleibt, der hält sich an dasjenige, was ihm anzuklingen scheint. Stellen, scheinbar herkömmlicher Natur, werden, da sie am meisten auffallen, eine Brücke für das Verständnis bauen und für ihn zur charakteristischen Eigentümlichkeit des Werkes werden. Sind solche Spezialitäten nicht zu bemerken gewesen, so stellt der Schiedsrichter musikgeschichtliche Betrachtungen an, spricht von nationaler Musik, die von dem Angeklagten stillos behandelt worden sei, oder, was noch wirksamer ist, er wirft dem Bedauernswerten Charlatanerie vor und macht ihm Vorschriften, wie er künftighin zu komponieren habe. Seine Eigenart soll der Musiker fallen lassen, das, was ihn stolz beseelt, das Bewußtsein, nicht alltägliche Wege zu wandeln, soll er verleugnen und zur unangenehmen Manier des Eklektizismus übergehen (natürlich damit das Verständnis dem Kritiker weniger Mühe verursacht). Leute, die selbst nur ganz stümperhaft komponieren oder überhaupt nicht tonsetzerisch tätig zu sein imstande sind, machen ihren Mitmenschen Vorschriften über Kompositionstechnik!
[54] Die Art des Kritisierens ist über alle Maßen ungehörig und oberflächlich. In geradezu unglaublicher Weise spielen sich Ignoranten als die Herren auf. Bei der Überfüllung im Musikerberuf wird wohl mancher aus Not wider seinen Willen der kritischen Tätigkeit in die Arme getrieben. Nicht selten aber auch wenden sich junge Leute dem Rezensieren zu, weil sie nichts Ernstliches sonst zu leisten imstande sind. Wir hören es ja häufig genug, daß ein Jüngling, weil er sich der Musik widmen will, schwere Kämpfe mit seinen Eltern zu bestehen hat. Mögen die Vorurteile gegen den Künstlerstand auch nicht mehr so groß wie früher sein, gar mancher Vater ist auch jetzt noch empört, wenn er bei seinem Kinde künstlerische Gelüste derart entdeckt, und setzt dem vollständigen Übergang ins künstlerische Lager den schärfsten Widerspruch entgegen. Eine Vereinbarung wird bisweilen dahin getroffen, daß der junge Mann, um eine Rückversicherung zu haben, sich verpflichtet, erst das Gymnasium zu absolvieren, ehe er probeweise zur Musik übergeht. Während der Schulzeit bleibt meist nicht viel Möglichkeit künstlerischen Bestrebungen zu huldigen. Die Gymnasialbildung hat keinen, hat gar keinen Nutzen für die künstlerische Ausbildung. Nach dem Reifeexamen fängt der Bedauernswerte dann mit 19 oder 20 Jahren künstlerische Elementarstudien an. In Schnelligkeit möchte er das, was ihm fehlt, nachholen. In den Puppenzustand kann er sich aber doch nicht mehr so recht zurückversetzen.
Während ihn auf der Universität, deren Vorlesungen er belegt hat, philosophische, ästhetische und psychologische Probleme beschäftigen, soll er sich beim Musikunterricht mit Sachen, die sonst etwa für ein zehnjähriges Kind bestimmt sind, abplagen. Anfangs ist der Geist noch willig, mit der Zeit aber das Fleisch schwach. Die Finger sind nicht mehr so geschmeidig, um die Technik ohne Kampf zu bewältigen; um in den späteren Jahren noch Elementarstudien mit Erfolg be[55]treiben zu können, dazu gehört eine besondere Gabe und Ausdauer. Aus aller Schwierigkeit wird durch Übergang zur Musikwissenschaft der Ausweg gesucht. Alles Streben richtet sich nach dem Doktortitel, der dann äußerlich scheinbar einen gewissen würdigen Glanz verleiht, im Grunde aber doch auch nichts nützt. In der Musikwissenschaft ist es keineswegs leicht, vorwärts zu kommen. Hier muß eine gewaltige musikalische Potenz mit einem tiefgründigen Wissen sich vereinen. Und selbst wenn das zusammen vorhanden ist, wird die bedeutsame Erscheinung noch nicht mit freudigem Jubel begrüßt. Geniale Persönlichkeiten, die das gesamte musikalische Denken der Zeitgenossen beeinflußt haben, von denen man sprechen wird, wenn musikalische Tagesgrößen längst der Vergessenheit anheimgefallen sind, haben nur nach langem Warten und mühseligstem Arbeiten ein Aufsteigen zu der ihnen unbedingt zukommenden Stellung ermöglichen können. Minderwertige gelangen überhaupt an kein Ziel. Sie bleiben bald auf dem Wege mißmutig und erschöpft im Graben sitzen. Von dort rufen sie entweder genialen vorüberwandelnden Erscheinungen Lobhudeleien nach, erzählen Märchen von Wanderern, die einst dieselbe Straße gezogen sind, oder bewerfen andere, deren Vorüberziehen ihnen lästig erscheint, mit Kot.
Ganz zwecklos ist die Schulbildung natürlich nicht gewesen; die Schüler haben sich eine Art Schreibfertigkeit angeeignet. Die nutzen sie nun aus ohne Rücksicht zu nehmen, ob die Schreiberei Wert hat oder nicht. Wer recht wenig von der eigentlichen Musik versteht, äußert sich jetzt in verbissener Weise über musikalische Produkte. Der scharfe Ton, die Gehässigkeit, welche aus den Rezensionen spricht, verleiht ihnen eine gewisse Natürlichkeit. Wie man in dem harten Kampf um das Dasein stets voller Liebe für den lieben Nächsten bedacht ist, so nimmt man sich auch in der Kritik voller Liebe seiner an!
Vor solchen kritisierenden Herren haben höchst bedauerlicher[56]weise nicht wenige Musiker Angst. Hochstehende Künstler werben mitunter um die Gunst ganz unscheinbarer Existenzen, die nur ihrer Rezensenten-Tätigkeit halber Beachtung finden. Man schreibt ihnen, man bittet sie, einer Aufführung beizuwohnen, ja man ersucht sie um ihren Rat. Ist es da ein Wunder, wenn diese umschmeichelten Scheingrößen eingebildet werden, wenn sie glauben, etwas Besonderes zu sein? In der Musik existiert keine oberste Gerichtsbarkeit; die Kritiker usurpieren die Stellen als oberste Gerichtsherren. Niemand wehrt ihnen das. Sie können schalten und walten, wie sie wollen.
Die Zustände in der Kunst sind nachgerade wahrhaft unglaublicher Natur. Tagtäglich empfinden nur zu viele Musiker bitter das Unmögliche der Situation. Niemand aber hat die Energie, dagegen aufzutreten. Wahrscheinlich wird ja auch ein Einzelner von all den Cliquen derartig bekämpft werden, daß er zum Schluß wie der Sünder dastehen wird. Die Kunst ist eine freie Kunst, aber nur so lange, als die Machthaber die freie Bewegung gestatten. Von der Unfreiheit, zu der man so häufig gezwungen wird, müßten Flugblätter berichten. So gut könnte durch ständige Veröffentlichungen klärend gewirkt werden. Die Flugblätter wären aber von Männern zu schreiben, welche die Verhältnisse richtig ansehen und rechtlich denken. Da dürften keine Nebengedanken, keine spekulativen Sonderinteressen in Frage kommen. Die Aufklärung, welche hier vonnöten ist, könnte in doppeltem Sinne wirken. Erstens hätte das große Publikum zu erfahren, wie häufig es falsch unterrichtet wird, wie viele scheinbar Sachverständige vollkommen unfähig für ihre Position sind und daher, gleichgültig ob wissentlich oder unwissentlich, falsche Urteile fällen. Falsche Urteile, welche eine gute Sache in schlechtes Licht setzen und minderwertige Produkte verherrlichen. Zweitens sollten auch junge Musiker erfahren, wie das eigentliche Geschäft in der Kunst betrieben wird. Die Jugend müßte gewarnt werden, sich [57] in unsaubere Geschäfte einzulassen. Sie müßte mit kämpfen helfen für Ordnung, für vornehme Gesinnung.
Kritisieren darf nicht das Geschäft von verkommenen Musikern sein. Dagegen werden sich die ernsthaften Kritiker selbst auf das Energischste verwehren. Das Rezensieren soll aber auch nicht unreifen jungen Leuten überlassen bleiben. Mit vollem Recht empört das ältere Musiker viel zu sehr. Vielleicht ließen sich einmal Mittel und Wege finden, eine Kritikerschule mit strenger Schlußprüfung einzurichten. Die Zeit des Schulbesuches dürfte allerdings nicht zu kurz bemessen werden. Bestandene Prüfungen bieten keine Garantie für gesammelte Kenntnisse. Immerhin besteht die Wahrscheinlichkeit, daß vor einem Examen mehr Gebiete berührt, mehr Fragen aufgestellt und beantwortet werden, als es sonst der Fall ist.
Wesentlich wichtiger als die Erwägung über den Nutzen von Kritikerschulen erscheint aber die Frage, ob die Kritik, wie sie jetzt betrieben wird, überhaupt einen Zweck hat.
Zunächst für die Künstler.
In ihrer Entwicklung hat sich die Musik wohl niemals um die kleinliche Tagesmeinung gekümmert. Große, frappante Erscheinungen sind von jeher auf starken Widerspruch gestoßen. Die Meinung der Zeitgenossen war anfangs für sie ungünstig gestimmt, jede kritische Äußerung scharf, in ablehnendem Tone gehalten. Mit der Zeit haben sich dann alle Gegensätze ausgeglichen. Die Größe der Neuerscheinung ist rückhaltlos anerkannt worden und über frühere giftige Angriffe ging man lächelnd zur Tagesordnung über. Bisweilen hat auch die Kritik versucht, kurzatmigem Kunstgebilden zu längerem Leben zu verhelfen. Fast stets jedoch ohne dauernden Erfolg. Einer Sache, die den Lebenskeim nicht in sich trägt, läßt er sich nicht einimpfen. Hören wir jetzt auch noch soviel Geschrei um neuere Werke, sie werden, wenn es ihnen das Schicksal bestimmt hat, trotz alledem ruhig dahin welken. Dauernd vermag [58] die Kritik der Kunst weder zu schaden noch zu nützen. Aber momentan erleidet der Künstler durch sie eventuell schweren pekuniären Schaden. Junge Virtuosen spielen mit Opfern in den großen Städten, Komponisten führen für teures Geld ihre Werke auf, doch nur, um anständige Kritiken zu erhalten. Mit denselben wird dann die übliche Reklame gemacht, weitergearbeitet. Die Spieler senden den Konzertdirektionen, die Komponisten den Verlegern die Besprechungen, welche erschienen sind, um sich günstig einzuführen. Die gute Kritik soll somit ein Bon für die Zukunft sein. Fallen die Rezensionen ungerechtfertigterweise schlecht aus, so vermögen sie unendlichen Schaden anzurichten. Der Konzertunternehmer kümmert sich nicht um Virtuosen, die schlecht bei der Kritik weggekommen sind. Ein Verleger wird leicht durch ungünstige Besprechungen stutzig gemacht und von dem Entschluß abgehalten, die Drucklegung eines beim ersten Erscheinen nicht öffentlich belobten Werkes zu übernehmen. Die Mißgunst des Kritikers hat mit dem Wert einer Komposition nichts zu tun. Doch auch für viele Verleger spielt weniger der innere Wert als die Nutzungsmöglichkeit eines Musikstückes die Hauptrolle. Nach schlechter Presseäußerung ist die Aussicht auf Absatz für ein Opus scheinbar gering. Jeder Kritiker, der so leichthin aus irgendeinem Grunde ein Werk verdammt, sollte sich doch etwas Rechenschaft darüber abgeben, wie er eventuell durch ein absprechendes Urteil momentan einen Komponisten pekuniär schädigt, ohne einer anderen Sache zu nützen. Dauernden Schaden wird er ja freilich mit seiner unmotivierten Eintagskritik nicht anrichten können. Dieselbe ist zu schnell vergessen. Kommt es doch vor, daß der Kritiker nach einem Jahr gar nicht mehr weiß, was er geschrieben hat. Dasselbe Werk, das er früher verworfen hat, beurteilt er mit einem Male ganz günstig. Konzertierende Künstler können gleichfalls schwer geschädigt werden, wenn sie sich zu sehr auf die Rezensionen verlassen. [59] Sie sollten, ernstlich gesprochen, die Urteile der Presse überhaupt nicht zur Reklame verwenden. Wie man in den Ankündigungen druckt: »In Nr. 50 vom Lensfelder Tageblatt wird geschrieben, daß Herr X. ein ganz unvergleichlicher Virtuos ist,« so kann man doch auch hinsetzen: »Herr Meier sagt, daß Herr X. ein erstklassiger Geiger ist. Herr Schmidt bestätigt Herrn Meiers Ansicht und Herr Müller erklärt Herrn X. als Künstler, Herrn Meier und Schmidt als Lobredner des Künstlers für die größten Genies«. Das ist alles ganz gleichgültig. Niemand prüft abgedruckte Preßäußerungen auf ihre Richtigkeit nach. In der Reklame kommt es nur darauf an, daß ein Name häufig und lobend genannt wird. Wer gelobt hat – das frage man das Schicksal. Am einfachsten besorgt der Komponist doch, wenn er die nötige Einbildung besitzt, die Rezension selbst. Die Kunst vermag durch die Kritik eben so wenig beleidigt zu werden, wie ein Heiliger entwürdigt wird, wenn ihn ein Gottloser scheel ansieht. Die Künstler sind aber auf das Geldverdienen für ihren Unterhalt angewiesen und, weil der Zwischenhandel die Kritik aus geschäftlichen Gründen ernst nimmt, so kann der Künstler auch mit Recht verlangen, daß sie ernsthaft gehandhabt wird.
Ist die Kritik nun für die große Masse zweckdienlich?
Zweckdienlich vielleicht insofern, als der unfähige Hörer ohne Schwierigkeit durch Adoption einer fremden Meinung scheinbar zum selbständig denkenden Kunstenthusiasten wird. Das mangelnde kritische Vermögen besteht beim Laien aber leider nicht nur gegenüber der Kunst, sondern auch gegenüber der Rezension selbst. Fehlt doch vollkommen die Eigenschaft hier Gut von Böse zu trennen. Der Grund von irgendeiner Gunst oder Mißgunst wird nicht durchschaut. Wie soll das schließlich auch möglich sein, wenn von all den im Stillen treibenden Kräften keine Kenntnis vorhanden ist. Die wirkliche Qualität der kritischen Seele wird gar nicht in Betracht genommen. Der üble Gebrauch mancher Zeitungen, [60] Besprechungen ohne Namensnennung zu veröffentlichen, bringt noch eine Spezialverwirrung. Der Leser ist da schließlich gewillt, auf die Vorstellung einer schreibenden Persönlichkeit zu verzichten; er macht, als ob das selbstverständlich wäre, die Tendenz, den Geist der Zeitung für die Haltung, den Ton der Rezension verantwortlich. Freilich bleibt auch im Falle der Signierung die signierende Persönlichkeit mehr oder weniger in Dunkel gehüllt. Aber der Leser ist zufrieden, wenn er ständig wieder denselben Namen erblickt. Scheint doch die Wiederkehr ein und derselben Unterschrift etwas Konservatives zu sein, eine gewisse Garantie zu bieten. Faktisch bleibt der Leser natürlich durchaus im Unklaren und will und kann auch nicht erkennen, ob der Malkritiker ein Poet, der Musikreferent am Ende ein Maler ist. Häufig ist ja der künstlerische Beirat der Zeitung weder Poet noch Maler, sondern Dilettant in allen Künsten. Es geht doch eigentlich über jedes Verständnis, daß über die Werke der Malerei und Plastik Leute, ohne auf diesen Gebieten jemals produktiv gewesen zu sein, sich auslassen. Ein Mensch, der mit Farben nicht umzugehen versteht, niemals einen Pinsel in der Hand gehabt hat, überhaupt gar nicht zeichnen kann, wagt es, Entscheidungen über die schwierige Technik der Malerei zu treffen. Musikalische Arbeiten werden von Musikunkundigen begutachtet, von Skribenten ohne jede Übung in der formellen Gestaltung von Musikwerken. Die Naivität ist wahrhaft rührend. Der Schaden im Publikum aber sicherlich unberechenbar. Es ist eben jetzt daran nichts zu ändern, daß die große Menge aus Unkenntnis die Zeitungsartikel für durchaus glaubwürdig hält. »Aber es hat in der Zeitung gestanden«, wie oft hört man nicht diese Affirmation. Mit der Zeitung billigt oder verwirft man die Kunstwerke. In unserer schnellebigen Zeit ist eine Schöpfung plötzlich, wie sie von der Kritik vernichtet wird, auch vom Publikum vergessen. Und in Aufnahme kann [61] sich ein Künstler, der verstoßen worden ist, nur wieder durch Reklame, durch Verbindung mit der Kritik bringen.
Alles in allem! Für die Kunst gleichgültig, für die Künstler schädigend, für das Publikum verwirrend, so hat man die Kritik zu charakterisieren.
An Stelle der durchaus lästigen und unzulässigen Kritik müßte die Berichterstattung treten. Nach der Aufführung eines Werkes genügt es zu erfahren, wie die melodische und harmonische Eigenart darin sich zeigt, welche formelle Gestaltung vorliegt, wie das Stimmungsprinzip lautet. Einzelheiten über Ausführung und Aufnahme möchte man hören. Die persönliche Ansicht des schreibenden Herren ist im höchsten Grade gleichgültig und für die Allgemeinheit interesselos. Nicht wie ein Opus dem Kritiker gefällt, sondern wie es wirklich ist, will man wissen. Da nach flüchtiger Bekanntschaft, nach einmaligem Anhören ein definitiver Entscheid über den Wert oder Unwert einer Komposition überhaupt nicht gegeben werden kann, haben alle Versuche, eine sinngemäße Aburteilung vorzutäuschen, zu unterbleiben.
Wohl existiert eine berechtigte Kritik: Die Besprechung von Kompositionen in Fachzeitungen. Leider sind jetzt häufig dieselben Herren, welche in den Tageszeitungen schreiben, auch Herrscher in den Musikzeitungen. Das gleich lässige und oberflächliche Benehmen ist hier wie dort zu beobachten. Angenommen aber, ein reifer, denkender, künstlerischer Mensch äußert sich in einer Fachzeitschrift über lang beobachtete und studierte Werke, eine wirklich fachmännische Kritik, eine Begutachtung nicht nur von augenblicklichem, sondern von dauerndem Wert kann da entstehen. Mag sein, daß die Rezension nicht nach dem Wunsche aller Kenner, nicht nach der Auffassung des Autors ausfällt. Geschmacksverschiedenheiten, Abweichungen in künstlerischen Anschauungen spielen eine zu große Rolle. Aber selbst wenn hier eine ungünstige [62] Meinung über eine scheinbar gute Schöpfung in anständigem Ton laut wird, versteht man sie, weil sie ehrlich gemeint, vornehm gedacht und vorgetragen ist. Kein vernünftiger Künstler oder Schriftsteller erwartet, namentlich wenn er in seinen Veröffentlichungen Neues bringt, eine sofortige unbedingte und allseitige Zustimmung. Für seine ernste Arbeit ist er aber auf eine ernstliche Entgegnung zu rechnen berechtigt, auf eine Aburteilung, aus welcher etwas zu lernen ist. Solch sachlich ernsthafte Kritik vermag nur aus dem liebevollsten Sichversenken, dem innigsten Vertrautsein hevorzugehen. Und das kann doch wahrhaftig bei einem eigenartigen Kunstwerk nicht nach einer halben Stunde, sondern erst nach längerer Zeit geschehen. Eine Besprechung, welche aus dem innigsten Versenken in eine Komposition resultiert, stellt auch ein Kunstwerk dar. Ihre Bedeutung wie ihren Einfluß wird niemand leugnen. Unbedingt soll auch solch eine Schöpfung der Nachwelt erhalten bleiben.
Vornehme und sachliche Kritiken fehlen uns häufig genug. Ist doch ihre Aussprache in den Musikzeitungen direkt ein Bedürfnis. Meistens sind ja leider die Fachzeitungen nur in den Händen von Musikkundigen. Die Kritiken kommen demnach nur einem geringen Teil des Publikums zur Kenntnis. Warum können aber schließlich nicht auch große Tageszeitungen von Zeit zu Zeit Besprechungen ernsthafter Natur über Musik veröffentlichen? Deswegen braucht man ja nicht davon abzugehen, täglich über die Tagesneuigkeiten zu berichten. Für das große Publikum, dessen Musikinteresse doch bloß oberflächlicher Natur ist, genügt aber dann unbedingt die Berichterstattung, die das Unumgängliche über Ausführung und Aufnahme von Kunstwerken verzeichnet, ohne in gehässiger Weise eine Sonderpolitik zu treiben und durch Verkennen oder Entstellen Schaden anzurichten. So wird man am besten allen Wünschen gerecht werden und vor allem der Kunst dienlich sein.
Stephan Krehl, „Musikerelend“, Teil III

Stephan Krehl (1864–1924)
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephanKrehl.jpg
Im Jahre 1912 erschien das Buch »Musikerelend« des Komponisten und Musiktheoretikers Stephan Krehl (1864–1924). Krehl, seit 1902 am Leipziger Konservatorium tätig und von 1907 bis zu seinem Tod Leiter der Institution, stellte dort laut Untertitel »Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf« an. Sie sind polemisch formuliert und geben unmittelbare, heute teils kurios anmutende Einblicke in seine Sicht des Musiklebens, insbesondere mit Blick auf die soziale Stellung der Musiker_innen, in einer Zeit des Umbruchs.
Stephan Krehl (1864–1924):
Musikerelend
Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf
[Teil III]
Leipzig: C. F. W. Siegel [1912].
[32] 2. Tote Seelen.
Unangenehm, ja widerwärtig ist das geschäftliche Gebaren, wie es sich leider neuerdings in der Kunst breit macht. Mit Geld kauft man die Welt, klingende Münze schafft das Renommee, mit Gold lockt man den Beifallsjubel hervor. Nichts ist mehr heilig in dem Tempel der Kunst. In krasser Pietätlosigkeit werden die Heiligtümer der Ahnen zerstört. Manch einer, der nicht Geschäftssinn genug besitzt, um sich durchzudrücken, der nicht modern genug denkt, um an den Profanationen teilnehmen zu können, geht erbarmungslos zugrunde. Aber trotz seines äußerlichen Versinkens, seines schmerzlichen Leides ist er wohl innerlich ruhiger, sieht er getrost seinem Ende entgegen, denn er ist nicht schuldbeladen wie andere, welche auf unrechter Bahn zu äußerem Glänze gelangt sind. Es ist unsagbar traurig, daß nicht wenige Künstler bei dem gewaltsam inszenierten Aufstieg zu ihrer Scheinherrlichkeit innerlich kaput [sic] gehen, innerlich absterben. Ein Dirigent, ein Sänger, ein Virtuos, ein Komponist weiß sich in dem Getriebe mit großem Glück durchzusetzen. Er gelangt äußerlich zu einem staunenswert prächtigen Resultat. Doch in dem Kampf hat nur der Körper gesiegt, der innere Mensch ist abgestorben. In glänzender Hülle ruht eine tote Seele.
Gar seltsam ist es, daß die Beschäftigung mit der unvergleichlich schönen und edlen Kunst so selten den inneren Menschen berührt. Große Künstler, welche dank ihrer außerordentlichen Befähigung einen tiefen Einblick in die Geheimnisse der Tonkunst gewonnen haben, sind keineswegs dadurch zu einer größeren inneren Vollkommenheit gelangt. Im Gegenteil! Sie sind voll von Lastern, ihre moralischen Anschauungen haben sich vollständig verwirrt. Sicher sind die Koryphäen [33] in ihrer Sonderstellung mehr der Gefahr ausgesetzt, ihre Reinheit zu verlieren. Aber die geheimnisvolle Macht der unsagbar großen Kunst sollte sie doch auch in ganz anderer Weise schützen und bewahren, sie auf sicherem Wege aus dem Schmutze des Daseins emporführen. Fälschlicherweise ist man bei Leuten, welche aus irgendeinem Grunde eine größere Bewegungsfreiheit haben, nachsichtiger gegen schlechte, ja gegen falsche Bewegungen. Niemand wundert sich auch nur im geringsten, wenn die Künstler dem unsaubern Sensationsbedürfnis der jetzigen Zeit Rechnung tragen. Das Publikum erwartet von einer Neuerscheinung, daß sie interessant ist. Unter dem »interessant« wird aber »pikant« oder besser »unmoralisch« verstanden. Die Opern, Singspiele und Operetten, welche neuerdings mit erstaunlichem Erfolge die Bühnen der ganzen Welt beherrschen, sind in ihren Sujets nur zu häufig gemeiner, schlüpfriger oder perverser Natur. Der Theaterbesucher wird nicht erbaut und angeregt, sondern nur verwirrt und aufgeregt. Die Musik unterstreicht bei ihrer enormen Ausdrucksfähigkeit alle Bühnenvorgänge energisch. Sie schmiegt sich so intensiv den Worten, den Handlungen an, daß sie mit diesen scheinbar selbst moralisch oder unmoralisch wird.
Die absolute Musik hat es nun freilich schwer, unmoralisch zu werden. Es gibt keine tonlichen Symbole für Unsittlichkeit; die Tonfolgen fügen sich diesem zeitgemäßen Wunsche nicht. Sonst hätten wir längst sexuelle Klavierstücke. Aber durch Extravaganzen aller Art läßt sich auch in Klavierstücken, in der Kammermusik, im Orchester dem Sensationsbedürfnis Rechnung tragen. Was das Publikum haben will, das wird schließlich in ausreichendem Maße geliefert. Und leider sind es häufig gerade hervorragend begabte und intelligente Musiker, die sich von der Sensationslust der Menge auf Abwege ziehen lassen. Eine Persönlichkeit, die erzieherisch zum Guten wirken sollte und könnte, wird zum raffinierten Verherrlicher gemeiner [34] Instinkte. Man kokettiert mit dem Theismus und verkündet grinsend den Atheismus; man tut verschämt und züchtig und huldigt lachend der Perversität. Dieses Widerspruchsvolle, dieses Unwahrhaftige und Verlogene, das wirkt auf die heranwachsende Jugend, auf alle Unklaren und Urteilslosen äußerst schädlich.
Den Begabten darf man alle Seitensprünge viel weniger nachsehen als den geistig Armen. Ihnen wird in ihrer hohen Begabung eine solche Macht verliehen, daß jeder Mißbrauch davon als ein grobes Unrecht zu brandmarken ist. Aber es gibt Leute, die ihren Verstorbenen die Sündenfälle noch zum Ruhme anrechnen möchten, die nicht zuzugeben geneigt sind, daß ihr Abgott ein Götze ohne Seele war. Wer die Macht hat, hat das Recht. Wer das Recht hat, darf Unrecht tun, um einen Sünder reinzuwaschen. So folgert man ganz ungeniert und macht aus der Wahrheit eine Dichtung, aus der Geschichte ein Märchen. Anstatt offen zu bekennen, wenn bei einem großen Künstler, dessen Lebenslauf man überschaut, die Reinheit des Empfindens sich nicht ebenbürtig der Reinheit der Tonkunst zeigte, daß deprimierende Defekte hier vorhanden waren, sucht man die Fehltritte zu verherrlichen und den Anschein zu erwecken, als ob die große Kunst auch den Menschen groß gemacht habe.
Wirklich, bisweilen macht es den Eindruck, als ob Musizieren eine rein mechanische Beschäftigung sei. Zweifelsohne ist zunächst das Technische an der Kunst etwas Äußerliches. Man probiert, man studiert, man experimentiert ohne inneres Erlebnis. Mit solchen nicht tief gehenden Vorübungen werden aber doch nur die Wege geebnet, damit das eigentliche Kunstwerk ohne Schwierigkeit geschaffen werden kann. Bei der genialen Produktion, wie bei der Reproduktion, wächst die Technik aus der inneren Idee heraus. Eine erhabene Leistung kann nur erzielt werden, wenn das Technische innerlich mit[35]empfunden ist. Bei jeder Art bedeutsamen und großen Schaffens muß die Seele in Mitleidenschaft gezogen sein, mitschwingen. Augenscheinlich trennt sich aber bei Vielen ein Teil musikalisch empfindender Seele ab. Vielleicht wird bei ihnen nur momentan eine Seelenvibration erzeugt, die aber nicht nachhaltig genug ist, um in dem Menschen weiter zu zittern. Oder sie verstehen es nicht, eine Verbindung auch mit den weniger empfindsamen Teilen herzustellen, dieselben günstig zu beeinflussen. Und das müßte doch das Erste sein, daß jede Kunstäußerung, welche momentan aus guten und edlen Motiven entspringt, auch dauernd bessernd und verklärend wirkt.
Die große Menge hat ja von der erlösenden Macht der Kunst überhaupt keine Ahnung. Die Konzerte werden besucht, in den Theatern macht man sich breit, die Säle der Gemäldeausstellungen werden durchquert aus unkünstlerischen, aus prosaischen Motiven. Die Künstler sind doch eben in den Augen gar vieler immer noch Ausnahmsmenschen, mit denen man nicht im Sinne wie mit den andern Menschen rechten kann. Sie sind die Gaukler, deren man zur Unterhaltung aber gar dringend bedarf.
Von jeher ist in der Künstlerschaft ein freier Ton heimisch gewesen. Leider haben aber auch stets schlechte Elemente diesen freien Ton auf einen gemeinen Ton herabgestimmt. Und dieser unreine Ton ist es nun gerade, der vielen Sterblichen so ungemein verlockend klingt. Man möchte die künstlerische Freiheit des Verkehrs nicht in der Familie haben, findet sie aber zur zeitweisen Kenntnisnahme sehr interessant, eine vorübergehende Beschäftigung mit ihr höchst amüsant. Das nutzen bedauerlicherweise gar viele aus, die sich Künstler nennen und doch nur Vagabunden in der Kunst sind. Ihnen ist die Kunst nur das große Reklameschild, hinter dem sie ein unsauberes Leben führen. Sie wissen wohl zu schätzen, [36] wie viel sie sich hier leisten können, was ihnen sonst im Leben arg verübelt würde.
Eine arme Frau, welche vorübergehend in einem Haushalt beschäftigt ist, hat, um den Hunger ihrer Kinder zu stillen, etwas gestohlen. Wie wird da, als der Diebstahl entdeckt ist, die Empörung rege. Niemals wieder wird man die Person im Hause beschäftigen. Sie ist eine gebrandmarkte Verbrecherin. Ein Künstler, welcher die gemeine Schande des Ehebruchs auf sich geladen hat, welcher moralisch ein zehnmal größerer Verbrecher ist, als die arme Diebin, die nur in höchster Not zum Verbrechen schritt, der verkehrt nach wie vor in demselben Haus. Er ist eine Zierde der Gesellschaft, der moralische Fleck macht ihn amüsant. Gesangs- und Instrumentalvirtuosen gibt es, welche in moralischer Beziehung Verbrechen auf Verbrechen häufen. Die große Menge verachtet sie deshalb nicht. Im Gegenteil! Nach erneutem Skandal erneuter Jubel, je mehr innerlicher Verfall, desto größeres äußerliches Aufsteigen, je mehr Schmutz, um so mehr Glorie.
Die große Menge wartet ja doch nur von Tag zu Tag auf Skandale; ihr ist dieses freie Benehmen sehr sympathisch. Sie ergötzt sich daran, solange es ihr paßt; sie wendet sich freilich auch rücksichtslos ab, wenn sie davon übersättigt ist. Wer die Kunst tief und innerlich empfindet, beobachtet mit tiefem Schmerz die große Versumpfung. Wie schwindet da oft die Hochachtung für Künstler, welche scheinbar bedeutsame Naturen sind und doch einen so schimpflichen Lebenswandel führen. Ein Pianist hat durch seine eigenartigen Leistungen in einem Konzert Aufsehen erregt. Man sucht ihn am Morgen nach seinem Auftreten im Hotel auf, um ernste künstlerische Fragen mit ihm zu besprechen. In seinem Zimmer weilt eine nur wenig bekleidete Dame, eine angebliche Schülerin, welche der Hoteldiener die Frau Gemahlin tituliert. Doch die Liebschaften gehen die Mitmenschen nichts an; das mag ein Jeder [37] mit sich selbst abmachen, so lange er frei und unabhängig ist. Wenn man aber weiß, daß unser Don Juan zu Hause eine junge zarte Frau besitzt, die am Bett ihres kleinen Kindes weilt und die Reinheit des Hauses behütet, während der Mann auswärts die Ehre desselben besudelt, ist man nicht mehr im Stande, an die wahre Künstlerschaft zu glauben.
Von einem anderen Musiker ist bekannt, daß er seine Frau betrügt. Die Ärmste hat sich mit ihrer ganzen Familie zerworfen, hat alles, was ihr in der Heimat teuer war, verlassen, um dem von ihr aufrichtig geliebten Künstler zu folgen und alle Entbehrungen mit ihm zu teilen. Der Ehrenwerte bekommt die von den Eltern Verstoßene und Enterbte bald überdrüssig; er wirft sich einer ordinären Person in die Arme und betrügt die bedauernswerte Frau, welche sich völlig dem Manne geopfert hatte.
Es ist betrübend, all der Schändlichkeit, all der empörenden Niedertracht zu gedenken, wie sie sich in solchem Benehmen äußert. Da viele dieser Kunstvirtuosen auch Lebensvirtuosen sind, so wissen sie sich immer mit Grazie über alle Schwierigkeiten hinwegzusetzen. Die Ehen, welche im Himmel geschlossen werden, sollen sich auch erst im Himmel lösen, so sagen sie. Eine Künstlerehe ist aber eine Sache mit sehr irdischem Beigeschmack, daher soll sie nach nicht zu langer Zeit auf Erden wieder getrennt werden. Scheidungsgrund ist stets da, weil Ehebruch konstant vorliegt.
Häufig wird eine Scheidung aber gar nicht für notwendig erachtet oder überhaupt nicht in Betracht gezogen. Die Unkosten davon sind viel zu bedeutend. Äußerlich bleibt das Pärchen scheinbar hübsch säuberlich beieinander. Tatsächlich aber lebt es – echt musikalisch – als Triole weiter. Er fährt auf seinen Konzerttournees mit seiner neuen Auserwählten herum, schenkt ihr und eventuell den Kindern, welche er von ihr hat, bedeutende Summen, findet dann aber natürlich [38] kaum die Mittel, seine legitimen Sprößlinge gehörig zu bedenken.
Wie muß es in dem Innenleben von solchen Menschen aussehen? Welch moralische Anschauungen werden sich bei ihnen herausbilden? Da wird ein sonderbares Ideal für eine vollkommene Welt, für eine geläuterte Menschheit, eine edle Kunst konstruiert werden!
Die Grenzlinien zwischen Gut und Böse sind bei diesen Menschen verwischt, ja vertilgt. Wahrhaftig, in ihnen ist etwas erstorben. Ihre Seele ist tot, da sie noch leben, noch wirken.
Die Entschuldigungen, welche für alle die Fehltritte der Künstlerschaft angeführt werden, sind sehr einfach. In allen Schichten der Bevölkerung (so sagt man), in allen Berufsarten kommen Entgleisungen vor. Warum soll der Künstlerstand davon ausgenommen sein?
Das ist wohl richtig! Wir würden auch von den Künstlern keine besondere Lebensführung verlangen, wenn wir nicht außergewöhnliche Anregungen von ihnen erwarteten. Solange die Kunst nichts ist als eine Unterhaltung in müßigen Stunden, solange Kunstäußerung nur handwerksmäßige Gauklerei bleibt, sind auch an sie und ihre Verkünder keine abnormen Anforderungen zu stellen. Nun gibt es doch aber Leute, denen die Kunst ein Heiligtum ist, denen die Beschäftigung mit der Kunst zum Gottesdienst wird. Diese beanspruchen auch, daß sich die Priester der Kunst rein halten, daß die Verkünder der ewigen, unvergänglichen Schönheit keine falschen Propheten sind, sondern bis in das Innerste berührte, geläuterte Wesen.
Keinem Ernstgläubigen ist es gleichgültig, wie sich ein Diener der Kirche beträgt, wie ein Verkünder ewiger Wahrheiten denkt und empfindet. Der gläubige Christ sucht in seinem Pfarrer nicht nur einen glänzenden, bestechenden Kanzelredner, er sucht in ihm auch den bessern, geläuterten Menschen, welcher durch Umgang mit edlen Christen, durch ununter[39]brochene Beschäftigung mit den Fragen über die letzten Dinge, durch Abkehr von den kleinlichen Sorgen und Kämpfen des Lebens zu größerer, innerer Ruhe und Abgeklärtheit gekommen und dadurch in den Stand gesetzt ist, andern kämpfenden und schwankenden Naturen eine Stütze, ein Halt zu sein.
Zur größeren Freiheit und Selbständigkeit dringt aber niemand durch Abkehr vom Leben vor. Nichts kann törichter sein, als das Heil in der Weltflucht suchen zu wollen. Viele meinen dadurch jenseits von Gut und Böse zu kommen und sie gelangen doch nur zu leicht zum Überbösen. Nein, mitten im Leben muß man stehen, der Kampf des Daseins muß ringsherum toben, und trotzdem soll eine Erlösung, eine Befreiung gefunden werden, die echt ist, weil sie auf natürliche Weise zustande kam. Beim Musiker soll es keine Trennung zwischen Künstler und Mensch geben. Faktisch kann ja eine solche auch gar nicht bestehen; nur soll der Künstler den Menschen ungleich mehr beeinflussen, ungleich mehr läutern, als es so häufig der Fall ist. Alle rechtlich und ehrlich denkenden Musikfreunde erwarten von den Kunstproduktionen keine Täuschungen, sondern Belehrungen und Erbauungen. Eine Belehrung kann wohl aber nur der Mensch geben, welcher innig und tief das Kunstwerk durchdacht hat, eine Erbauung vermag nur derjenige zu gewähren, welcher selbst geläutert worden ist.
In Jeder Art des musikalischen Unterrichts benötigen wir musikgeschichtlicher Betrachtungen. Größte Vorsicht muß allerdings dabei für die biographischen Besprechungen geboten sein. Kann es doch nicht zur Vertiefung feinen Kunstempfindens beitragen, wenn immer von neuem festzustellen ist, wie gehässig sich große Künstler über geniale Zeitgenossen, ebenbürtige Mitkämpfer ausgesprochen haben. Die musikalische Ausdrucksweise fortschrittlicher Musiker ist meist nicht im Augenblick zugänglich und wird nur zu häufig selbst von Künstlern, denen man das eigenartigste Mitempfinden zutrauen [40] sollte, mißverstanden. Da fallen spitze Bemerkungen, unfreundliche, kränkende Worte.
Solch kleinliche Züge und Gefühlsroheiten geben leider nur zu häufig sinn- und geschmacklosen Anbetern bedeutender Menschen willkommene Gelegenheit, eine ordinäre Hetze zu veranstalten. Welch böse Auswüchse hat das Cliquenwesen, wie es in den letzten vierzig Jahren innerhalb der Musikerkreise entstanden ist, gezeitigt! Dadurch ist das versöhnende Element so unbarmherzig aus der Musik ausgeschaltet worden. Die Rücksichtslosigkeit in dem Streit der Parteien hat nur zu stark alle Nächstenliebe unterdrückt. Mit starrem Entsetzen ist der harten Worte zu gedenken, deren sich einzelne Helden solcher Cliquen beim Tode von großen Künstlern, welche dem Abgott der Sippschaft verhaßt waren, bedient haben. Ein derartiges Gebaren scheint wirklich nicht für den veredelnden Einfluß der Kunst zu sprechen.
Ist deshalb wirklich der Musik ein Vorwurf zu machen? Dürfen wir die Kunst für diese menschlichen Sünden zur Verantwortung ziehen?
Das wäre töricht genug! Mit Beschämung allein ist festzustellen, daß in diesen Menschen etwas erstorben ist. Sie haben es nicht verstanden, die Funken mitleidsvoller Liebe, welche die Gottheit ihnen in ewiger Teilnahme verliehen, an dem Altar der Kunst zur hellen Flamme zu entzünden. In greulicher Selbstüberhebung haben sie sich von dem göttlichen Einfluß der Kunst losringen wollen und sich dabei selbst verstümmelt, einen Teil der Seele, der zum Leben erweckt werden konnte, ertötet.
In jedem großen Getriebe werden sich stets schlechte Elemente vorfinden. Die vollständige Vernichtung derselben wird ein Ding der Unmöglichkeit sein. Passiert es doch häufig genug, daß bei einzelnen Persönlichkeiten schlechte Instinkte erst spät plötzlich und gewaltsam hervorbrechen.
[41] Niemand aber wird schlecht, wenn er nicht Anlage zum Bösen in sich trägt. Das Böse zu bekämpfen, vor dem Bösen zu warnen, das muß eine der vornehmsten Aufgaben in der Erziehung sein. Alle Mittel, welche zur Veredlung, zur Verfeinerung des Menschen beitragen können, müssen hierzu willkommen sein.
Wird es mit Absicht oder durch Zufall übersehen, daß uns gerade in der Beschäftigung mit den Künsten ein so herrliches und wichtiges Erziehungsmittel erstehen kann? Werden nicht einem Jeden, der sich in die Ideenwelt unserer großen Maler, Bildhauer und Musiker mit Ernst versetzt, die Stunden des Einlebens in die tief künstlerischen Geheimnisse zu Stunden wahrer Erbauung? Wohl kostet es oft Mühe, den Ideen zu folgen, den intimen Gefühlsmomenten nachzuspüren. Welch hohe Befriedigung gewährt es aber auch, wenn die wirkliche Anteilnahme an all der Schönheit angeregt worden ist. Offen gesagt, bleibt es unververständlich, daß von gewisser Seite aus das äußerliche Erlernen toter Sprachen nach wie vor für das wichtigste Erziehungsmittel gehalten wird. Der Jugend wird dabei recht wenig angepaßt. Wir erleben es daher häufig genug, daß Knaben von dieser Erziehungsmanier vollständig unberührt bleiben, nicht gefördert werden. Sie fassen keine Zuneigung, fühlen sich aber auch von dem, was ihnen geboten wird, nicht abgestoßen. Die vollständige Gleichgültigkeit ist vielleicht die schlimmste Erscheinung dabei und fällt zu gleicher Zeit das vernichtendste Urteil gegen diese Art der Bildung.
Musik ist kein leeres Spielen mit Tönen. Darüber ist man sich längst klar. Mancher Komponist schreibt wohl eine Anzahl Werke so leicht hin, mechanisch, aus Gewohnheit. Solche Werke werden aber dann auch nur technisches Interesse haben, eventuell sogar völlig eindruckslos vorübergehen. Was zum Herzen geht, muß auch vom Herzen kommen. Von wahrer [42] Musik kann gar nicht anders als von »Musik als Ausdruck« gesprochen werden. Wie man den Ausdruck der Musik immer und immer wieder zu deuten bestrebt ist, so soll man auch den gewaltigen Eindruck, welchen sie hervorzubringen vermag, vielmehr würdigen und ausnutzen. Es gibt keine Kunst, welche in gleicher Vornehmheit und Reinheit wie die Musik, Empfindungen darzustellen imstande ist. Unter den Kindern ist stets nur ein kleiner Teil im eigentlichen Sinne musikalisch. Doch lassen sich gar viele willig und gern von den schönen Folgen einer guten und edlen Musik beeinflussen. Einer lebenswarmen Ästhetik kann es im Jahrhundert des Kindes wohl nicht schwer fallen, die ersehnte, allgemeine, verständliche und nützliche künstlerische Lehrmethode aufzustellen.
Ebensowenig wie die Musik ein leeres Spielen mit Tönen ist, darf die Beschäftigung mit der Musik ein unnützer Zeitvertreib sein. Mit Ernst sollen alle Übungen vorgenommen werden. Übermäßige Strenge ist aber keineswegs immer bei den künstlerischen Elementarübungen richtig angebracht. Die Schule steht den künstlerischen Bestrebungen feindlich gegenüber. Sie gönnt ihnen nur ungern und wenig Zeit. Viele Eltern jedoch wünschen, daß ihre Kinder sich in der Musik betätigen. Von Schulstunden und Arbeiten ermüdete Geschöpfe werden gezwungen Übungen auf dem Klavier, Studien auf der Violine zu machen. Nur widerwillig gehen die von der Schultätigkeit abgespannten Kinder an diese Beschäftigung mit der Kunst. Von irgendeinem Wohlbefinden bei den Übungen ist fast nie die Rede. Im Gegenteil! Die Viertelstunden der Exerzitien sind eine Qual, eine Elend für die Zuhörer, eine Strafe für die Ausführenden. Man beschäftigt sich bei diesen Studien angeblich mit der Kunst. Von der wunderbaren Wirkung derselben, von ihrer geheimnisvollen Bildung ist nicht im entferntesten die Rede. Daß sich in den feinsinnig geordneten Tönen, in den wundersamen Harmonien ein reiches Gefühls[43]leben widerspiegelt, daß die kostbaren Melodien der großen Meisterwerke der Tonkunst ein Abglanz ewiger Schönheit sind, davon kommt dem Kinde nichts zum Bewußtsein. Die Jugend empfindet in den Musikstudien meist nur die Last, welche den Schulplagen noch aufgesetzt wird.
Die Eltern wollen bei ihren Kindern bald eine ansehnliche Beherrschung der Technik in der Kunst sehen. Die Schule betrachtet mißgünstig jede künstlerische Beschäftigung, weil sie den Schüler von den eigentlichen Schulaufgaben abzieht. Das Kind versteht nicht den Sinn der künstlerischen Beschäftigung, weil niemand ihm den seelischen Wert der Kunst erklärt.
Ist es ein Wunder, daß bei der wirklich geringen inneren Anteilnahme so viele schlechte Resultate erzielt werden? Kann es uns in Erstaunen setzen, daß in dem Menschen die künstlerische Seele abstirbt, wenn ihr nicht zum Leben verholfen wird? Einige Fortschrittler glauben jetzt, den Sinn für die Musik vertiefen zu können, indem sie auf die rhythmische körperliche Bildung größere Sorgfalt verwenden. Überkluge legen sogar den Inhalt der Musik schrittweise aus, sie tanzen denselben. So werden all die intimen Gefühlsregungen einer Mazurka von Chopin, die zarten Poesien eines Schumannschen Phantasiestückes dem Zuhörer durch elegante, süß sinnliche Körperbewegungen einer schönen Tänzerin vermittelt.
In einer Blütezeit der Technik, einer Periode der Veräußerlichung aller Lebenserscheinungen darf das Mechanische in der Kunst nicht noch gefördert werden. Die künstlerische Technik ist sowieso weit genug vorgeschritten. Für ihre fernere Entwicklung soll niemand in Sorge sein. Die Orchestrierungskunst hat in der jüngsten Zeit glänzende Fortschritte gemacht, die Gelenkigkeit so mancher Pianisten, die Fingerfertigkeit von Geigern muß offen und ehrlich anerkannt werden.
Uns fehlt etwas ganz anderes. Nicht an äußerlicher, an innerlicher Bildung vielmehr stehen wir zurück. Die Fähig[44]keit des Innenlebens, alle leisen Schwebungen, welche sich nahen, empfindsam aufzufassen, die mangelt uns. Dazu bedarf es, so möchte man sagen, einer Seelengymnastik. Alle Empfindungen gesund und kräftig zu machen, das kindliche Gemüt empfänglich für das Schöne, Wahre und Sittliche in der Kunst zu formen, das ist wünschenswert.
Die schwere Aufgabe einer Umgestaltung des musikalischen und des allgemeinen Unterrichts wird den in der Öffentlichkeit unbeachteten Leuten, den ernsten, fortschrittlich gesinnten Männern, deren Herz noch nicht erkaltet ist, zufallen. Aber was können sie schließlich auf dem künstlerischen Gebiete Gutes mitteilen, wenn die großen Herren, die Komponisten, die Virtuosen, die Kapellmeister selbst nichts Gutes tun? In wie viel Fällen vermag man den Kindern zu sagen: »Seht! der große Künstler, welcher in unserer Stadt lebt und uns so häufig die Meisterwerke der Tonkunst vermittelt, ist durch seine Kunst auch ein edler Mensch geworden. Nehmt ihn Euch zum Muster«! Hoffen wir, daß die schlechte Zeit einer vollständigen Verwirrung und Verwilderung der künstlerischen, moralischen Anschauungen bald vorübergehen und einer reineren, idealeren Platz machen wird. Die vermaledeite Idee der Gottähnlichkeit, welche manchen Künstlern im Kopfe steckt und ihnen das vermeintliche Recht gibt, zu tun, was sie wollen, muß einer besseren Einsicht weichen. Und zwar hat das Bewußtsein sich zu verstärken, daß ein Jünger der Kunst mit der Hingabe an diese heilige Macht auch Pflichten übernimmt, daß er gelobt, sein weißes Opferkleid rein zu erhalten. Im Kampf mit all den schweren Versuchungen, welche sich ihm in der künstlerischen Laufbahn nahen, muß er leichten Herzens Sieger bleiben.
Dann wird er in seiner letzten Stunde nicht das Gefühl haben, daß nur noch sein Körper stirbt, da die Seele schon längst erstarrt ist. Er wird vielmehr in freudiger Zuversicht [45] der Gottheit das köstliche, ihm anvertraute Gut, seine Seele, empfehlen und glückstrahlend bekennen, wie herrlich und rein sie sich im Lichte seiner geliebten Kunst gestaltet hat.
Seele werde rein!
Während noch im Leibe du weilst,
Löse dich von Erdenschwere!
Deiner finsteren Stätte
Wechselvolles Los
Laste nicht auf deinem Flügel!
(W. Eigenbrodt)
Stephan Krehl, „Musikerelend“, Teil II

Stephan Krehl (1864–1924)
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephanKrehl.jpg
Im Jahre 1912 erschien das Buch »Musikerelend« des Komponisten und Musiktheoretikers Stephan Krehl (1864–1924). Krehl, seit 1902 am Leipziger Konservatorium tätig und von 1907 bis zu seinem Tod Leiter der Institution, stellte dort laut Untertitel »Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf« an. Sie sind polemisch formuliert und geben unmittelbare, heute teils kurios anmutende Einblicke in seine Sicht des Musiklebens, insbesondere mit Blick auf die soziale Stellung der Musiker_innen, in einer Zeit des Umbruchs.
Stephan Krehl (1864–1924):
Musikerelend
Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf
[Teil II]
Leipzig: C. F. W. Siegel [1912].
[6] 1. Täuschungen und Enttäuschungen.
Das Leben eines Künstlers kann reich an Freuden sein, bitter ist es aber sicher auch in seinen Enttäuschungen. Wer schildert uns die schweren Stunden, die trüben Tage, die ein armer Musikant in Ängsten zu durchleben hat? Wer vermag ein Bild von all dem Jammer, all dem Elend zu geben, aus dem so mancher Virtuose, so mancher Komponist sich nicht zu befreien weiß? Es werden nur wenige Auserwählte – und vielleicht nicht einmal die geistig am höchsten stehenden – sein, die sich Kinder des Glückes nennen dürfen, deren Dasein in sonnigen, heiteren Tagen verläuft. Die große Menge bekennt bald in stiller Verzweiflung, bald in lautem Jammer, daß sie um alle Hoffnungen betrogen ist, daß sie mutlos in dem Kampf um die Herrschaft die Waffen streckt und nicht mehr hofft, zu lichteren, reineren Höhen emporzusteigen. Freimütige gestehen sogar ganz offen, daß sie sich nimmer wieder, wenn ihnen die Wahl des Berufes noch einmal freistünde, der Musik zuwenden würden.
Wer trägt da die Schuld? Wodurch ist diese Verzweiflung zu verstehen? Die Beschäftigung mit der Kunst müßte doch allen eine Erbauung gewähren, eine Erlösung von irdischer Nichtigkeit zusichern.
Wie kommt es, daß statt Befriedigung Unfrieden erweckt wird, daß die treue Hingabe an die Kunst den verdienten Lohn scheinbar nicht findet? Verantwortlich dafür sind die falschen Priester zu machen, die in dem Tempel der Kunst ihr Unwesen treiben. Sie sind es, die durch unlautere Mittel alle Macht an sich zu reißen suchen und die Gläubigen, welche sich unschuldsvoll nahen, absichtlich betören. Sie sind es aber auch, die sich unter ihren Standesgenossen als die Herren auf[7]zuspielen wissen und, dank der Schwäche und Indolenz der Mitmenschen, die Zügel, welche sie ergriffen haben, nicht aus der Hand geben.
Ein Lichtblick fällt allerdings in jedes Musikantenleben. Es gibt eine glückliche, eine selige Zeit: die Studienzeit! Doch da entspringt nur zu häufig das Glück nicht aus der Beschäftigung mit der Kunst. Die Pflege des lieben Ich gewährt ungeahnte Freuden. Mag der Kunstnovize auch nicht mit Glücksgütern gesegnet sein, er erträgt doch gern alles Ungemach, das sich ihm bereitet, er erduldet alle Pein, die über ihn verhängt ist, weil er das Bewußtsein hat, daß er dereinst zu den Großen gehören wird. Er schmeichelt sich, in hervorragendem Maße begabt zu sein, er ahnt in sich Kräfte, welche in ganz ungewohnter Weise zur Entfaltung kommen werden. Ja, wenn man sich vom Größenwahn nähren könnte, dann würde viel Hunger gestillt. Der Laie hat keine Vorstellung, bis zu welchem Grade so viele junge Künstler eingebildet sind. Eine junge Pianistin, ein Geigenvirtuos, welche ein paar Bravourstücke gelernt haben, die meinen, von ihrem Auftreten ab müsse eine neue Ära der Technik datieren. Alte bewährte Größen sind nun, wenn der Neuling kommt, verurteilt, von ihrer Höhe herunterzusteigen, um Platz zu machen. Der junge Komponist wird Neuland erobern. Die Partituren werden eine fabelhafte Größe erhalten, Instrumente, von denen die Welt bisher keine Ahnung hatte, werden erklingen. Das Orchester wird Schilderungen bringen, deren Wirkungen man sich nicht erträumen kann. Was gewesen ist, verdient Mitleid; nun erst beginnt der Aufschwung, die Blütezeit der bislang bedauernswerten Kunst.
Der Größenwahn, wie er die jungen Leute beherrscht, ist etwas Herrliches, weil er blind gegen alles Feindliche macht. Der Größenwahn ist etwas Unerquickliches, ja etwas Unerträgliches, weil der davon Befallene unausstehlich für die Mitmenschen wird. Der Größenwahn ist schließlich aber auch [8] etwas sehr Schädliches, etwas Niederschmetterndes, weil der Mensch durch ihn krank für die Zukunft wird.
Nicht eben leicht ist es, einem Kinde die Illusionen zu nehmen. Oft hält man es sogar nicht für richtig, die Wahrheit zu sagen, wenn die Wirklichkeit scheinbar prosaischer als das poetische Phantasiegebilde ist. Das Leben zwingt den Menschen im Laufe der Zeit von selbst, richtig zu sehen. Die künstlich konstruierte Hülle fällt von allen Gebilden. Und schließlich erweist sich die nackte Wirklichkeit gar nicht als so häßlich. Sie scheint nur denen beschmutzt, die sie mit trüben Augen ansehen.
In jedem Berufe setzt es bei Enthüllungen kleine Enttäuschungen ab. Dieselben sind oft ganz heilsam. Nach einer Niedergeschlagenheit kommt ein neuer Aufstieg. Wer eine Zeitlang geduckt gewesen ist, reckt sich nun umsomehr in die Höhe. Furchtsame, welche sich vor einem schreckhaften Wahngebilde verkrochen hatten, bekommen wieder Mut und ziehen fröhlich in den Kampf.
Bedenklich ist es freilich, wenn die Enttäuschungen infolge gewissenloser Täuschungen chronisch werden. Und leider läßt es sich nicht ableugnen, daß jetzt in der Musik nur zu viel mit Täuschungen allein gearbeitet wird. Äußerlich sieht eine Sache so glänzend, so vornehm aus, und innerlich ist sie doch so nichtig, so gemein. Da ist nun wirklich Sorge zu tragen, daß schon in der Künstlerkindheit die Illusionen zerstört werden, selbst wenn die Enttäuschungen bitter sind. Wird nicht von Anfang an die Wahrheit aufgedeckt, so kann Gefahr für die ganze Existenz vorliegen. Der Hochmut, die lästerliche Einbildung, sie verblenden den Kunsteleven derart, daß er sich durch unsaubere Geldmanöver der jetzigen Zeit vom rechten Wege abbringen läßt. Er gerät in seinem Irrwahn in Gestrüpp, aus dem er sich nicht wieder herausfindet. Er verkommt und verflucht nur zu spät die Idee seiner anfänglichen Gottähnlichkeit.
[9] Könnte man doch einmal das Getriebe in der Kunst durchleuchten. Was für ein Lügengewebe würde sich zeigen! Wie wenig Offenheit, wie wenig Ehrlichkeit, wie viel Bestechlichkeit, wie große Unsittlichkeit würde hervortreten! Aber in der Musik hütet sich ein jeder, irgend einen Mißstand, den er feststellen kann, aufzudecken. Man hat immer Angst, angefeindet zu werden und dadurch Schaden zu erleiden. Außerdem besteht eine große Furcht vor der Presse, deren Stimmung sich nicht voraussagen läßt.
Der Musikausübende findet ja auch nirgends Schutz. Ihm kann in seinem Beruf geschehen, was will, niemand kümmert sich darum; er ist so gut wie vogelfrei. Wo man hinsieht in Handel und Gewerbe, allüberall wacht eine staatliche, eine städtische Behörde, damit nichts Unrechtes geschieht. Mit Strenge werden allerorten die Kurpfuscher verfolgt. Nur in der Musik läßt man alle Pfuscher, alle Charlatane sich ungestört betätigen. Für die Musik wirft der Staat im wesentlichen keine Mittel aus. Für die bildenden Künste wird viel getan. Nicht nur Schulen werden in großer Zahl unterhalten oder unterstützt; jährlich werden zahlreiche Werke der Malerei, der Plastik aus Staatsmitteln angekauft. Den Musikern nimmt niemand etwas ab, die mögen allein sehen, wie sie fertig werden. Die sollen sich nur gegenseitig die Haare ausraufen. Schadet nichts, wenn etwas von ihrer Künstlermähne ausgeht. Dann werden sie vielleicht gesitteter aussehen und sich gesitteter benehmen. Das mag wohl die Idee bei manchem äußerlich hochstehenden Herrn sein, wenn er nach dem Grundsatz handelt: Die Sippe läßt man aus dem Spiel. Die verschreibt man sich, wenn eine langweilige Gesellschaft einmal unterhalten werden soll oder wenn die Jugend tanzen will. Dann lohnt man sie mit etwas Geringem ab oder stellt ihr zur Stärkung eine Flasche Bier unter den Stuhl. Diese Art Leute läßt man sich aber nicht nahe kommen. Man behandelt und bezahlt sie wie die [10] Dienstleute. Die Musikanten sind eben in den Augen vieler sogenannter vornehmen Leute Menschen, denen man nicht viel Ehre erweist.
Viele der Musiker möchten nun gar zu gern ihren Stand heben. Sie legen Wert darauf, unsaubere Elemente zu entfernen. Von größter Bedeutung dafür würde sein, daß jeder Zunftgenosse einen Befähigungsnachweis zu erbringen hat. Die Musiker bitten darum, sie flehen darum, daß man ihnen erlaubt, offiziell eine Prüfung einzuführen. Der Staat verspricht auch die Angelegenheit in wohlwollende Erwägung zu ziehen. Nur wird die Herzenskammer, in welcher die Erwägung stattfindet, streng verschlossen. Alle Welt weiß aber, daß in jener Herzenskammer das Wohlwollen verborgen ist. Und das ist doch immer ein erhebendes Gefühl.
Sicherlich sehnt sich niemand nach behördlicher Bevormundung, nach Belästigungen, nach Unbequemlichkeiten. Ein jeder aber will geordnete Zustände haben, Befreiung von Charlatanerie, die ihn und den ganzen Stand schädigt, sehen.
In der Musik liegen jetzt die Verhältnisse auf allen Gebieten trostlos. Man weiß wirklich nicht, wo man mit der Schilderung des Notzustandes beginnen soll. Jammer bei den Virtuosen, Depression bei den Komponisten, Unglück bei den Musiklehrern – kein Zweig, welcher nicht verdorrt wäre. Das große Publikum kommt am meisten mit den Musiklehrern in Berührung. Von diesen werden in erster Linie die Verbindungsfäden zwischen dem Laien und der Kunst gesponnen. Auf sie werden große Hoffnungen gesetzt, von ihnen gehen aber eventuell auch die ersten Enttäuschungen aus, sie inszenieren die Täuschungen.
Angebot und Nachfrage für den Elementarunterricht sind allenthalben ganz enorm groß. Nur zu natürlich ist es, daß Preise, die als durchaus unwürdig, ja unmöglich zu bezeichnen sind, gezahlt werden. Meist wird auf den Anfangsunterricht viel zu wenig Wert gelegt. Wie falsch ist es doch, beim [11] Unterricht in den Anfangsgründen sparen zu wollen. An sich ist es ja wohl nicht gesagt, daß eine Stunde zu 3 Mark besser ist als eine solche zu 30 Pfennig. Doch bedenke man, daß gerade der Elementarlehrer, um richtig eingreifen, verständig anleiten zu können, eine Persönlichkeit mit Kenntnissen und Erfahrung sein muß, daß zur erfolgreichen Tätigkeit aber nicht nur musikalische Kenntnisse, sondern Menschenkenntnisse gehören. Eine Persönlichkeit, welche hingebungsvoll den Elementarunterricht betreibt, die muß sich selbst durchgearbeitet haben. Und das Durcharbeiten kostet Opfer, verschlingt Geld. Da ist es nur mehr wie billig, daß die Stunden geziemend honoriert werden.
Wie viele Unwürdige sind unter der Unmenge von Leuten, die sich öffentlich oder im geheimen als Erzieher zur Musik anbieten. Gleichgültig, ob es sich um das erste Stadium oder höhere Stufen der Ausbildung handelt, überall versuchen Aventuriers von den herrschenden Zuständen zu profitieren. Unangenehm sind die stillen Schleicher, welche in den Familien herum ziehen, in den Pensionaten spionieren, an Privatmittagstischen sitzen, immer in dem Bestreben, sich durch Mittel jeder Art Schüler zu kapern. Widerwärtig sind aber auch die Prahler, welche durch verblüffende Annoncen, Reklamemittel zweifelhafter Sorte sich Opfer fangen. Das Publikum fällt auf die leisen Lockungen der Einen, wie auf die lauten Anpreisungen der Anderen ebenso herein. Den Schaden haben die Schüler und die anständigen Lehrer. Es ist jetzt wirklich so, daß ein rechtlich denkender, gebildeter Musiker, welcher einfach sagt, er erteile Musikunterricht, die Stunde zu 3 Mark, warten und warten kann, ehe sich Jemand bei ihm meldet, während ein Schwindler, welcher verspricht, für 20 Mark pro Stunde die geheimnisvolle Kraft der Fakire zur kürzesten Beherrschung der schönen Künste zu enthüllen, ungeahnten Zulauf hat. Versteht der Letztere seiner Schwindelmethode noch einen religiös-[12]philosophisch-ästhetisch-sexuellen Beigeschmack zu geben, so ist er für einige Zeit ein gemachter Mann. Der Inszenierung einer privaten Tätigkeit wird ja nirgends auch nur die geringste Schwierigkeit bereitet.
Kommt da in eine Stadt ein Mann, der dank seines Spekulationsgeistes guten Boden für sich wittert. Er läßt sich als Lehrer für Klavier, Theorie, Ästhetik und Kunstgesang nieder. Man hat nie gehört, daß er als Spieler hervorgetreten ist, daß er durch praktische Übung in den Formen Erfahrungen gesammelt hat, daß er durch Veröffentlichungen seine Kenntnisse dargetan; man kann auch nicht in Erfahrung bringen, wo der Mensch sich im Gesang betätigt hat, welche Schule er vertritt. Doch das will ja nicht viel sagen. Bekanntermaßen hat jeder Gesangslehrer seine eigene Methode und der Schüler, der bei einem Meister eintritt, muß seine bisherige, nun als falsch erkannte Manier verlernen und der neuen, alleinseligmachenden sich zuwenden. Unser Theorie- und Gesangsmeister, welcher sich ebensogut Inhaber des »Pour le merite für Kunst und Wissenschaft« nennen könnte, denn diesen Orden besitzt er ebensowenig wie die Meisterschaft in der Gesangskunst, der erhascht sich nun sein Publikum durch Inserate. Er schildert in Veröffentlichungen, was man bei seinem einzigartigen Unterricht erreichen kann. Da wird versprochen, daß Spieler (solange sie nur ihre normalen zehn Finger haben) glänzende Techniker werden, daß verbildete Stimmen vollständig in Ordnung kommen, daß Bühnenkünstler ungeahnte Einblicke in ihre Rollen erhalten, aus den theoretischen Belehrungen die Geheimnisse der Musikdramen aufdecken können. Nach kurzem Studium ist ihnen Bühnenpraxis und – dank der reichen Konnexionen des Meisters mit zahlreichen Bühnenleitern – ein Engagement sicher. Nun meldet sich bei dem großen Lehrmeister eine Gesangsschülerin. Dieselbe wird, da der Gewaltige momentan überlastet ist, auf einen anderen Tag zur Sprechstunde bestellt. [13] Im Wartezimmer sind dann einige Stammgäste versammelt, welche den schüchternen Neuling ermutigen und für den Meister begeistern. Bei der eigentlichen Prüfung behauptet derselbe, die Schülerin habe Talent, doch sei die Stimme verbildet. Der Fehler werde ohne Zweifel in absehbarer Zeit beseitigt sein. Leise entringt sich aus dem Munde der Aufnahmesuchenden das Geständnis, daß sie nicht bemittelt sei und nur wenig zahlen könne. Doch da ist der Meister edel; er erklärt sich bereit, einstweilen gratis Unterricht zu erteilen. Das sieht sehr vornehm und uneigennützig aus. Die Schülerin muß sich nur schriftlich verpflichten, die Schuld abzutragen, sobald ein lohnendes Bühnenengagement gefunden ist.
Soweit ist alles gut gegangen. Nun aber kommt das Unglück. Der Unterricht ist so mangelhaft, daß nichts dabei zu lernen ist. Die Schülerin empfindet das nicht, da sie natürliche Gesangsbegabung genug besitzt, um sich nicht ganz zu verderben. Von eigentlichem Kunstgesang aber lernt sie nichts. Auch mit dem lohnenenden [sic] Engagement nach der Studienzeit hat es große Schwierigkeiten. Schließlich muß sie, nur um unterzukommen, für ein Sündengeld eine Stelle annehmen. Von dem minimalen Gehalt soll noch die Garderobe bestritten werden. Der Agent, welcher immerhin bessere Beziehungen als der Gesangsmeister hatte und die Anstellung vermittelte, beansprucht gleichfalls eine Ablohnung. Und schließlich kommt die beträchtliche Summe dazu, welche dem Lehrer abzuzahlen ist!
Die arme Kleine hat aber noch Glück gehabt, da sie dank ihrer natürlichen stimmlichen Begabung keinen Schaden an ihrer Stimme erlitt. Einer Anderen, die denselben Unterricht genoß und ehrlich dafür zahlte, ist die Stimme nicht korrigiert sondern demoliert worden. Der Schaden ist nicht wieder gut zu machen. Und wenn auch in einem solchen Fall des Stimmruins eine gerichtliche Klage gegen den Zerstörer mit Erfolg durch[14]geführt wird, so ist doch die Entschädigungssumme kein Ersatz für das, was verloren ging.
Das Unglück wird noch dadurch größer, daß sich die allgemeine musikalische Ausbildung, welche der Gesangsmeister versprochen hatte, als ganz ungenügend erweist, weil der große Mann selbst ungebildet ist. Auch hütet er sich, sei es nur in einem Fach, einen Schüler anderen Lehrern zu übergeben. Er hat Angst, die Macht über den Schüler zu verlieren; er fürchtet, daß sein Schwindel aufgedeckt wird.
Was sind das für Täuschungen! Was gibt es da für Enttäuschungen! Da werden über den Menschen Depressionen kommen, von denen er sich nicht mehr erhebt. Jeder Glaube an die Reinheit der Kunst, an die erlösende Macht der Musik wird vollständig zerstört. Nur gar zu erklärlich ist es, daß nach den Enttäuschungen bei pekuniärem Elend jeder sittliche Halt verloren geht.
Wie häufig hört man, daß Schüler durch falsche Vorspiegelungen, durch Unfähigkeit ihrer Lehrer betrogen worden sind. Niemand tut etwas dagegen. Die trostlosen Zustände werden allenthalben geduldet. Hat ein Charlatan an einem Ort abgewirtschaftet, so zieht er nach einem andern. Sind die kleinen Städte abgegrast, dann geht man in die großen. Da gibt es mehr Dumme, welche auf Reklame hereinfallen, da läßt sich besser im Trüben fischen.
Am wenigsten Ungemach erfahren vielleicht noch die jungen Leute, welche im Orchester tätig sein wollen. Sie erleben nicht so leicht Enttäuschungen, weil sie geringere Ansprüche machen und zunächst auf öffentliches Auftreten nicht reflektieren. Gewiß, ein Konzertmeister, ein Cellist, ein Flötist will auch als Virtuos tätig sein; er arbeitet doch aber zunächst für seine feste Anstellung, durch welche er sein Einkommen, an welcher er seinen Halt hat. Trübe Erfahrungen machen da Viele beim sogenannten Probespiel. Irgend eine Stelle wird ausgeschrieben. [15] Um dieselbe bewirbt sich nun eine Unzahl von Musikern. Zum Probespiel wird dann nur ein Teil derselben ausgewählt und aufgefordert. Da muß es sich nun recht treffen, daß beim Vortrag eines selbstgewählten Stückes der Spieler gut aufgelegt ist, daß er das Kammermusikstück, dessen Vortrag ihm zufällt, zufällig kennt, daß er irgend einer vorgelegten Passage nicht fremd gegenüber steht. Die allgemeine musikalische Bildung, sonstige künstlerische und vor allem die menschlichen Vorzüge werden nicht beachtet. Das ganze Probespiel ist eine reine Glückssache.
Wäre es wohl das Richtige bei der Besetzung der Chirurgenstelle an einem Krankenhaus probeweise die Bewerber operieren zu lassen und demjenigen, der das meiste Glück hat, den Preis zuzuerkennen? Wie viel Mittelmäßigkeit könnte dabei unverdientermaßen an hervorragende Stelle kommen. Auch in der Musik wäre es besser, das unsichere Probespiel bei Seite zu tun und das System der Berufung einzuführen.
Sowie der Instrumentalist den Ehrgeiz hat, öffentlich als Solist aufzutreten, dann muß er sich freilich für all die Kämpfe, welche jedes öffentliche Auftreten mit sich bringt, wappnen. Um allen Unbilden trotzen zu können, muß er sich eine dicke Haut anschaffen.
Im allgemeinen ist man der Meinung, daß ein Solist, der in einem Orchesterkonzert mitwirkt, bestens bezahlt wird, daß ein Pianist, der in einer Kammermusikveranstaltung mit tätig ist, Schätze heimträgt. Ohne Zweifel ist eine Anzahl von Unternehmungen, welche gut bezahlen, vorhanden, und ebenso sind Künstler, welche sich gut bezahlen lassen, zur Stelle. Um große Honorare beanspruchen zu können, muß man zunächst einen Namen haben. Den erwirbt man sich aber nicht nur dank einer besonderen Begabung, dank einem immensen Können, den erkauft man sich einfach. Mit Geld macht man Reklame und mit Reklame macht man Geld. Leute, welche [16] die Mittel dafür verausgaben wollen, unterhalten, wie man es nennt, ein Preßbureau. Durch dieses nützliche Institut werden die zur Berühmtheit notwendigen Mitteilungen an das Publikum vermittelt. Von ihm werden die Bilder an die illustrierten Blätter versendet: »Herr X. X. am Arbeitstisch«, »Herr X. X. in seiner Sommervilla«, »Herr X. X. auf dem Wege zum Konzert« usw. Wenn eine gewisse Berühmtheit schon erlangt ist, dann genügen zur Orientierung einfache Zeitungsnotizen. Nur muß Sorge getragen werden, daß ohne Unterbrechung das Interesse wach erhalten wird.
In einer Zeitung ist zu lesen:
»Wie wir hören, befindet sich der Pianist X. X. auf einer Tournee in Norwegen. Er soll dort durch sein Chopinspiel berechtigtes Aufsehen erregen«.
Fünf Tage später:
»Aus Ungarn kommt die Nachricht, daß der bedeutende Pianist X. X. ein schweres Unglück gehabt hat. Bei der Fahrt zu einem Konzert stieß das Automobil so heftig gegen einen Prellstein, daß der Künstler herausgeschleudert wurde und eine leichte Gehirnerschütterung erlitt«.
Zwei Tage später:
»Das Unglück des unvergleichlichen Pianisten X. X. erweist sich zur allgemeinen Freude als nicht so schlimm wie geschildert. Der große Künstler hat nur einige Hautabschürfungen davon getragen. Von einer Gehirnerschütterung kann keine Rede sein«.
Fünf Tage später:
»Der Impresario des Klaviertitanen X. X. teilt uns mit, daß bei der Nachricht von dem Automobilunglück, welches der gottbegnadete Künstler gehabt haben sollte, wohl eine Verwechselung vorliegen müsse. Schon vor etwa 12 Tagen konnten wir unseren Lesern die erfreuliche Mitteilung machen, daß Herr X. X. Triumphe in Norwegen feiert. Er befindet [17] sich zur Zeit noch in der Hauptstadt Norwegens in Stockholm und gedenkt auch erst Ende des Monats von dort zurückzukehren. Die Unglücksbotschaft aus Ungarn muß also wohl auf einem Irrtum beruhen«.
Am nächsten Tage:
»Selbstverständlich muß es in unseren gestrigen Bericht über den Klavierkönig X. X. Christiania statt Stockholm heißen«.
Drei Tage später:
»Um mehreren an uns gerichteten Anfragen zu genügen, möchten wir mitteilen, daß jetzt offiziell Kristiania und nicht Christiania geschrieben wird. Der erste Pianist der Jetztzeit X. X. begeistert, wie verlautet, andauernd das dortige Publikum durch sein eminentes Spiel«.
Acht Tage später:
»Unsere Leser werden sich entsinnen, daß vor einiger Zeit von dem Unfall des Klavierpoeten X. X. berichtet wurde. Der Unfall wurde dann in seiner Bedeutung abgeschwächt und schließlich ganz widerrufen. Uns sah, offen gesagt, von Anfang an die Sache etwas nach Reklame aus und war uns daher auch unsympathisch. Jetzt schreibt uns ein intimer Freund des Virtuosen, daß Letzterer über die Zeitungsnotizen sehr aufgebracht sei, da er alle Reklame hasse und diese unkünstlerischen Beeinflussungen des Publikums für eine Roheit erkläre«.
Der Brief an den intimen Freund soll aber wie folgt gelautet haben: »Sehr geehrter Herr, es ist mir schließlich hier in Norwegen besser gegangen, als ich ahnen und hoffen konnte. Die ersten Konzerte haben ein böses Geld gekostet, ebenso die unentbehrliche Reklame. Mein Konterfei hing in jedem Gemüseladen, in jeder elektrischen Bahn, an jeder Straßenecke. Wohin ich nur blickte: mein Porträt. Das hat aber genützt! Zum Schluß kamen sie alle gelaufen, um den neuen Chopin, wie auf den Plakaten stand, zu hören. Sie kamen, zahlten und applaudierten! Nun schlachten Sie gefälligst den Erfolg [18] aus. Machen Sie Reklame, bringen Sie Notizen auf Notizen. Lassen Sie sich die Sache etwas kosten; das kommt schon wieder heraus. In den Notizen bitte ich immer zu betonen: Spezialität im Chopinspiel. Das wirkt, das zieht! Mit bester Empfehlung Ihr reklamehungriger X. X.«
Die kleinen Zeitungsnotizen sind gewissermaßen das Öl, um die Karre ohne Quietschen im Laufen zu erhalten. Zum eigentlichen Antrieb bedarf es stärkerer Mittel. Da erfindet man rührende Geschichten, um der Anteilnahme der großen Menge sicher zu sein. Mit Bestimmtheit läßt sich darauf rechnen, daß durch eine Erzählung von überstandenem Jammer und Elend für einen Künstler allgemeines Mitgefühl erweckt wird. Es wird ein rührendes Märchen gedichtet, in dem der zu befördernde Künstler die Hauptrolle spielt. Von aller Unterstützung, aller Hülfe verlassen, kommt der Ärmste der Verzweiflung nahe. Nun wird geschildert, wie seine Kräfte abnehmen, wie er nichts mehr hat, um sich zu nähren, wie sein einziges Kind in Elend verkommt, wie seine Frau halb vor Kummer, halb vor Hunger stirbt. In dem Augenblick, wo auch des Mannes Ende gekommen scheint, tritt der Retter auf.
Ein mildtätiger Arzt nimmt sich des Verzweifelten an. Durch Mittel und sorgsame Pflege gelingt es, den Künstler körperlich und geistig wieder zu kräftigen. Dem hülfsbereiten Arzt glückt es, seine Freunde für den Musiker, von dessen eminenter Begabung er sich überzeugt hat, zu interessieren. Ein Wohltätigkeitskonzert, in welchem der Neuerstandene zum Besten seiner selbst spielt, wird veranstaltet. Das Publikum, welches zusammengetrommelt worden war, begeistert sich gerührt. Der Erfolg ist groß und mit einem Schlag ist dann dem Ärmsten geholfen. Da Nervenkrisen jedoch immer noch zu befürchten sind, muß stets ein Arzt im Künstlerzimmer bereit sein.
Das wirkt, das macht Eindruck! Die große Menge läuft doch immer dahin, wo es etwas Sensationelles zu sehen gibt. [19] Ein Pianist welcher beinahe verhungert ist, wie muß der dünn aussehen! Wo hat der Hungerkünstler noch die Kraft hergenommen, technische Übungen anzustellen? Natürlich hat der Arme kein Geld gehabt, um sich frisieren zu lassen. Daher wird er doppelt wild aussehen. Und im Künstlerzimmer stets ein Arzt parat. Oh, wie ist das interessant!
In der Musik geht es eben wie im gewöhnlichen Leben. Das Einfache, Natürliche genügt nicht mehr. Soll jetzt zu irgend einem Zwecke Geld gesammelt werden, und man bittet zehn Familien einfach durch Liste um Beiträge, so kann man darauf wetten, siebenmal einen Refus zu erhalten. Wird aber zu demselben Zweck ein Gartenfest mit Blumenverkauf, Tee, Tanz usw. veranstaltet, so ist man der allgemeinen Beteiligung und Zahlung sicher. Die Töchter der einen Familie wollen ihre neuen Kostüme vorführen, die Mutter einer anderen Partei hat die verlockende Aussicht, mit Exzellenz so und so in einer Bude zu verkaufen, der Vater einer andern Familie wieder kommt auf diese Weise mit dem reichen Bankier X., dessen Bekanntschaft er längst ersehnte, in Berührung. Und so findet jetzt jeder einen Grund, recht wohltätig zu sein.
Um den Klaviervortrag einer unbekannten Spielerin zu hören, kommt kein Mensch in ein Konzert. Wie anders sieht die Sache aber aus, wenn man gehört hat, daß das arme Mädchen als Kind von Zigeunern geraubt wurde, daß, nach jahrelangen Irrfahrten, eine reiche alte Dame durch Zufall das eminente Talent der Künstlerin entdeckte und die Protektion übernahm, die Ausbildung zahlte und nun das erste Auftreten leitet. Wie ist da mit einem Male das Interesse wach, wie empfindet man Mitleid mit dem aus dem Elternhaus geraubten armen Wesen, wie bewundert man nun erst die Kunst der vom Schicksal so hart Geprüften und doch wieder so Begünstigten.
Wer hoffnungslos für eine gerechte Sache gegen eine Übermacht ringt, der kann der allgemeinen Teilnahme sicher sein. [20] Ein Komponist, von dem bekannt wird, daß er im Kampf gegen Konzertinstitute, Bühnenleiter und Verleger, die einen Ring gebildet haben, um ihn nicht aufkommen zu lassen, fast umgekommen ist, der wird durch ausführliche Schilderung seines Elends viel Stimmung für sich machen.
Daß Preßbureau muß nur seine Sache gut verstehen, ohne Unterlaß Geschichten, Märchen, Anekdoten lancieren, so kann ein Erfolg garnicht ausbleiben. Aber natürlich, das kostet Geld, viel Geld, und man wundert sich nicht, zu hören, daß einzelne Künstler Tausende, Zehntausende in einem Jahr geopfert haben, um sich einzuführen.
Wer sich der Kunst zuwendet, sollte eigentlich einen Kursus im Geschäftsbetrieb durchmachen. Da wäre zu zeigen, wie man vorwärts kommt, ohne begabt zu sein, wie man sich einen Namen verschafft, auch wenn man nur Alltägliches leistet. Belehrungen müssen freilich auch über den Umfang der Reklame, die Häufigkeit des Annoncierens, die Menge der aufzuwendenden Mittel usw. gegeben werden.
In der Kunst ist wie in der Geschäftswelt eine einmalige Reklame vollständig zwecklos. Jammerschade ist es für das Geld, welches eventuell schweren Herzens dabei geopfert wird. Immer und immer wieder setzen Leute ihre ganze Hoffnung auf ein einmaliges öffentliches Auftreten. Für dieses Vergnügen opfern sie 400 oder 500 Mark. Es wird gespart und gespart um die Möglichkeit eines Debuts zu schaffen. Und was ist das Resultat? Die Kritik ist mißvergnügt und schimpft, Einnahmen werden nicht gemacht, da Niemand für einen unbekannten Musikanten etwas zahlen will. Der Konzertunternehmer verdient allein, er muß bezahlt werden. Dafür zeigt er sich aber auch erkenntlich; er füllt, obwohl er keine Billette verkauft hat, als kleiner Zauberkünstler den Saal, sodaß derselbe wenigstens nicht gähnend leer aussieht.
Bei der großen Menge von Konzerten werden Freikarten [21] in Unmassen ausgeteilt. Personen, welche weder für Musik noch für die auftretenden Künstler Interesse haben, werden mit Billetts beschenkt. Kein Wunder, wenn Viele in die Konzerte gehen, nur um die Zeit totzuschlagen. Amüsanter könnte das in der Operette oder im Variete geschehen. Da aber kostet es Eintritt, während die Karten für die Konzerte frei in das Haus fliegen. Wer doch in einem Konzert Gedanken lesen könnte! Was würde der für unpassende und unmusikalische Ideen entdecken. Doch schon dem aufmerksamen Beobachter zeigt sich so viel Sonderbares, daß er aus dem Staunen nicht heraus kommt. Bald erblickt man lebhafte Damen, welche im ersten Teil des Konzertes nur an die Beendigung ihrer Toilette denken. Bald sind vergnügte Pärchen zu sehen, die während langer Klavierstücke sich witzige Bemerkungen zuflüstern und Pläne schmieden, wie am nächsten Tag für Amüsement zu sorgen ist. Schwermütige Menschen sieht man zunächst unzählige Male das Programmbuch durchlesen, bis sie schließlich verzweifelt die Hände falten und philosophisch ins Weite starren. Die Musik, welche allen diesen Hörern vorgeführt wird, dringt nicht zu ihnen ein. Im Gegenteil, sie läuft an ihnen wie der Regen an einem Gummimantel ab. Vollständig gleichgültig ist es, ob ein Werk von Beethoven, von Mendelssohn oder von Rheinberger gespielt wird, ob eine Sonate, eine Phantasie oder eine Fuge zum Vortrag gelangt. Für nichts ist wirkliches Interesse, wirkliches Verständnis vorhanden.
Wie kann das einem Musiker Befriedigung gewähren, vor Leuten zu spielen, welche vollständig unmusikalisch sind. Die Zahl des eigentlichen kunstverständigen Konzertpublikums ist selbst in großen Städten – das beachtet man viel zu wenig – eine ganz geringe. Und von den Leuten, die etwas von Musik verstehen, gehen die meisten auch nur gewohnheitsmäßig in eine besondere Art von Konzerten. Die Mode spielt eben auch hier eine große Rolle. Da gibt es meistens eine be[22]stimmte Sorte von Symphoniekonzerten, in denen jeder abonniert sein muß; dann wieder existieren Säle, die nicht besucht werden, weil sie nicht vornehm sind. Ein Mensch von Rang hat, wenn er ein Konzert besuchen will, so unendlich viel Äußerlichkeiten zu beachten, daß die Hauptsache, das Künstlerische, so gut wie ganz dabei verschwindet. Wird ihm unvermutet ein Freibillett zugesendet, so kommt er garnicht auf die Idee, das Konzert zu besuchen, wenn die Veranstaltung nicht einen fashionablen Charakter hat. Er verschenkt das Billett weiter, übergibt es vielleicht der Gouvernante seiner Kinder zur Benutzung. Die hat nun eventuell einiges Interesse für Musik. Jedoch fehlt ihr jegliche Beziehung zum konzertierenden Künstler, dessen Namen sie meist nur auf dem Zettel sieht, um ihn dann sofort zu vergessen.
Nein! Seien wir offen! Diese Solistenkonzerte, für welche vom Konzertunternehmer ein unmögliches Publikum zusammengetrommelt wird, sind eine Unmöglichkeit. Sie kosten viel Geld und haben absolut keinen Nutzen. Der Konzertgeber erlebt nichts als Enttäuschungen davon.
Wie häufig wirken nun aber doch auch Virtuosen in Orchesterkonzerten mit. Ist denn da nicht stets dem Künstler eine große Einnahme sicher?
Schön ist es für einen jungen Virtuosen, wenn er in ein anderes Land fahren kann, um dort zu konzertieren. Alle seine Freunde sind entzückt, wenn sie eine große Musikzeitung erhalten, deren erste Seite mit dem Bild des Künstlers geziert ist. Aha, denken die unschuldigen Leute, nun fängt bei dem die Unsterblichkeit au! Für die ungeheure Ehre, sein Bild in der Zeitung zu sehen, hat der Ärmste gar viel Geld bezahlen müssen. Der Anfang der Berühmtheit ist schmerzlich teuer. Die Fortsetzung nicht minder. Eine Reklame nützt nichts, einmal ist keinmal. Gar häufig wird die Entgegnung laut, es sei doch nicht denkbar, daß eine Abbildung in einer Zeitung [23] so viel Geld koste, denn der und der bekannte Künstler sei kürzlich auch darin abgebildet gewesen. Gewiß: Unmittelbar hat ein bekannter Virtuos seine Porträtierung zur Reklame nicht nötig. Er muß aber doch riskieren, daß, wenn er sich auf der ersten Seite nicht ankauft, auf einer anderen Seite Sachen stehen, die ihm nicht förderlich sind. Die Reklame wird ein Spieler, welcher in einer großen Stadt auftritt, doch wohl sicher bezahlen können. Die Mitwirkung in jedem Orchesterkonzert muß ja viel einbringen. Aber es ist nicht zu glauben: Gar häufig wird in den Orchesterkonzerten von den Virtuosen noch zugezahlt, anstatt verdient. In manchen Konzertvereinigungen, da zahlen nicht nur die Virtuosen, damit sie spielen dürfen, da zahlen auch die Komponisten, damit ihre Werke zur Aufführung gelangen. Es gehört nur der Mut dazu, Geld anzubieten, um vorwärts zu kommen. Eine Kunst ist es, das Geld zart und mit Eleganz anzubieten; bei dem Geschäft darf man nicht knauserig sein. Dann wird sich schon zeigen, was alles mit Geld zu erreichen ist.
Wie in vielen Orchesterkonzerten so liegen die Verhältnisse in den Kammermusikveranstaltungen traurig. Bei dem Versuch, in die Aufführungen alt eingesessener Vereinigungen mit Geld einzudringen, wird man eventuell schroff abgewiesen. Honorar wird aber selbst da in manchen Fällen nicht gezahlt. Auf eine zarte Anfrage wird nur die tröstliche Antwort erteilt: »Wir werden es uns zur Freude anrechnen, Sie bei uns spielen zu lassen. Leider sind wir aber nicht in der Lage, Ihnen die Reise- und Hotelunkosten zu ersetzen«. Junge Unternehmungen suchen aber direkt ihr Defizit zu decken, indem sie mitwirkende Solisten zahlen lassen. Es ist ja nicht zu glauben, wie viel mit Geld versucht, wie viel mit Geld erreicht wird. Nicht nur kleine arme Schlucker lassen sich zahlen, auch hochstehende große Leute, welche durch sonderbare Gelüste trotz immenser Einnahmen stets in Geldnot sind, stopfen die Löcher ihrer [24] Kasse gern einmal vorübergehend mit Papiergeld zu. Ein Impresario kann ruhig zu einem Musiker, der nur einigermaßen Virtuosität auf einem Instrument besitzt, sagen: »Geben Sie mir 30000 Mark und ich mache Sie zu einem berühmten Künstler«. Wer kennt nicht all die Kniffe, die so nebenbei verwendet werden, um einem Virtuosen aufzuhelfen. In der Reklame wird ununterbrochen auf eine Spezialität aufmerksam gemacht, da heißt es von einem Geiger: er ist ein unvergleichlicher Paganinispieler. Einzelheiten gelingen ihm sicher bei Paganini sehr gut, im wesentlichen ist er freilich ein Faiseur. Jede Sache wird aber so von ihm eingerichtet, daß sie blendend aussieht. Sei es nun, wie es wolle, die Spezialität wird betont, und nach und nach – bei ununterbrochener Reklame – fängt die Welt wirklich zu glauben an, daß der Mann ein Unikum im Paganinispiel ist. Wer erinnert sich nicht an die Fälle, in denen solche Spezialisten so bitter enttäuscht haben. Wunderdinge verlauten über das Beethovenspiel von diesem Pianisten, das Chopinspiel von jenem. Der ehrliche Zuhörer vernimmt von diesen Autoritäten nun Werke, welche alle andern Pianisten auch in ihrem Repertoire haben, und findet mit Staunen, daß der Vortrag hier nicht nur nicht besser, sondern schlechter ist als bei den andern. Die Phrasierung läßt zu wünschen übrig, die Wärme im Ton fehlt und nicht einmal technisch ist alles vollkommen. Doch das ist gleichgültig. Die Macht der Reklame hat so gewirkt, daß Publikum und Kritiker gefangen sind. Leute, welche ehrlich Kritik üben wollen, schweigen aus Angst, übel angesehen zu werden. Nicht selten passiert es sogar, daß auswärtige Künstler nach Deutschland kommen und schlechter spielen als viele, viele einheimische Virtuosen, und daß doch, dank einer staunenswerten Machenschaft, der Exote für eine Kunst, die er nicht besitzt, verherrlicht wird.
Die Täuschungen können ruhig vorgenommen werden, niemand beklagt sich über die Enttäuschungen. Die Musiker [25] besitzen viel zu wenig Gemeinsinn, um sich zusammenzutun und offen und ehrlich gegen die Mißstände aller Art Front zu machen. Wohl wird bei allen rechtlich Denkenden immer aufs neue der Unmut laut; zu einem energischen Auftreten kommt es aber nicht. Nicht Wenige wollen auch von den Zuständen profitieren, selbst wenn sie zugeben, daß dieselben unerfreulich sind.
Fahren da zwei Sängerinnen von einem Musikfest nach Haus. Die eine erzählt der anderen, daß sie von dem Vereinsvorstand schon wieder für zwei Konzerte in der nächsten Saison verpflichtet ist. »Wie fangen Sie das nur an?« ertönt sorgenvoll die Frage. »Ganz einfach«, lautet die Antwort. »Sie wissen doch, daß der Herr Vorstand ein unglaublicher Damenfreund ist. Zu ihm fahre ich nur im tadellosesten Decolletee. O, der weiß die schöne Linie meiner Figur zu schätzen und kann sie gar nicht oft genug bewundern. Ich habe ihm schon Versprechungen für ein neues Kostüm im nächsten Winter gemacht. Ich singe dann einmal für die Pensionskasse des Vereins gratis, das macht einen guten Eindruck. Das heißt, gratis singe ich nie. In solchen Fällen singe ich dann Lieder, für deren Vortrag ich mich gut bezahlen lasse. Man muß nur den Rummel verstehen.«
Die Sängerin profitiert eben auch nur zu gern von dem Mißstand, daß für Vorführung von Kompositionen gezahlt wird. Man braucht ja nicht immer plump 100-Markscheine für den Vortrag von Liedern anzubieten. Die Annahme von Kompositionen läßt sich auch auf andere Weise nachdrücklich empfehlen.
Dem Dirigenten großer Konzerte wird beispielsweise die Partitur eines neuen Werkes zugesendet. Zu gleicher Zeit erhält er 100 Flaschen auserlesener Weine und ein Schreiben, in welchem ihm angedeutet wird, daß man mit einigen Gläsern des köstlichen Trankes im Leibe die schwierige Partitur viel besser genießen könne. [26] Ein Uneingeweihter muß sich stark verwundern, wenn er hört, daß zwei namhafte Künstler darauf gedrungen haben, in einem Konzertinstitut ein und dasselbe Konzert eines jüngeren noch ziemlich unbekannten Musikers während einer Saison zu spielen. Was kann an dem Werk so fesselnd sein, daß die beiden Virtuosen gerade darauf verfallen sind? Der Kenner lacht, denn er weiß über das Fesselnde Bescheid. Es besteht in der Zahlung von 1000 Mark für jede Darbietung an den Ausführenden. Das ist natürlich kein schlechtes Geschäft! Was Wunder, wenn viele davon profitieren wollen. Bedauerlich ist es, daß auch bedeutende Künstler nicht davor zurückschrecken, auf diese Manier ihre Einnahmen zu vermehren.
Häufig sehen die Beeinflussungen so harmlos aus, daß scheinbar nichts dagegen zu sagen ist. Wer riskiert es wohl, einen Kritiker mit Geld zu bestechen? Das kann höchstens eine Persönlichkeit, die nichts mehr zu verlieren hat, unternehmen. Denn abgesehen davon, daß sich ein Kritiker wohl nicht durch Geld bestechen läßt, kann gar leicht ein solcher Verstoß unter Geschrei von der ganzen Kritik entrüstet zurückgewiesen werden, und dann ist der Versucher vernichtet. In einer Stadt existiert nun ein Kritiker, welcher besonders gefürchtet ist. Dieser bedeutende Mann kritisiert aber nicht allein, er erteilt auch Gesangsunterricht. Sänger ist er nie gewesen, vorsingen kann er auch nichts, da er absolut keine Stimme besitzt. Er weiß aber klarzumachen, wie es freilich sonst jeder Mensch auch tun kann, daß man beim Singen den Mund aufzumachen hat, hier ein wenig höher, dort etwas tiefer singen muß, damit es gut klingt. Ist nun ein Konzert in der Residenz dieses kritisierenden Gesangstitanen beabsichtigt, so unterwirft sich der Debütant gläubig dem Gewaltigen, um noch den letzten Schliff zum öffentlichen Auftreten zu erhalten, für einige Stunden. Die Stunden sind teuer – aber die Kritik, welche dann geübt wird, ist gut. Wer unter solch künstlerisch vornehmer [27] Anleitung noch studiert hat, braucht für sein Auftreten nicht besorgt zu sein. Am schönsten ist es, wenn der bissige Herr Klavierspieler ist und Lieder komponiert hat. Dann läßt er sich am Ende durch Engagement als Begleiter und durch Aufnahme eines seiner Lieder in das Programm noch besonders günstig stimmen. Sicherlich werden die Beurteiler niemals die Begleitung eines Kollegen sehr tadeln, selbst wenn dieselbe nicht ganz den Anforderungen, welche man an konzertfähige Begleitung zu stellen hat, entspricht. Ein Teil der nachsichtsvollen Rücksichtnahme fällt dann eventuell auch auf den Gesangskünstler ab.
Und wie schwer haben es nun auch die jungen Komponisten. Einige Wenige schöpfen den Rahm ab, entweder weil sie Glück gehabt haben und ihre Werke aus irgend einem Grunde durchgedrungen sind, wirklich etwas Hervorragendes bieten, oder aber weil sie dem schlechten Geschmack des Publikums so entgegenkommen, daß das Ordinäre in den Werken den Absatz garantiert. Alle aber, welche ihre eigenen Wege gehen und nicht so schreiben können, daß eine Besonderheit hervorsticht oder den gemeinen Lüsten gefröhnt wird, die müssen mit ihren Heften hausieren gehen. Ach, das ist für denjenigen, welcher nicht zum Handlungsreisenden geboren ist, eine bittere Sache. Auf schriftliche Anfrage beim Verleger, ob er zur Annahme von Werken geneigt sei, erfolgt meistens die Antwort: »Zu meinen lebhaften Bedauern bin ich im Augenblick gerade so überlastet, daß ich nicht im Stande bin, neue Verpflichtungen einzugehen. Vielleicht läßt sich später eine Geschäftsverbindung zwischen Ihnen und uns herstellen«. Ist Absagebrief auf Absagebrief gekommen, dann faßt der verzweifelte Komponist endlich einmal den Mut, persönlich einen Besuch und Versuch zu machen. Findet sich nun wirklich eine mildtätige Seele, welche sich der Kompositionen erbarmt und bereit ist, den Druck zu übernehmen, so beginnt häufig der unsympathische Handel um den Preis der [28] Ware. Man erbittet für ein Heft Klavierstücke 150 Mark, 100 Mark sollen aber nur bewilligt werden, da die Aussicht auf Absatz gering ist. An der Komposition ist etwa vier Wochen lang gearbeitet und in der Woche sind 15 Stunden verwendet worden. Der Stundenlohn beträgt demnach 1 Mark 67 Pfennig. Der kann aber noch lachen, der seine 100 Mark wirklich einheimst. Für größere Werke, Kammermusikstücke usw. setzt es meistens garnichts ab. Und wieviel zeitraubender und anstrengender ist dabei die Arbeit! Häufig zahlen die Komponisten noch zu, damit ein Werk nur endlich einmal zum Druck kommt. Bittgänge sind dann weiter zu unternehmen, um Fürsprache für die Aufführung des Werkes zu tun. Virtuosen und Komponisten versenden Hunderte, ja Tausende von Selbstanzeigen, welche Geld und Zeit kosten, um sich in Erwähnung zu bringen. Meist ergeht auf alle Ankündigungen und Anfragen überhaupt keine Antwort. Ach, wie bitter sind alle die Enttäuschungen, welche immer und immer wieder erlebt werden.
Recht wünschenswert wäre es, daß eine Genossenschaftsdruckerei, ein Genossenschaftsverlag existierte. Der Komponist trüge dann selbst die Kosten der Drucklegung seiner Werke, genösse aber auch innerhalb der Schutzfrist den vollen Nutzen. Alle Musiker, welche im Stillen arbeiten, sich im Unterrichtsfach betätigen und nicht an die Öffentlichkeit treten, werden ja sowieso schlecht genug bedacht. Die Besteuerung kommt doch allein den Werken, welche in Konzerten, in Theatern aufgeführt werden, zugute. Das reizt die Komponisten auf Sensation hin zu arbeiten, Stoffe zu wählen, welche die Sinne kitzeln, Dinge vorführen, die ein Jeder gesehen haben muß. Je mehr Aufführungen, um so mehr Tantiemen.
Hat nun etwa der Verfasser schönster Unterrichtswerke nicht ebensoviel Verdienste wie ein Opernkomponist? Wäre es nicht recht und billig, daß dieser verdienstvolle Künstler auch Tan[29]tiemen aus seinen Werken bezöge? Vielleicht hat er seinerzeit ein paar Hefte, die später großen Absatz gefunden haben, billig verkauft. Nun, da die Stücke eingeführt sind und ununterbrochen in aller Welt gespielt werden, wird viel mit ihnen gewonnen. Derjenige aber, der sie geschrieben hat, gewinnt keinen Pfennig mehr daran. Man könnte doch so leicht die Höhe der Auflage festsetzen und von jeder neuen Auflage dem Komponisten einen Ehrensold bestimmen. Da kümmert sich aber niemand darum. Die Lehrer sind ja doch die Plebejer unter den Musikern. Von einer Protegierung derselben kann garnicht die Rede sein. Mögen die sich selbst helfen, wie sie können.
Wohl sind, um die Interessen der Musiker zu wahren, Vereine gegründet worden. Gemeinschaften, deren Aufgabe es ist, bedrängten und unterschätzten Künstlern eine Hilfe, eine Stütze zu sein, haben sich gebildet. Doch allenthalben sind die Mittel zu gering, die Beiträge zu minimal, als daß etwas Großes erreicht werden könnte. Mitunter wenden sich Musiker von diesen Vereinen rasch wieder ab, weil das Cliquenwesen, die Protektionswirtschaft alle Freude an den Bestrebungen der Vereine raubt. Keineswegs ist es für eine Sozietät vorteilhaft, wenn die Vorstände sogenannte Berühmtheiten sind. Das verleiht allerdings scheinbar der Vereinigung mehr Glanz, mehr Eigenart. Die Beobachtung läßt sich aber machen, daß gerade markante künstlerische Erscheinungen eine Sonderpolitik treiben. Wie sie es verstehen, durch ein Preßbureau immer und immer wieder Stimmung für ihre Persönlichkeit zu machen, so sammeln sie auch einen Kreis von Anhängern um sich, die ihnen in Wort und Tat nur nützlich sein können. Es laufen doch genug Menschen auf der Welt herum, die nichts sind, die wenig gelernt haben und nichts leisten. Durch den Umgang oder die Freundschaft einer Berühmtheit suchen sich solche Nullen eine Bedeutung zu geben. In ihrer blinden Bewunderung verlieren sie mit der [30] Zeit den richtigen Maßstab für die Beurteilung der Dinge. Rückhaltslos wird alles, was ihr Abgott schreibt, was er tut, verhimmelt. Allen partikularistischen Bestrebungen fügen sie sich ohne weiteres. Und die laufen doch stets auf eine einseitige Verherrlichung hinaus. Der Musikerstand kann so nichts profitieren. Da werden nur einzelne Elemente, welche in schlauer Berechnung alle Gelegenheiten für sich ausnutzen, in die Höhe kommen.
Auf welche Weise soll nun aber eine Besserung dieser traurigen Zustände herbeigeführt werden? Ist bei der großen Versumpfung überhaupt auf eine Änderung zu hoffen?
Zunächst müßten sich da einmal diejenigen Persönlichkeiten zusammentun, welche nur im Interesse für ihren Stand wirken wollen, welche ohne Nebengedanken einer Genossenschaft zur Hebung der Standesinteressen beitreten. Die Verringerung des Proletariats, die Vertilgung des Pfuschertums muß die nächstliegende Aufgabe sein. Dann aber wird überall für Aufklärung zu sorgen sein, schädigende Mißstände sind rücksichtslos aufzudecken. Unterstützungen sollen nur da, wo es wirklich angebracht ist, gewährt werden. Es fehlt ja zum Glück nie an Leuten, welche für wohltätige Zwecke Mittel freigebig zur Verfügung stellen. Die Schwierigkeit wird immer darin bestehen, daß in fraglichen Fällen die Mittel auch an würdige Empfänger ausgeteilt werden. Die Glücksgüter sind unter den Musikern zurzeit sowieso sehr ungleich verteilt. Die Primadonnenwirtschaft, welche momentan wieder in schönster Blüte steht, verschafft einzelnen Persönlichkeiten unglaubliche Vorteile. Den großen Sensationsvirtuosen wird ohne Zögern jedes verlangte Honorar bewilligt. Die Künstler, welche die Riesensummen erhaschen können, haben wohl recht, sie zu fordern. Unrecht aber tun die Leute, welche sie meist auf Kosten anderer zahlen. Hören wir nicht, daß an Dirigenten Honorare bezahlt werden, die ins Fabelhafte gehen, und daß für die [31] Musiker, der den Dirigenten unterstehenden Kapellen nur wenig Mittel übrig sind. Bedauerlicherweise sind diese reich bezahlten Sonderlinge für das allgemeine Musikleben der Stadt, in welcher sie angeblich dauernd ihren Wohnsitz haben, ohne jede Bedeutung. Entweder sind sie einseitig in ihrer Virtuosität und können namentlich auf das Unterrichtswesen absolut keinen Einfluß gewinnen. Ober aber sie sind immer auswärts auf Konzertreisen, so daß sie zu ihrer Residenz in keine nähere Beziehung treten können.
Auf solche Zugvögel setze man keine Hoffnungen. Keine der Erwartungen würde da in Erfüllung gehen. Unterstützung und Hilfe muß von einer anderen Seite kommen. Die stillen Arbeiter, die ernsten Lehrer, welche unbekümmert um das Getriebe des Gesellschaftslebens in ehrlichem Streben und treuem Pflichtgefühl tätig sind, das sind die Elemente, welche allein Gutes stiften können und die Jugend zu behüten und führen vermögen. Ihnen muß freilich eine Garantie gegeben werden, daß ihrem Mühen und Ringen nicht entgegengearbeitet wird. Dazu ist eben erforderlich, daß alle Schäden, alle Unsauberkeiten rücksichtslos zur Besprechung gelangen.
Stephan Krehl, „Musikerelend“, Teil I

Stephan Krehl (1864–1924)
Quelle: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StephanKrehl.jpg>
Im Jahre 1912 erschien das Buch »Musikerelend« des Komponisten und Musiktheoretikers Stephan Krehl (1864–1924). Krehl, seit 1902 am Leipziger Konservatorium tätig und von 1907 bis zu seinem Tod Leiter der Institution, stellte dort laut Untertitel »Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf« an. Sie sind polemisch formuliert und geben unmittelbare, heute teils kurios anmutende Einblicke in seine Sicht des Musiklebens, insbesondere mit Blick auf die soziale Stellung der Musiker_innen, in einer Zeit des Umbruchs.
Stephan Krehl (1864–1924):
Musikerelend
Betrachtungen über trostlose und unwürdige Zustände im Musikerberuf
[Teil I]
Leipzig: C. F. W. Siegel [1912].
[5] Vorwort.
Innerhalb der letzten Jahre hat bei allen ernst gesinnten Musikern eine große Unzufriedenheit Platz gegriffen. Die Verbitterung ist so stark, daß sich eine gewisse Besorgnis für die Zukunft des Musikerstandes nicht unterdrücken läßt. Man ist über das geschäftliche Gebaren in der Kunst, wie es uns vom Ausland zugekommen ist, auf das Tiefste empört. Die sittliche Verwahrlosung, ja die Verrohung, welche die Geldherrschaft im Gefolge hat, wird auf das Schmerzlichste empfunden. Leider fehlt es scheinbar den Musikern an Energie, sich zur Abwehr böser Elemente zusammenzuschließen. Schilderungen betrübender Vorkommnisse, Berichte krasser Einzelheiten gehen von Mund zu Mund; aber niemand unternimmt es, weite Kreise aufzuklären. So wächst die Fäulnis an, die Zersetzung schreitet fort, ohne daß auch nur von einer Seite Gegenmittel zur Anwendung gelangen.
In den folgenden Betrachtungen soll es versucht werden, bedauerliche Zustände zu schildern. Vielleicht geben diese Zeilen den Anlaß, daß Leute, welche besser als der Verfasser unterrichtet sind, mit weiteren Veröffentlichungen hervortreten. Nur durch häufige, öffentliche Aussprache, durch Aufklärung der Jugend wird man auf Heilung der Schäden hoffen können.
Niemand kann ein Interesse daran haben, persönliche Beleidigungen auszusprechen, Angriffe auf einzelne Persönlichkeiten zu richten. Die Einzelbeschreibung hat hier vollständig zurückzutreten. Handelt es sich doch wirklich nicht um die Verirrungen dieses oder jenes Menschen, sondern um allgemeine verderbliche Zustände.
Interview von Marek Dippold mit Karl Ottomar Treibmann
Am 1. Juni 2012 hat Marek Dippold im Rahmen seiner Untersuchungen zur Fünften Sinfonie von Karl Ottomar Treibmann ein Interview mit dem Komponisten geführt. Die Studie wird im Herbst 2014 in den Schriften online: Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« erscheinen. Das Interview können Sie schon heute lesen.
Marek Dippold: Ihre Biographin Ulrike Liedtke bezeichnet Ihre Fünfte Sinfonie als »Aufbruch-Sinfonie«. Sie haben erste Skizzen bereits 1983 angefertigt und sie ab Mitte 1986 bis März 1988 vollendet. Woher kam ihre Motivation, in dieser Zeit des Stillstands in der DDR solch einen Aufbruch musikalisch umzusetzen?
Karl Ottomar Treibmann: Ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Dinge: Der Stillstand, der hier herrschte, hat eigentlich nichts mit dem Stillstand in der Musik zu tun. Musik ist ein bewegtes Medium. Musik hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Natürlich können Sie Musik komponieren, die ganz langsam ist und sich nicht bewegt, dann könnte man sagen: Das hat etwas mit Stillstand zu tun. Aber ich bin in meinen Arbeiten immer davon ausgegangen, dass ich an bestimmten tradierten Gattungen – Sonate, Sinfonie, Oper – mich orientiert habe, die für mich vorbildhaft als Gattungen gewirkt haben. Und wenn ich eine Sinfonie schreibe, war für mich klar: Hier müssen Kontraste entworfen werden. Das ist in all meinen Stücken so, seit meiner Ersten Sinfonie. Materialkontraste werfen Fragestellungen auf, wenn man einen Satz mit dem anderen vergleicht. So kommt beispielsweise auch nach dem Chaos in der Mitte des zweiten Satzes meiner Consort-Sonate ein Kontrastprogramm. Diese Kontrastprogramme sind für die Kommunikation sehr wichtig und ich habe aus dieser Vorstellung meine Musik entwickelt.
Über die Fünfte habe ich lange nachgedacht, und Mitte der 1980er Jahre habe ich von Walter Markov, dem großen Leipziger Historiker, die beim Reclam-Verlag erschienenen Dokumente zur Französischen Revolution gelesen. Diese haben mich emotional bewegt. Was da los war: Wenn Sie das in den Geschichtsbüchern lesen, sehen Sie es so, aber wenn Sie die Original-Dokumente lesen, dann kann das schon sehr berührend sein, weil das dann noch unmittelbar wirkt. Ja, ich weiß auch nicht, jedenfalls passierte es dann, als ich mit dem Stück gearbeitet habe, dass da die Marseillaise im ersten Satz rhythmisch anklingt und im Schluss, in der Dreiklangsbildung der letzten Töne auch zitiert wird. Das passte in mein sinfonisches Konzept.
Dippold: Sie erwähnten die Schriften von Walter Markov. Inwieweit sahen Sie in den 1980er Jahren Parallelen zum Vorfeld der französischen Revolution?
Treibmann: Ich will mal so sagen: Wenn Sie hier gelebt haben und gemerkt haben, was hier los war und sind von einer bestimmten Mentalität geprägt, dann musste man ja irgendwas tun. Man wusste, so geht es nicht weiter. Deshalb drängt das und drängt das und drängt das. Das kann man im ersten Satz bemerken und das kann man im Schlusssatz bemerken. Nun musste aber auch ein Ruhepunkt her. Und so ist die Meditation entstanden. Die war allerdings schon vorher angedacht. Dazu gibt es zwei Vorfassungen: Ich habe eine Schauspielmusik gemacht nach einem Stück von Volker Braun: Die Schmitten. Da wurde an einer Stelle Lyrik gebraucht. Ich habe da ein Ensemble zusammengestellt: Cello, Vibraphon, Oboe. Dort ist diese Struktur vorgeahnt. Und dann habe ich zum 60. Geburtstag meines Freundes Alfred Mörstedt Girlanden für einen Freund komponiert. Dieses Stück schien mir geeignet, in eine große Form transformiert zu werden. Da kommt natürlich etwas anderes zustande, die Dinge wachsen sich aus. Ich habe dann von der systematischen Seite her noch einmal die Tonfolge verbessert, die Struktur strenger, konsequenter, in meinem Sinne entwickelt und dann diesen Streicherfächer darüber gelegt, der sich von oben nach unten schiebt. Die Stimmung ist von einer zarten Situation aus dem Schauspiel abgeleitet.
Dippold: Sie waren als Universitätsprofessor und Bezirksvorsitzender des Komponistenverbandes sowohl mit Studenten als auch mit Ihren Kollegen – Künstlern und Wissenschaftlern – in regem Austausch. Wie sehr wurde der Wunsch nach gesellschaftlichem Wandel, Freiheit usw. bis 1988 schon thematisiert?
Treibmann: Wissen Sie, ich habe in den 70er Jahren meine Oper Der Preis geschrieben. Da geht es nur um die Verantwortung des Einzelnen. Und das ist eigentlich immer mein Anliegen. Tja, im Austausch mit Kollegen oder auch im Komponistenverband spielte das keine Rolle. Über die Werke, die damals komponiert worden sind, haben wir natürlich gesprochen. Aber es waren im Grunde keine politischen Diskussionen. Das hat sich dort wenig abgespielt. Aber wir haben im engeren Freundeskreis sehr intensiv über diese Stagnation nachgedacht.
Es gab in der Universität ein strenges Reglement. Und da gab es jedes Jahr diese Einführungswochen. Zum Glück hatte ich eine künstlerische Professur, die nannte sich »Professur mit künstlerischer Lehrtätigkeit«. Da brauchte ich mit Vorlesungen nie in den sauren Apfel beißen. Zu Vorlesungen zu den jeweiligen Parteitagen waren die wissenschaftlichen Professoren aber natürlich angehalten, das hat die meisten auch nicht begeistert. Im Tonsatzunterricht haben wir immer unsere Arbeit gemacht. Ich weiß noch 1989, als meine beiden Sinfonien uraufgeführt worden sind, da habe ich meinen Studenten diese vorgespielt.
Dippold: In den Werken vor der Fünften Sinfonie haben Sie vor allem Widersprüche und Probleme aus dieser Zeit der Stagnation heraus thematisiert. Meines Erachtens nach ist die Fünfte Sinfonie die erste, in der Sie sagen: Hier muss man etwas tun, hier muss es zu einem Aufbruch kommen. War das damals ein neuer Aspekt in ihrem kompositorischen Schaffen?
Treibmann: Das ist möglich. Ich weiß nicht. Das kann ich schlecht beurteilen. Die Chorsinfonie Der Frieden ist ein hartes Stück. Dort gibt es Trümmer, zuletzt bleibt übrig: »Unterm Sternenzelt muss ein großer Frieden wohnen.« Oder »Tu was!«, »Tu was für den Frieden!« wird dort geschrien. Ich würde diese Dinge alle im Fluss sehen. Der erste Satz der Ersten Sinfonie: nur eine Pulsation, dann gibt es einen chaotischen Satz, dann Lyrik: Die Musik braucht ja eine Balance. Oder die Zweite Sinfonie, sie endet mit einem riesigen Hymnus und vorher ein Satz, wo alles zusammenbricht. Was zu tun war, hat dann die Zeit gebracht. Das Leben hat uns immer wieder Konflikte vor Augen geführt. Eigentlich war immer etwas zu tun. Es waren konfliktreiche Zeiten. Wir wollten hier ja auch ein normales Leben führen. Deshalb kam es mir nicht in den Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, bis sich was ändert. Mit meinen Stücken wollte ich Akzente setzten, Denkanstöße, Hoffnung vermitteln. Wenn man sich künstlerisch betätigt, ist man natürlich immer in der Situation, dass man etwas zu Papier bringt. Kunst vermittelt Empfindungen, die nicht nur zeitgebunden waren. Wissen Sie, das ist alles schwierig, die DDR ist lange vorbei. So ging das damals nicht weiter. Aber wie das weiter gehen würde, da waren sogar die Politiker überrascht.
Dippold: Die Bezeichnung Ihres dritten Satzes, »Dithyrambus«, konzipierten Sie als Geste gegenüber Karl Amadeus Hartmann und dessen Achter Sinfonie. Dort jedoch erscheint mir der II. Teil, der mit »Dithyrambus« überschrieben ist, wesentlich zwiegespaltener und komplexer in der Anlage als Ihr dritter Satz. Hartmann entfernt sich meines Erachtens nach vom dithyrambischen Charakter bis zu einem gewissen Grad.
Treibmann: Das ist möglich. Das war halt seine Art, und dies ist meine Art. Das kann man schlecht vergleichen. Der expressive Zugriff Hartmanns hat mich schon immer fasziniert. Was soll ich da weiter sagen…
Dippold: Ich meine, ob Sie da irgendeinen Ausgangspunkt hatten, den Sie etwas als Keimzelle aus Hartmanns Sinfonik genommen haben?
Treibmann: Nein, überhaupt nicht. Ich nehme niemals Anleihen von irgendwo her. Ich wollte es nur als eine Bewunderung für diesen großen Meister.
Dippold: Sie hatten vorhin bereits den Maler Alfred Mörstedt erwähnt. Darüber hinaus zählten Sie den Maler Wolfgang Mattheuer zu Ihrem Freundeskreis und auch Sie selbst sind künstlerisch tätig. Sind Sie Synästhet? Hören Sie Farben?
Treibmann: Wenn ich komponiere und die Partitur schreibe, höre ich natürlich Klänge.
Dippold: Ich meine darüber hinaus gehend, wie Kandinksy und Schönberg etwa Farben eines Bildes gehört haben. Diese nannten ihre Werke »Farbsinfonien«, Sie bezeichnen umgekehrt ihre Kompositionsmittel wie zum Beispiel die terzgeschichtete Klangmassenverschiebungen im ersten Satz der Fünften als »Klangbilder«.
Treibmann: Nein, Farben hören in dem Sinne kann ich nicht. – Ich versuche für jeden Satz eine eigene Klangstruktur zu entwerfen. Wenn Sie Schönberg sagen und das Bläserquintett nehmen, da haben Sie nur ein Klangbild. Ich möchte die Sätze klar voneinander absetzen. Der Begriff »Klangbild« weckt vielleicht falsche Assoziationen. Klangraum ist vielleicht besser. Auf der einen Seite sind es diese Terztürme, dann Diatonik, auf der anderen Seite diese Zwölftonreihe, aus denen Klangräume entwickelt werden.
Dippold: Sie meinen also mit »Klangbild« oder »Klangraum«: Für jeden Satz haben Sie eine Klangstruktur, die so einzigartig ist, dass man, wenn man einen Teil daraus hört – und ein guter Hörer ist –, zum Schluss kommt: Das muss zu diesem Satz gehören, weil es nur diesem Klangbild entspricht.
Treibmann: Ja, das würde ich unterstützen. Das hat auch noch eine psychologische Überlegung. Der Hörer will sich ja in irgendeinem Klima orientieren können. Wenn Sie nur graue Masse komponieren, dann ist die Orientierung sehr schnell verloren. Aber durch diese Klangorientierung, auf denen dann die Impulsationen, die Struktur, die Dramaturgie sich entwickelt, dann kann der Hörer einsteigen. Denn es ist ja wirklich das Problem der zeitgenössischen Musik, dass sie keiner hören will, es fehlt die harmonische Heimat, die schon bei Reger in die Binsen geht, nehmen Sie sein drittes Streichquartett op. 74, da gibt es knallharte Dinge. Aber sowohl er als auch Richard Strauss haben ja immer diese tonale Bindung gehabt. Und heute muss man sich überlegen, wie man diese Bindung auf anderem Wege herstellt. Ich will eine Musik schreiben, weil ich kommunizieren will. Da kann ich also nicht nur auf Dissonanzen nach Gutdünken setzen. Zur Klangstruktur des ersten Satzes bin ich angeregt worden vom Adagio aus Mahlers Zehnter Sinfonie. Dort gibt es am Ende den großen neuntönigen Akkord. Der ist eiskalt. Und im Grunde ist es dieser Akkord, bloß, dass ich ihn systematisiert habe und er sich nun bewegt. Und damit klingt das dann ganz mild. Dem Klangcharakter ist also durch diese Addition, durch diese Bewegung die Kälte genommen. Dann hatte ich mir gedacht: das könnte funktionieren. Im „Idiot“ kommt das schon vorher vor, auch wenn es etwas anders funktioniert als in der Fünften. Deshalb: Klangbilder zur Orientierung. Ich habe immer schon improvisiert, als Kind nach Reger mit den entsprechenden Harmonien und dem verminderten Akkord, der überall hin wandern kann.
Dippold: Sie sind ausgebildet worden unter anderem bei Fritz Geißler und Carlernst Ortwein, genannt Conny Odd, der ja auch Popularmusik gemacht hat. Inwieweit wurde es damals, bei Ihrer Ausbildung, besprochen, diese Problematik, ohne echte tonale Bindung eine Klammer für den Hörer zu finden?
Treibmann: Das hat keine Rolle gespielt. Conny Odd war ein phantastischer Instrumentator und Filmkomponist. Und da gab er eine Szene vor und wir haben mit der Stoppuhr gesessen und eine Szene komponiert. Oder wir haben Čajkovskijs Jahreszeiten für Orchester ausgesetzt. Und bei Geißler hatten wir ja – das war bedeutend – Zwölftontechnik gemacht. Das haben einige Alte damals gemacht: Er oder auch Arnold Matz, der Solobratscher des Gewandhausorchesters, ein sehr interessanter Komponist, die haben die Zwölftontechnik so verwendet, dass sie nicht nachzählbar ist, also verschleiert.
Dippold: Also nicht so reduziert und verdichtet wie bei Schönberg oder gar Webern.
Treibmann: Sie können ja eine Reihe so bauen und so bauen. Das war schon eine Kritik an den Zuständen, denn damals war das ja anrüchig, das war ja Sünde. Das war aber auch das spannende. Geißlers Zweite oder Dritte Sinfonie, das sind große, expressive Stücke, die durchaus einen Klangcharakter haben so wie bei Hartmann. Geißler hat später eine Wendung zum Populären gemacht, sagen wir, indem er sich mehr dem konservativen Erbe zuwandte. Oder auch Penderecki, der war so gut, und dann macht er solche Sachen, plötzlich bekommt das so eine für mich nicht überzeugende Diktion, wenn dann Stille Nacht vorkommt, wo es nicht hingehört. Ich bin deshalb zu anderen Formen gekommen. Ich dachte eben: man kann nicht nach dem ›Man-nehme-Rezept‹ arbeiten, weil man kommunizieren will. Der Kommunikationswille ist ja bei Geißler und Penderecki da. Für mich war der systematische Aspekt bedeutend. Dass ich also über klangsystemastisch entwickelte Klangbilder, die miteinander kontrastieren, kommunikativ sein kann, ohne, dass jemand sagt, das klingt ja wie Richard Strauss. Also so was kommt ja sonst vor, da sind Sie schnell dort gelandet, wenn Sie nicht systematisch vorgehen. Es ist schwer zu komponieren, wenn man sich nicht von Vorbildern lösen kann. Hartmann, Henze oder auch Lutosławski waren für mich immer Vorbilder, aber nicht, indem ich sie nachmache, sondern in ihrer Haltung.
Dippold: Herr Treibmann, vielen Dank für das Gespräch.
Kateryna Schöning: Das Melodram in Russland im ausgehenden 18. Jahrhundert
Das Melodram in Russland im ausgehenden 18. Jahrhundert
Giuseppe Sartis Euripides’ Alkestis (1790)
und Evstignej I. Fomins Orfeo (1791/92)
Dr. Kateryna Schöning (HMT Leipzig)
Sofern nicht anders vermerkt, stammen alle Übersetzungen von der Verfasserin.
Untersuchungen zur Geschichte des Melodrams in Russland bilden bis heute ein Desiderat sowohl in der russischen als auch in der internationalen Forschung zur Geschichte dieses Genres. Die russische Musikwissenschaft begann eine gründliche Beschäftigung mit der Musiktheatergeschichte vor 1800 erst in den 1920er Jahren. Allgemeine Aufmerksamkeit gewann vorrangig Evstignej Ipat’evič Fomin / Евстигней Ипатьевич Фомин (1761–1800), der »eine neue russische Oper« geschaffen habe.[1] Zunächst versuchte die Forschung jedoch die lückenhafte Kenntnis seiner Biographie zu erweitern und die umstrittene Autorschaft mehrerer Werke zu diskutieren (Finagin 1927, Findeisen 1928 und Rabinovič 1948).[2] Erheblicher Quellenmangel durchkreuzte Untersuchungen zu gattungsstilistischen Fragen. Was die Spezifika des Melodrams in Russland ausmachte, kam nicht zur Diskussion. Fomins Orfeo als ein Melodram zu bezeichnen, wagten nicht einmal alle Wissenschaftler. Finagin beispielsweise bestimmte Orfeo als eine Oper und zugleich als ein Melodram im »hohen Stil«: »In Orfeo sehen wir den erfolgreichen Versuch, eine ernste Musik in der Art Glucks zu schreiben«.[3] Nach 1945 trug die staatlich geförderte Aktion zur Entwicklung des nationalen Selbstbewusstseins und zur Pflege der eigenen Kultur zur Wiederbelebung des Interesses an Fomin bei. Eingebettet in eine Reihe historischer Konzerte, erlebte Fomins Orfeo in Moskau im Jahre 1947 seine sowjetische Erstaufführung.[4]

Евстигней Ипатович Фомин — «Евстигней Ипатович Фомин» участника неизвестен – собственная работа Lis23852385. Под лицензией Public domain с сайта Викисклада
Die Musikwissenschaft stellte sich ihrerseits auf die nationalen Elemente in der Musik Fomins ein. Sie übernahm den noch von Finagin aufgegriffenen Leitfaden, dass Fomins Bühnenwerke den zur Zeit der Zarin Katharina II. (1762–1796) verbreiteten Ideen der russischen Aufklärung entsprächen. Hervorgehoben wurde Fomins Intention, eine ›nationale russische Oper‹ zu schaffen: eine Oper mit russischem und in russischer Sprache dargelegtem Sujet unter Verwendung von Volksliedmelodik. Großer Wert wurde auf »das beste ›russische Werk‹ Fomins« gelegt,[5] die Oper Jamščiki na podstave.[6] In diesem Kontext wurde dann auch das Melodram Orfeo ausführlich analysiert. Die 1968 erschienene Monographie Evstignej Fomin von Boris V. Dobrochotov berichtete erstmals ausführlicher über dieses »erste russische Melodram«.[7] Als ›typisch russisch‹ galt dem Autor dabei die »sehr enge innere Verbindung des Stückes mit dem russischen tragischen Theater des 18. Jahrhunderts«,[8] worauf das Wort-Ton-Verhältnis und die angeblich musikalisch übernommenen Intonationen der russischen Sprache hindeuten sollten. Von Bedeutung seien ferner die inhaltlichen Hintergründe der Tragödie nach dem Orpheus-Mythos. Der Autor der literarischen Vorlage, der russische Dramatiker Яков Б. Княжнин / Jakov B. Knjažnin (1742–1791), war bekanntlich eine der zentralen Figuren in der russischen Bewegung der »Freidenkenden«[9] gegen den aufgeklärten Absolutismus von Katharina II.[10] Da auch der Protagonist des Dramas gegen die Macht – wenn auch gegen eine göttliche – protestierte, konstruierten die Forscher einen Zusammenhang zwischen Fomins Musik, dem russischen dramatischen Theater und der politischen Situation Russlands in den 1790er Jahren.[11] Dies übertrug sich auf die Rezeption von Fomins Melodram. Sein Vorhaben, die Tragödie von Knjažnin in Musik zu setzen, wurde letztlich als »ein fast selbstmörderisches Unterfangen« bezeichnet.[12]
Es ist bedauerlich, dass die Musikwissenschaft der 1960er Jahre der Frage nach dem ›Russischen‹ im Melodram nicht weiter nachgegangen ist. Was genau nämlich Fomin in der Musik unternommen hatte und wie sich hier die »russische Theatersprache des 18. Jahrhunderts« darin widerspiegelte, blieb ungeklärt, obwohl Dobrochotov eine präzise Deutungsanalyse angeboten hatte.[13] Die Akzente wurden jedoch verschoben: Aufgrund charakteristischer Themen und Erinnerungsmotivik tendierte die Forschung dazu, Fomins Werk als programmatisches »symphonisches Poem« zu bezeichnen.[14] Orfeo bekam mithin den Ruf, ein Musterbeispiel »für das russische Symphonische« zu sein.[15] Daraus hätte man schließen können, dass die Musik in diesem Stück zur Darstellung und Kommentierung des Textinhaltes tendierte statt eine konkrete Bearbeitung des russischen Wortes zu sein. Das Melodram als textlich-musikalische Gattung ließ sich mit diesen Leitfragen noch nicht erfassen. Selten blieben auch die Versuche, Fomins Orfeo mit anderen, nicht einmal mit russischen, Melodramen zu vergleichen.[16] Auch Еврипидовой Алкисты / Euripides’ Alkestis (1790) von Giuseppe Sarti (1729–1802) war da keine Ausnahme, das eigentlich älteste Melodram mit russischem Text. Dieses Stück war als Abschluss eines größeren Bühnenwerkes Начальное управление Олега / Načalnoe upravlenie Olega (Der Anfang der Regierung von Oleg) entstanden, das Libretto dazu stammte von niemand anderem als Katharina II.[17]
Die Forschungslage hat sich seit den 1960er Jahren nicht grundlegend geändert. Im russischsprachigen Bereich wurden die älteren Monographien bloß in neuen Auflagen und Paraphrasen nachgedruckt (etwa bei Keldysch, 1990).[18] Das Lehrbuch Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка (2004) konturierte zwar die Tradition des russischen Melodrams um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert etwas schärfer, verallgemeinerte sie allerdings zu stark.[19] Hervorgehoben wurden nun Prinzipien, die für das Melodram generell gelten (psychologische Anspannung und Symbolik der Musik) oder allgemein für Russland charakteristische Elemente wie die Attraktivität und Bildlichkeit der szenischen Darstellung. Doch immerhin wurde damit das Melodram als eine spezielle Gattung betrachtet und in den Kontext des russischen literarischen Dramas mit Musik eingebettet.[20] Die deutschsprachige Musikwissenschaft übernahm von sowjetischen Forschern den Wissensstand der 1960er Jahre.[21] Neuere Beiträge wie Eighteenth-Century Russian Music von Marina Ritzarev (2006) und Bewitching Russian Opera von Inna Naroditskaya (2012) klammern das Melodram aus, obwohl der letztgenannte Beitrag erkenntnisreiche Informationen zum Hintergrund von Načalnoe upravlenie Olega gibt.[22]
Die mangelhafte Literaturlage lässt sich durch die Unzugänglichkeit der Quellen erklären. Besonders schwierig ist die Quellenlage zu Fomins Orfeo. Das Stück wird beispielsweise in NGroveD im Werkverzeichnis gar nicht erwähnt, obwohl es zu Fomins wenigen vollständig erhaltenen Werken gehört.[23] In RISM scheinen bloß zwei kontrapunktische Sätze von Fomin auf, die er in Bologna verfasst hat.[24] Das Autograph der Orfeo-Partitur liegt heute in der Zentralbibliothek des Petersburger Mariinski-Theaters, ist aus konservatorischen Gründen allerdings schon seit mehreren Jahren nicht mehr benutzbar.[25] Die einzige verfügbare Quelle ist damit eine 1953 von Dobrochotov edierte Partitur.[26] In Deutschland wird eine Fotokopie dieser Ausgabe seit 2011 in der Universitätsbibliothek Halle aufbewahrt.[27] Angesichts der schlechten Quellenlage sind die Beschreibungen des Autographs der Partitur, die Finagin (1927) und Findeisen (1928) hinterlassen haben, leider noch immer ›aktuell‹.
Der vorliegende Beitrag erörtert, welche Elemente der ersten russischen Melodramen auf charakteristisch Russisches verweisen und welche Voraussetzungen dafür bestehen, überhaupt von der Gattung eines ›russischen Melodrams‹ sprechen zu können. Der Ausgangspunkt für diese Überlegungen ist, zu klären,
- inwieweit die im ausgehenden 18. Jahrhundert als ›russisch‹ angesehenen literarischen und musikalischen Merkmale einen Zugang ins Melodram fanden und
- ob das europäische (vor allem deutsche und französische) Modell des Melodrams in Russland adaptiert wurde.
Es erscheint deshalb nötig, zunächst einen Einblick in die Integration der russischen Sprache und des russischen Volksliedes in das russische dramatische und musikalische Theater zur Zeit Katharinas II. zu geben sowie Daten zu damaligen Melodram-Aufführungen zu referieren. Als Nächstes lässt sich eruieren, welche Lösung der erste russische Melodram-Komponist Fomin fand und was zuvor der Italiener Sarti hatte unternehmen sollen, um am Hofe Katharinas II. das erste Melodram in russischer Sprache ausführen zu können.
I.
Die russische Sprache als nationaler Bestandteil des russischen Theaters eroberte ihren Platz im dramatischen und musikalischen Theater im ausgehenden 18. Jahrhundert. Den Vorrang hatte das Drama, das zu dieser Zeit vor allem Jakov B. Knjažnin / Яков Борисович Княжнин (1740–1791), Vladislav A. Ozerov / Владислав Александрович Озеров (1769–1816), Denis I. Fonvizin / Денис Ивановоич Фонфизин (1745–1792), Gavriil R. Deržavin / Гавриил Романович Державин (1743–1816) und Andere pflegten. Die Oper setzte dagegen bevorzugt auf andere Sprachen, weil fremdsprachige Theater in Russland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dominierten: Die italienische Oper war seit 1735 zunächst mit der opera seria präsent, 1757 bürgerte sich mit Locatelli die opera buffa ein, seit 1764 war die opéra comique zu Gast, und das »Deutsche Theater« spielte mindestens von 1776 bis 1791.[28] Es war Katharina II. gelungen, Komponisten aus ganz Europa an ihren Hof zu locken.[29] Von 1764 bis 1816 standen in russischen Diensten: Galuppi, Traetta, Paisiello, Sarti, Martini, Cimarosa, Grétry, Méhul und viele andere. Die Sprache variierte von einem Theater zum anderen. Im Deutschen Theater liefen Opern auf Deutsch – sogar italienische und französische Stücke, die dort aber nur 18 % ausmachten, wurden in Übersetzung gegeben.[30] Französische und italienische Texte in den entsprechenden französischen und italienischen Theatern firmierten meist im Original.
Ins Musiktheater drang das russische Idiom mit der Entscheidung von Katharina II., die Kultur zu ›russifizieren‹ und für ihre Innenpolitik zu instrumentalisieren. Die Zarin förderte die Einführung der russischen Sprache und russischer Sitten in den höfischen Umgang, wofür sie durch eigene literarische Tätigkeit das Vorbild gab.[31] Die Libretti vieler stilistisch italienischer und französischer Opern wurden nun auf Russisch verfasst. Beispiele solcher russifizierten Opern sind Anjuta / Анюта (1772; welche Quelle einer ursprünglich französischen komischen Oper als Vorlage diente, ist unbekannt; das Libretto stammt von Michail Popov / Михаил Попов),[32] Ivan (Johann Iosif) Kerzellis Rozana i Lubim / Розана и Любим und Feniks / Феникс (Knjažnin, 1778/79), Hermann Friedrich Raupachs Dobrue soldatu / Добрые солдаты (Michail М. Cheraskov / Михаил М. Херасков 1779), Antoine Bullants Sčastlivaja Rossia / Счастливая Россия (Cheraskov, 1787) etc.[33]
Gleichzeitig profilierte sich russische Drama. Zwischen 1770 und 1780 verbreiteten sich gemischte musikdramatische Konzeptionen mit eingefügten Balletten, Chören und Volksliedern. Die eigentümliche musikalisch-literarische Mischung war schon in deren Überschriften erkennbar: Der Dichter und Dramaturg Knjažnin nannte sein Theaterstück Titovo miloserdie / Титово милосердие (1790) »eine Tragödie in drei Akten, frei gedichtet, mit dazu gehörigen Chören und Balletten«;[34] das Stück Čuvstvovanie blagotvoreni / Чувствование благотворений (1787) definierte sein Autor Anton Teils / Антон Тейльс als ein »Drama mit Ballett«,[35] und ein charakteristisches Detail der Dramaturgie bildete darin ein eingefügtes Volkslied. Die Integration von Volksliedern, ›Rezitativen‹ und ›Arien‹ ins Drama bestimmte ein »Drama in zwei Akten mit Chören in Prosa« von Petr A. Pravil’ščikov / Петр А. Правильщиков.[36]
Mit Blick auf den Zusammenhang von musikalischen und dramatischen Komponenten betrachtet die Forschung das russische Theater im 18. Jahrhundert als ein literarisch-musikalisches Phänomen.[37] Das deutet darauf hin, dass das russische Theater im ausgehenden 18. Jahrhundert Erfahrung mit gemischten Wort-Ton-Konzeptionen gesammelt hatte. Dabei handelte es sich, wie auch im Operntheater, jedoch nicht um ›Sprache zur Musik‹, also nicht darum, dass die musikalischen und gesprochenen Ebenen sich synchron entwickeln. Das Russische wurde zuvörderst als literarische Sprache verstanden, nicht als eine zur erklingenden Musik. Das Verhältnis zwischen Text und Musik war daher locker: Die Musik bildete zum Text entweder einen Hintergrund der Stimmungsschilderung, oder es gab allgemein ›charakteristische‹ Intermezzi, die freilich austauschbar sein konnten. Die Musik fungierte also gewissermaßen als separate Ebene ohne direktes Verhältnis zum Text.
Ein Bestandteil der Charakternummern sowohl im dramatischen als auch im Musiktheater Russlands war stets ein nationales Element. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts war das Volkslied nicht nur im Drama, sondern auch in den ersten Opern von gebürtigen russischen Komponisten gängig, so bei Vasili А. Paškevič / Василий А. Пашкевич (1742–1792), Fomin, Dmitri S. Bortnjanski / Дмитрий С. Бортнянский (1751–1825), Michail A. Matinski / Михаил А. Матинский (1750–1820) und Michail M. Sokolovski / Михаил М. Соколовский (geb. 1756).[38] Die zunehmende Tendenz zur Aufarbeitung dieses Vokabulars führte zur Entwicklung einer speziellen Gattung russischer Lieder-Opern (etwa in Fomins Jamščiki na podstave, 1787).[39]
Es stellt sich die Frage, wie diese Erfahrungen mit dem Wort-Ton-Verhältnis und mit der Adaption von Liedformen dem aus Europa kommenden Melodram anverwandelt wurden. Das Melodram-Fieber grassierte in Russland früh und heftig. Rousseaus Pygmalion (1762) wurde schon 1772 »als eine aufsehenerregende Neuigkeit in der französischen Botschaft in Petersburg« auf Französisch gegeben.[40] Das war durchaus früh – im selben Jahr tauchte das Stück in französischer, italienischer und deutscher Sprache auch beispielsweise in Wien auf.[41] Die Melodramen von Georg Anton Benda erreichten den russischen Hof ebenfalls schon bald. Nur vier Jahre nach der Premiere von Ariadne auf Naxos 1775 in Gotha wurde das Stück bereits von Karl Knipper im Deutschen Theater in Petersburg aufgeführt. Medea lief dort 1781, sechs Jahre nach der Uraufführung in Leipzig.[42] Dann erschien Bendas Pygmalion 1791 in Petersburg[43] und 1794 bzw. 1800 in Moskau auf der Bühne.[44] Melodramen waren also seit den 1770er Jahren kontinuierlich in zwei russischen Großstädten präsent. Doch wurden sie nicht ins Russische übersetzt. Das Melodram scheint als eine eher exotische Gattung verstanden worden zu sein, die auf der russischen Bühne kein Äquivalent oder zumindest keine würdige Umsetzung ins Russische finden konnte.
Nicht zufällig waren die ersten Versuche, ein Melodram im russischen Sprachgebiet zu schaffen, von ausländischen Beispielen eindeutig abgegrenzt, zumal schon dadurch, dass im Titel ein Hinweis auf das melodrama russo gegeben war: Mit diesem Epitheton wurde 1781 das erste in Russland komponierte Melodram Orfeo, melodrama russo von Torelli beworben.[45] Der nächste Versuch – Euripides’ Alkestis von Giuseppe Sarti (1790) auf einen Text von Katharina II. – trug keine genaue Gattungsbezeichnung. Stattdessen war von einem Stück »Im griechischen Geschmack«[46] die Rede. Der vollständige Titel des ganzen Werkes, von dem Euripides’ Alkestis einen Teil ausmachte, verweist auf ein experimentelles Suchen und die Unentschlossenheit, was das Stück nun eigentlich sei: Načalnoe upravlenie Olega, podražanie Shakespeary bez sochranenija teatral’nych obyknovenych pravil / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ (Der Anfang der Regierung von Oleg, Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnlichen Theaterregeln zu bewahren). Die Bezeichnung Melo-Dramma für ein Melodram mit russischem Text wurde erst mit Fomins Orfeo (1791/92) eingeführt.[47] Auf die ›lockere‹ Position des russischen Melodrams insgesamt deutet auch das schnelle Verschwinden der Gattung hin – die letzten russischen Melodramen liefen in den 1800er Jahren (Aleksey N. Titov / Алексей Н. Титов Andromeda i Persey und Zirzeja i Ulis, beide 1802).[48]
Dieser Abriss lässt vermuten, dass das Melodram in Russland eigene Wege zu finden versuchte. Als Basis standen ihm drei Bereiche zur Verfügung:
- das eigentliche europäische Melodram (vor allem von Benda), das sich in Russland als ganz neu und fremd erwies,
- die Verschmelzung von opera seria, opéra comique und Lieder-Oper
- und die Erfahrung des russischen Theaters in der Koordination von Sprache und Gesang.
Im letzten Punkt konnten die Melodram-Komponisten sich eher auf ein Modell einer asynchron wechselnden Reihung des deklamierten Textes und der musikalischen Nummern stützen. Präferenz hatte dabei also das Modell einer literarisch, nicht einer musikalisch determinierten Komposition.
II.
Fomin ging mit der Herausforderung, ein russisches Melodram zu schreiben, in origineller Weise um. In der Tradition des russischen Theaters betrachtete er den literarischen Text – die Tragödie Orfeo von Knjažnin – als Grundlage, die nicht zu verändern sei. Orfeo von Knjažnin verkörperte aber ohnehin alle Attribute eines Melodrams im 18. Jahrhundert.[49] Sein Sujet geht auf die griechisch-römische Antike zurück. Die Tragödie ist kurz und in sich geschlossen. Traditionsgemäß enthält sie eine Exposition (die Schilderung der schon erfolgten Katastrophe mit anschließendem Beginn der Handlung: Monolog Orpheus’ über den Tod seiner Gattin und seinen Gang in die Unterwelt), die eigentliche Handlung (mit den zentralen Monologen von Orpheus in der Unterwelt und den dynamisch sich steigernden Dialogen mit einer überpersönlichen Schicksals-Stimme und mit Eurydike) sowie einen Schluss (den Monolog Orpheus’, der die Moral der Fabel expliziert). Die poetische Gestaltung der Monologe und Dialoge fußt auf der Technik des Sprechens zu verschiedenen Adressaten (zu sich selbst und zum Zuhörer), was der musikalischen Reflexion ausreichenden Spielraum bot. Eine Besonderheit der poetischen Vorlage lag darin, dass Knjažnin genaue Hinweise zu musikalischen Nummern zwischen dem gesprochenen Text gab. Das Konzept lag in einer Reihe eigentlich melodramatischer Komponenten (gesprochener reflektierender Text in Monologen und Dialogen) und Opernelementen. Er sah dafür folgenden Ablauf vor:
- Ouvertüre
- Monolog
- Erster Chor
- Monolog
- Zweiter Chor
- Dialog
- Dritter Chor
- Monolog
- Tanz der Furien.
Außerdem vermerkte Knjažnin, dass »Orpheus die Lyra spielt, während die Furien erscheinen«.[50] Damit war also auch ein rein instrumentaler Abschnitt vorgegeben. Eine solche Gestaltung des poetischen Dramas griff in Gänze auf die oben geschilderten Traditionen des russischen dramatischen Theaters im 18. Jahrhundert zurück.
Dem poetischen Text von Knjažnin zu folgen und diesen Text zu vertonen hieß für Fomin mithin, eine Mischform aus Melodram und Oper zu konzipieren. Musikalisch zu bedenken war zweierlei:
(1) die Komposition von Musik zur gesprochenen Sprache, ein für die russische Musik neues Phänomen,
(2) und die Komposition musikalischer Einlagenummern: von Chören, der Ouvertüre, dem Auftritt Orpheus’ vor den Furien und dem Tanz der Furien.
Dabei kam dem Komponisten die Entscheidung zu, inwieweit er eine gesungene Stimme einfügen und das Stück dadurch entweder ans Melodram oder an die Oper annähern wollte. Schließlich musste er klären, ob er die vom Text vorgegebene Nummernstruktur beibehalten wollte. Daraus würde dann entweder eine Anlehnung an die russische Theatertradition mit einem Nummernaufbau oder die Anverwandlung von Bendas Modell des Melodrams mit durchkomponierter Gestaltung resultieren.
Das Problemfeld von ›Musik zur gesprochenen Sprache‹ löste Fomin, indem er Bendas melodramatische Techniken bis ins Detail kopierte. Im Orfeo findet sich das typische Vokabular des bendaschen Melodrams wieder.[51] Das Bedeutungsfeld von Schrecken, Tod, Furien, Dunkelheit und Erdbeben bringt Fomin beispielsweise durch charakteristische trillernde Motive in Analogie zu Bendas Ariadne und Medea zum Ausdruck.[52]
Das Zittern und Beben setzt er musikalisch durch schnell repetierende Töne und dynamische Kontraste um (Beispiel 2, T. 254–261). ›Kriechende Tiere‹ finden in Orfeo ihren Ausdruck, indem Fomin das Motiv der sich drehenden Riesenschlange malerisch durch akzentuierte Sekundvorhalte in den Streichern darstellte (Beispiel 3, T. 268).
Der Vorgänger dieses Verfahren liegt gewiss in Bendas Ariadne mit den kreisenden Sekundbewegungen, die auch dort eine sich windende Schlange malen:
Orpheus’ Angst und das Zischen der Schlange vertont Fomin mit einem crescendierenden Tremolo der Streicher (Beispiel 3, T. 269). Das Bedeutungsfeld ›Ungeheuer‹ erweitert sich hier auf ›Schicksal‹ und ›Schlangenbiss‹ und überträgt sich musikalisch durch schnell wechselnde Dynamik – ähnlich wie beim brüllenden Löwen aus Bendas Ariadne (Beispiel 2, T. 260–261). Auch eine andere typisch bendasche Figur – rasch aufsteigende Zweiunddreißigstelläufe als Zeichen für das Wilde und den Sturm – zieht sich durch Fomins Melodram:
Diese Formel ist in der Melodramforschung als Rache-Motiv bekannt, das beispielsweise in Sophonisbe von Christian Gottlob Neefe (1776) ebenso vorkommt.[53] Kurze sforzandi mit Vorschlägen nutzt Fomin für die Flammen und »das Donnern, das die Ohren quält«. Seelische Qual drückt er mit einer Seufzerfigur aus, die unverkennbar eine Reminiszenz an barocke Lamenti und ihre Umdeutung in den deutschen Melodramen darstellt, z. B. in Medea, T. 441ff. (Beispiel 3, T. 262–266). Die genannten Formeln in Orfeo erhalten durch ihre Wiederholung eine erinnerungsmotivische Funktion, womit die Tradition des europäischen Melodrams auch in dieser Hinsicht bestens fortgesetzt ist.[54] / [55] / [56]
Fomin folgt Benda ebenso in allen Fragen der Beziehung zwischen Sprache und Musik. Der russische Komponist probiert hierzu die drei möglichen Varianten systematisch aus: Mal geht der Text der Musik voraus, mal ist er mit der Musik synchron verbunden, mal erscheint er erst nach der Musik.[57] All diese Kombinationen demonstriert Fomin schon im ersten Monolog des Orpheus (Beispiele 2, 3 und 6):
Orpheus:
O meine teuerste Eurydike!
Für Orpheus, dem du genommen bist, erscheint die Welt unerträglich.
Die Hölle hat ihren Schrecken für mich verloren.
In diesen Gebieten lebt die Seele meiner Seele.
O Schicksal! Du beraubtest mich meiner teuersten Gattin durch den Biss einer Schlange.
Mein Geist quält sich in dauerndem Schmerz.
Ich stöhne, leide in Betrübnis und leere den bitteren Kelch der Trennung.
Noch immer sehe ich vor mir die schreckliche Schlange.
Sie dreht sich und zischt.
In ihrem Rachen droht das Gift.
Lauf weg! Rette dein Leben. Zu spät… .Übersetzung: Thomas Weiler
Eine Trillerfigur mit punktiert rhythmisiertem Motiv am Anfang der Szene geht dem Text »Die Hölle hat ihren Schrecken für mich verloren«[58] voran und malt die Schrecken dieser Unterwelt aus. Die nächste Zeile des Textes, »In diesen Gebieten lebt die Seele meiner Seele«,[59] lässt Fomin die Musik erst nach dem gesprochenen Text diesen orchestral kommentieren: Abrupt wechselt die Tonart g-Moll zu B-Dur, weil eine positive Intention angekündigt wurde – »Die Seele lebt«. Dies fällt aber sofort zur Schicksal-Schlangen-Motivik nach g-Moll zurück, noch bevor im folgenden Text mitgeteilt wird, dass die Gattin schon entschwunden sei. Ab T. 262 setzt Fomin sowohl musikalisch als auch verbal längere Sätze ein, womit er mehr Zeit für die Reflexion eines neuen Zustandes gewinnt, nun den des Leides. Die Seufzerfigur umrahmt Orpheus’ Repliken, T. 265. Diese Statik schließt an den rasch alternierenden Wort-Ton-Wechsel zwischen dem Orchester und Orpheus an, T. 266–270: Orpheus schildert, was geschehen ist, und bringt dies in die Gegenwart: »Noch immer sehe ich vor mir eine schreckliche Schlange!«[60] Weiterhin fallen Text und Musik zusammen: »Lauf weg! Rette in Dir mein Leben. Aber spät…«.[61] Im Orchester erklingt eine der schönsten Melodien Fomins, geflochten aus expressiven Sekundvorhalten, T. 271–272. In dieser geschlossenen musikalischen Phrase gebührt dann einmal die ungeteilte Aufmerksamkeit der Musik. Ähnlichkeiten der melodramatischen Techniken von Benda und Fomin zeigen sich ferner im Zusammenhang zwischen der Ouvertüre, dem abschließenden Tanz der Furien und dem melodramatischen Teil. Die ›Furien-Motivik‹ bildet den Stoff für die umrahmenden instrumentalen Sätze. Die gerade beschriebene seufzende Melodie steht zum ersten Mal schon in der Ouvertüre ab T. 87.
Dass Fomin das melodramatische Vokabular und die melodramatische Technik aus Bendas Melodramen so deutlich wiedererkennbar übernommen hat, widerspricht der von der russischen Forschung vehement vertretenen Behauptung, der Komponist habe ganz exakt die spezifischen Intonationen der russischen Sprache in der Musik umgesetzt. Bei Orfeo handelt es sich nicht darum, sondern um eine Darstellung von Affekten mit Mitteln, die so oder so ähnlich in ganz Europa in Gebrauch waren. Nicht die konkrete (russische) Sprache spielte eine Rolle, sondern die verallgemeinerte Bedeutung des Wortes und die Tradition ihrer Vertonung. Ob der Text des Melodrams dann auf Russisch, Deutsch oder Französisch aufgeführt würde, wäre letzten Endes nebensächlich. Auch die These, dass Fomin eine besondere psychische Spannung entwickelt habe, ist nur mit Blick auf die Affektinhalte korrekt. Die nicht russische Grundlage der ›Musik zur Sprache‹ in Fomins Melodram bestätigt sich auch dadurch, dass sich das Melodram von früheren, mehr folkloristischen Kompositionen Fomins deutlich unterscheidet, etwa von der Oper Jamščiki na podstave.
Durch die Objektivierung des Ausdrucks ging Fomin jedoch weiter als in anderen damals in Russland aufgeführten Melodramen. Und hier lag seine Innovation und das, was sich schließlich als für Russland als ›neu‹ bezeichnen lässt. Fomin entwickelte zwei Methoden in der Gestaltung des Melodrams: Er komponierte opernhafte Nummern, wie der dramatische Text sie verlangte, und er fügte geschlossene Orchestersätze ein, die einen Affektzustand ausdrückten, in der Textvorlage aber nicht vorgesehen waren. Die ›Opernnummern‹ versuchte Fomin zugleich der Gattung des Melodrams anzupassen. Orpheus’ Gesang zur Lyra vermittelt er durch eine typische Belcanto-Arie, in der freilich die Funktion der gesungenen Stimme von der Klarinette übernommen wird (T. 390ff.). Diese wortlose Arie stellt einen geschlossenen und rein musikalischen, statischen Ruhepunkt dar. Im Dialog zwischen Orpheus und Eurydike (T. 558–604) sind sowohl ariose als auch rezitativische Passus verflochten, stets in erfindungsreichen Kombinationen und plastisch in den Text integriert. Die Szene beginnt mit einem deklamierten Dialog – die erste Begegnung von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt –, den eine zweite Klarinetten-Arie harmonisch fortsetzt. Der nächste Dialog (T. 567–578) wandelt sich zum Recitativo accompagnato mit anschließender Wiederholung der zweiten Klarinetten-Arie, T. 579–586. Sie geht in einen letzten Dialog von Orpheus und Eurydike über, der ebenso wie am Anfang der Szene ohne Musik gesprochen wird. Der abschließende Satz ist ein neues Recitativo accompagnato, diesmal ohne instrumentale Arie, in T. 588–604. Die Annäherung an die opera seria bezeugt sich überdies dadurch, dass Fomin das letzte Rezitativ in der Tat als Recitativo überschrieb.[62] Die Deklamation blieb aber unrhythmisiert.
Die Nummernstruktur des Melodrams offenbart sich auch durch drei ähnliche Chöre, T. 296ff., T. 494ff. und T. 630ff. Fomin folgte hierbei abermals den dramatischen Text-Intentionen: Er nutzte also die Leitlinie des Melodrams einer experimentellen ›Wiederbelebung‹ der antiken Tragödie für eine musikalische Reminiszenz an die nach ihrer Funktion überpersönlichen Chöre. Musikalisch gestaltete er dies mit einem skandierenden einstimmigen Gesang der Bässe, der einen streng rhythmisierten Text markant hervorhebt.
Chor:
Sei voll der Hoffnung!
Übersetzung: Thomas Weiler
Eine andere Strategie, nämlich diejenige, semantisch prägnante und vom gesprochenen Text unabhängige Sätze einzufügen, zeigt sich in den ersten musikalischen Vorstellungen der Figuren Orpheus und Eurydike. Ihre musikalische Charakterisierung erfolgt ganz in der Manier einer Oper durch einen geschlossenen Orchestersatz vor dem jeweils ersten Auftritt. Orpheus’ erstes Erscheinen wird durch ein galantes Menuett markiert, T. 228–247. Eurydikes Auftritt geht ein zärtlicher geradtaktiger Tanz voraus, T. 530–557. Auch die Lamento-Sphäre bekommt eine zusätzliche Charakteristik durch die eingefügten stilistisch geschlossenen Abschnitte, so in der Einleitung der Ouvertüre mit seufzenden Sekundvorhalten über dem gemäßigt schreitenden Passus duriusculus-Bass. Eine Reminiszenz an den Trauersatz des 17. Jahrhunderts ist durch einen Orchesterkommentar zur seelischen Qual Orpheus’ nach seinem Klarinettenlied mit Lyra gegeben, T. 450–459.
Wenn Fomins Melodram im Bereich der ›Musik zur Sprache‹ also vollkommen europäisch bleibt, fuhr er in der formalen Gestaltung der Komposition durch die klare Nummernstruktur im Fahrwasser der russischen Theatertraditionen. Neu war, dass Fomin diese Nummern formelhaft mittels europäischer Stilistik darbot und dadurch ein Amalgam aus Prinzipien des russischen Theaters (ins Drama eingelegte Musiknummern), europäischen Praxen (Opernarien und -rezitative) und den ersten europäischen Melodramen (ohne Gesang) schuf. Die russische Sprache bildete also zwar ›eine‹, aber nicht die bestimmende Ebene dieser musikdramatischen Mischform. Dass die Musik und die russische Sprache nicht im direkten Zusammenhang standen, lassen schon die Überschriften im Autograph der Orfeus-Partitur vermuten. Auf die erste Seite der Ouvertüre schrieb Fomin: »Originale. Orfeo и Euridica Melo-Dramma; Posto in Musica da – E. I. Fomine Acade: Filarmonico à Pietro-borgo 1791 [korrigiert zu 1792]«.[63] Am Anfang der eigentlichen melodramatischen Handlung ist der Titel leicht verändert: »Originale. Orfeo Melo-dramma. Posto in musica da Eus. I. Fomine. Academico Filarmonico à Pietro-borgo 1792«.[64] Vor Eurydikes ersten Auftritt setzte Fomin den Titel ein drittes Mal: »Originale. Orfeo Melo-Dramma. Parte seconda«.[65] Insofern im melodramatischen Teil Fomins Überschriften einander ähnlicher sind als zu der Variante vor der Ouvertüre (Orfeo Melo-Dramma und nicht Orfeo i Euridica Melo-Dramma), insofern weiters im Titel der Ouvertüre auch eine Korrektur des Entstehungsjahres steht, lässt sich vermuten, dass Fomin die nur musikalischen und die dramatischen Teile nicht zu gleicher Zeit komponiert oder zumindest als nicht gleichberechtigte Komponenten der Komposition betrachtet haben könnte. Dass Musik- und Text-Ebene nicht als Synthese wahrgenommen, zugleich jedoch durch musikalische und textliche Affektformeln gut vermittelt wurden, sicherte den Erfolg von Fomins Melodram im 18. Jahrhundert und bis in die heutige Zeit.[66]
III.
Giuseppe Sartis Melodram Euripides’ Alkestis (1790) war eines der abenteuerlichsten Unternehmen in der Geschichte des russischen Theaters. Der Auftrag ging von Katharina II. aus. Die Zarin benötigte Musik zu eigenen Texten, die sie als eine Historische Handlung zu Načalnoe upravlenie Olega, podražanie Shakespeary bez sochranenija teatral’nych obyknovenych pravil / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ (Anfang der Regierung von Oleg, Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnlichen Theaterregeln zu bewahren) bezeichnet hatte. Es handelte sich dabei um eine eklektische Zusammenfassung von Ereignissen aus der Geschichte der russischen Großfürsten Oleg († 912/922), Igor († 945) und Großfürstin Olga (nach 900–969), die in einen Ausschnitt aus Euripides’ Tragödie Alkestis mündete. Die Szene aus der griechischen Tragödie stellte dabei ein Theater im Theater dar: Fürst Oleg wohnte in Konstantinopel einer Aufführung der Alkestis auf einer eigens für ihn eingerichteten Theaterbühne bei.[67]
Die Musik dazu sollten drei verschiedene Komponisten liefern: Carlo Canobbio (1741–1822), Vasili Paškevič (1742–1797) und Giuseppe Sarti, der für den Part zu Euripides’ Alkestis verantwortlich war. Von ihm wurde eine griechische Tragödie mit »Musik im griechischen Geschmack« bestellt, für die er griechische Modi verwenden und Chöre komponieren sollte.[68] In dieser Forderung wurzelte der Zwiespalt des russischen Melodrams, der dann auch Fomins Orfeo bestimmen sollte: Das ästhetische Experiment der Wiederbelebung der antiken Tragödie eröffnete einen Spielraum für Experimente im Bereich der modischen Gattung des Melodrams. Sarti verwies man auf die gängigen Modelle von Rousseau und Benda. Der Anspruch der Verfasserin des Textes, sie wolle »schöne Chöre« bekommen, bedeutete jedoch, dem damaligen Geschmack angepasste musikalische Nummern zusätzlich einzuarbeiten. Dass Sarti kein Russisch sprach, machte die Aufgabe noch schwieriger. Man konnte gewiss nicht davon ausgehen, dass er ›Musik zur Sprache‹ entwickeln würde.

Giuseppe Sarti (1729–1802). Originally from fr.wikipedia. Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons.
Sarti schuf ein Hybrid, das alle Beteiligten befriedigen sollte. Ein melodramatischer Abschnitt eröffnet die Tragödie, in dem freie Monologe von Heracles und Dialoge zwischen Heracles und Admetus mit instrumentalen Zwischenspielen und Chorrepliken abwechseln. Der Chor fungiert als überpersönliche Stimme, die – wie im Orfeo – unisono singt, aber im Unterschied zu Fomins Melodram Recitativi accompagnati bildet:[69]
Der melodramatische Teil mündet in vier Chöre mit den griechischen Bezeichnungen »Strophe« – »Antistrophe«. Sie sind freilich nichts anderes als vier Coro unisono gesungenen Arien. Melodramatische Affektformeln sind selten. Immerhin setzte Sarti die »wilden Löwen« und »das Wilde« durch aufsteigende Zweiunddreißigstelläufe und dynamische Kontraste musikalisch um, so in T. 15–18 in der ersten Antistrophe. Die Waagschale der gattungsstilistischen Einordnung neigt sich damit eher auf die Seite der Oper, freilich mit durchaus eigentümlicher Interpretation der Chorpartie.

Beispiel 9a (Sarti, Euripides’ Alkestis, erste Antistrophe, Anfang des ersten und zweiten Abschnitts: Beginn)

Beispiel 9b (Sarti, Euripides’ Alkestis, erste Antistrophe, Anfang des ersten und zweiten Abschnitts: Fortsetzung)
Mithilfe von Nachahmung der griechischen Instrumente und Modi versuchte Sarti den melodramatischen Eindruck und seinen Bezug auf die Kunst der Griechen anzudeuten. Zur Erinnerung an antikes Instrumentarium fügte er Einsätze der Harfe, Violini pizzicato und der Flöte ein. Schwieriger war es, die Musik ›in griechischer Manier‹ anhand der im dramatischen Text en detail vorgegebenen »Modo Dorio«, »Modo Hypo-Jonio«, »Modo Hypo-Dorio« und »Modo Phrygio« auszuführen. Letzten Endes blieb Sartis Musik durmolltonal. Dass seine Umsetzung dieser Forderung ausgesprochen spekulativ war, ahnte er offensichtlich selbst. So verfasste er eine spezielle theoretische Erklärung zu Euripides’ Alkestis, in der er ausführte, wie er die Grundlagen der Wiederbelebung des antiken Dramas interpretiert habe.[70] Diese Erklärung wurde ins Russische übersetzt und im Libretto abgedruckt. Sarti versuchte das Publikum selbstbewusst von nichts weniger zu überzeugen als dass die von ihm komponierte Musik »absolut griechisch« sei. Sie müsse in moderner Manier so bearbeitet werden, dass die Zuhörer sie leicht verstünden. Dafür nutze er die gewöhnliche Harmonik:
»Die Handlung aus Euripides sollte nach ihrem Ort und Charakter im altgriechischen Geschmack dargestellt werden, die Musik sollte daher in dieser Manier sein. Infolgedessen habe ich eine absolut griechische Musik zum Gesang komponiert, deren Begleitung jedoch in der Art jetziger Harmonien gestaltet«.[71]
Auch hinsichtlich der anderen Komponenten verfiel Sarti in theoretische Diskussionen mit dem Ziel, seine zur Oper tendierte Komposition als Drama abzusichern. Nach Sarti sollten die Rezitative als »griechische Deklamation« wahrgenommen werden, auch wenn sie eigentlich »eine Art des Rezitativs« anboten.[72] Die Harfen-, Pizzicato- und Flöten-Klänge seien Nachahmungen von Lyra und Tibia. Die Modi müsse man durch die Affekte, die die Musik Sartis beinhalte, erkennen können. Falls die griechischen Merkmale dann doch nicht erfasst würden, müsse der Zuhörer sich eben selbst die Schuld geben.[73]
Die Historische Handlung wurde prachtvoll inszeniert und hatte laut einem Schreiben von Katharina II. an den Fürsten Potëmkin einen grandiosen Erfolg.[74] Historisch zeitigte Sartis Komposition von Euripides’ Alkestis für das russische Melodram Folgen. Seine Apologie verbreitete die ersten auf Russisch niedergelegten Grundzüge einer Theorie des Melodrams in den russischsprachigen Raum. Als große Aktion des Hoftheaters war Euripides’ Alkestis auch in dem Sinne signifikant, dass sie die Trias ›griechische Musik‹ – ›Drama‹ – ›heutige Musik‹ in der russischen Kunst etablierte. Fomin brauchte auf dieser Grundlage auf die griechische Kunst schon nicht mehr so präzise zu rekurrieren wie Sarti. Er hat alle von Sarti künstlich einbezogenen Elemente reduziert und nur den Coro unisono gelassen. Auch die musikalisch-dramatische Mischform aus Oper und Melodram erwies sich für die Zukunft als nützlich, die dann Fomin übernommen und deutlich überarbeitet hat. Dieser Komplex von Merkmalen bildet Eigenschaften der ersten in Russland entstandenen Melodramen.
Anmerkungen und Nachweise
[1] »новую русскую оперу«: Алексей В. Финагин, Евст. Фомин. Жизнь и творчество, в: Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования, Т. 1, Ленинград 1927, С. 87. (Aleksej V. Finagin, Evst. Fomin. Leben und Werk, in: Musik und musikalischer Alltag im alten Russland. Materialien und Untersuchungen, Bd. 1, Leningrad 1927, S. 87).
[2] Finagin, Musik und musikalischer Alltag; Николай Ф. Финдейзен, Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века, Т. 2, Вып. V/VI, Москва 1928/29 (Nikolaj F. Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland von der älteren Zeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, Bd. 2, Teile V/VI, Moskau 1928/29); Александр С. Рабинович, Русская опера до Глинки, Москва 1948 (Aleksandr S. Rabinovič, Die russische Oper vor Glinka, Moskau 1948). – Die von diesen Forschern zusammengefassten Daten aus dem Lebenslauf Fomins bilden bis heute den Wissenstand über den Komponist, hierzu siehe Sigfrid Neef, Fomin, in: MGG2, Bd. 6, Kassel 2001, Sp. 1415–1417; vgl. Juri W. Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater des 18. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Musikwissenschaft 9, 3/4 (1967), S. 305–316. Evstignej Ipat’evič Fomin (1761–1800), geboren in Sankt Petersburg, studierte von 1767 bis 1782 an der neu gegründeten Kaiserlichen Akademie der Künste (Malerei, Skulptur, Architektur und später Musik). Kurz nach dem Abschluss erhielt er ein dreijähriges staatliches Stipendium für seine Weiterbildung in Bologna bei Giovanni Battista Martini und Stanislao Mattei. Ab 1786 war er als Repetitor und Kapellmeister an den russischen städtischen Theatern und adligen Leibeigenentheatern tätig. Fomin komponierte unter anderem auf Libretti der Zarin Katharina II., was allerdings aus unbekannten Gründen zur Ungnade der Zarin und Komplikationen am Hof geführt hat. Fomin bekam eine offizielle Anstellung am Hoftheater erst 1797 bei Paul I. Mit 39 Jahren starb er unter ebenso unbekannten Ursachen in Armut. Fomin komponierte etliche Oper, ein Melodram, einzelne Chöre und ein geistliches Chorkonzert. Außerdem hat er offensichtlich Opern anderer Komponisten redigiert. Der größere Teil vom Fomins Schaffen galt schon im frühen 20. Jahrhundert als verloren oder nur partiell überliefert. Die Anzahl der Werke variierte sich von einem Forscher zum anderen: zehn Kompositionen, unter denen fünf erhalten blieben (Finagin, Musik und musikalischer Alltag, S. 98); neun Stücke mit vier vollständig erhaltenen Partituren (Борис В. Доброхотов, Евстигней Фомин, Москва 1968, С. 98–99 / Boris V. Dobrochotov, Evstignej Fomin, Moskau 1968, S. 98f.); »30 musikalisch-dramatischen Werke verschiedener Art« (Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 306). Heute ist die Meinung verbreitet, dass Fomin sieben Oper schrieb, von denen drei rekonstruiert werden konnten (Neef, Fomin, Sp. 1417):
- Новгородский богатырь Боеслаевич / Novgorodskij bogatyr’ Boeslaevič (Der Novgoroder Held Boeslaevič), komische Oper, zusammengestellt aus russischen Märchen, Liedern und anderen Quellen, 1786 (erhalten nur Orchesterstimmen);
- Ямщики на подставе / Jamščiki na podstave (Die Kutscher auf der Poststation), improvisiertes Spiel, komische Oper, 1787;
- Американцы / Amerikancy (Die Amerikaner), komische Oper, 1787/88;
- Вечеринки, или Гадай, гадай, девица / Večerinki ili Gadaj, gadaj, devica, otgadyvaj, krasnaja (Abendgesellschaften oder Lege die Karten, wahrsage, Mädchen, enträtsel dein Schicksal, Schöne), 1788 (Musik verloren);
- Золотое яблоко / Zolotoe jabloko (Der goldene Apfel), komische Oper mit Chören und Balletten, 1788/89 (fragmentarisch erhalten);
- Колдун, ворожея и сваха / Koldun, vorožeja i svacha (Zauberer, Hexe und Heiratsvermittlerin), 1789 (Musik verloren);
- Орфей / Orfej (Orpheus, Melodram 1791/92);
- ein Chor zur Tragödie Владисан / Vladizan, 1795 (verloren);
- ein Chor zur Tragödie Ярополк и Олег / Jaropolk i Oleg (Jaropolk und Oleg), 1798.
[3] »в ›Орфее‹ мы видим удачный опыт написать серьезную музыку типа Глюка«: Finagin, Evst. Fomin, S. 103.
[4] Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 105.
[5] »лучшее ›российское сочинение‹ Фомина«: ebd., S. 37.
[6] Ebd., S. 37ff. – Vgl. auch Finagin, Evst. Fomin, S. 98ff.; Юрий В. Келдыш, Очерки и иследования по истории русской музыки, Москва 1978, С. 130–140 (Juri W. Keldysch, Essays und Untersuchungen über die Geschichte der russischen Musik, Moskau 1978, S. 130–140).
[7] »первая русская мелодрама«: Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 75.
[8] »внутренняя связь ›Орфея‹ Фомина с русским трагическим театром XVIII века«; ebd., S. 76.
[9] ›Волнодумцев‹ / ›Volnodumzev‹
[10] In einer der letzten Tragödien Вадим Новгородский / Vadim Novgorodski protestierte Knjažnin ganz offen gegen zaristische Macht. Alle Exemplare der Tragödie wurden vernichten und Knjažnin selbst wurde 1791 ermordet, Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 71.
[11] Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 70ff.; vgl. Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 310; Neef, Fomin, Sp. 1416.
[12] Ebd., Sp. 1416.
[13] Dobrochotovs Anmerkungen, wie etwa »›Orpfeo‹ von Fomin gibt uns die Möglichkeit, tatsächlich ein russisches theatralisches Gespräch zu hören«, blieben ohne Erklärungen. (»›Орфей‹ Фомина дает возможность реально услышать русскую театральную речь XVIII века«: Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 76.)
[14] »симфонический характер [мелодрамы Фомина] […] приближает ›Орфея‹ к жанру программной симфонической поэмы«: ebd., S. 77; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 314. Hierbei handelte es sich um eine der Leitthemen der sowjetischen Musikwissenschaft – symphonisches Denken in der Instrumentalmusik.
[15] »Это [›Орфей‹ Фомина] лучший образец русского драматического симфонизма доглинкинского времени«: Георгий К. Абрамовский, Русская опера XVIII века, Москава 1968, С. 27. (Georgi K. Abramovski, Die russische Oper des 18. Jahrhunderts, Moskau 1968, S. 27).
[16] Stattdessen gab z. B. Keldysch eine allgemeine historische Auskunft zum Melodram in Deutschland im 18. Jahrhundert: Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307ff. Kurze historische Exkurse sind in den Geschichten der russischen Oper im 18. Jahrhundert vorhanden, siehe z. B. Abramovski, Russische Oper, S. 23 und 26.
[17] Siehe etwa Abramovski, Russische Oper, S. 23; Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 137.
[18] Юрий В. Келдыш, История русской музыки, Вып. 1, Москва 1990, С. 204сл. (Juri V. Keldysch, Geschichte der russischen Musik, Bd. 1, Moskau 1990, S. 204ff.).
[19] Татьяна В. Ильина, Мария Н. Щербакова, Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка, Москва 2004, С. 349сл. (Tat’jana V. Il’ina, Maria N. Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert: Darstellende Kunst und Musik, Moskau 2004, S. 349ff.)
[20] Ebd., S. 468ff.
[21] Siehe hierzu Neef, Fomin, Sp. 1415–1418; Marc Mühlbach, Russische Musikgeschichte im Überblick. Ein Handbuch, 1. Aufl., Berlin 2004, S. 41f.
[22] Marina Ritzarev, Eighteenth-Century Russian Music, Cornwall 2006, S. 199ff.; Inna Naroditskaya, Bewitching Russian Opera. The Tsarina from State to Stage, New York 2012, S. 113ff.
[23] Richard Taruskin, Fomin, Yevstigney Ipat’yevich, in: NGroveD, Bd. 9, London 2001, S. 71.
[24] Diese Stücke werden in der Bibliothek Accademia Filarmonica Bologna aufbewahrt. Es handelt sich um Fugues (RISM: http://opac.rism.info/search?documentid=850016616) und eine Antiphon Joannes et Paulus agnoscentes (RISM: http://opac.rism.info/search?documentid=850016615).
[25] Diese Informationen bestätigte mir auch Pavel Serbin, Direktor und Dirigent des Pratum integrum Orchestra, der 2009 eine Aufnahme von Orfeo durchgeführt hat, CD CM 0012008.
[26] Евстигней Фомин, Орфей, ред. Борис Доброхотов, Москва 1953.
[27] MPP / 4 Fom 1.
[28] Wertvolle Quelleninformationen aus dem 18. Jahrhundert gab der deutsche Gelehrte, Chronist und Sammler Jakob von Stählin (1709–1785). Er war an der Petersburger Akademie der Wissenschaften tätig. Dort oblag ihm die Katalogisierung und Verwaltung der höfischen Bibliotheken und Kunstsammlungen sowie die Erziehung von Peter III. Stählin übernahm die Redaktion der seit 1727 bei der Petersburger Akademie der Wissenschaften erschienenen St. Petersburger Zeitung, in welcher er das zeitgenössische Geschehen im russischen Theater schilderte. Dank dieser Beiträge entstanden die ersten Versuche, die Geschichte des russischen Theaters zu schildern. Hierzu Ernst Stöckl, Nachwort, in: Jakob von Stählin, Zur Geschichte des Theaters in Russland. Nachrichten von der Tanzkunst und Balletten in Russland. Nachrichten von der Musik in Russland, Leipzig 1982, S. I–XX. Zur ausführlichen Geschichte der ausländischen Entreprise in Russland siehe auch Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 112ff. und 206ff.; Aloys Mooser, Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siècle, T. II, Mont-Blanc 1953; Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 932ff. Zur Geschichte des Deutschen Theaters in Russland siehe Denis Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, 1. Aufl., Lage-Hörste 2003. Eine kurze Zusammenfassung gibt die Russische Musikgeschichte von Mühlbach, S. 28–39.
[29] Die Entscheidung, nach Russland zu kommen, wurde sicherlich durch gute Honorare motiviert. Baldassare Galuppi (in Petersburg von 1764 bis 1768) wurde mit einem Jahresgehalt von 4.000 Rublej angestellt, hierzu Findeisein, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 123. Zum Vergleich: Fomins Jahresgehalt betrug 1797 nur 600 Rublej, siehe Neef, Fomin, Sp. 1416.
[30] Hierzu Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, S. 34. Die deutsche Sprache war am russischen Hof schon vor der Regierungszeit Katharinas II. beliebt gewesen. Zu den Aufgaben von Stählin bei Zarin Anna Ivanovna (1730–1740) und ihrer Nachfolgerin Elizaveta Petrovna (1741–1761) gehörte, italienische Komödien, Opern und Intermezzi ins Deutsche zu übersetzen. Die Texte wurden zusammen mit den originalen italienischen Fassungen bei Hofe verteilt. Die St. Petersburger Zeitung erschien in deutscher Sprache mit einer russischen Übersetzung, hierzu Stöckl, Nachwort, S. Vf.
[31] Hierzu Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 213ff.
[32] Ebd., S. 95 und 213. Ein früheres Beispiel ist Arajas Cefallus und Prokris, dessen Libretto von Aleksandr P. Symarokov / Александр П. Сумароков stammt (1755).
[33] Ebd., S. 214ff.
[34] »трагедия в трех действиях вольными стихами с хорами и балетами к ней принадлежащими«, siehe Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 169–170ff.; Abramovski, Russische Oper, S. 6ff.
[35] »драма с балетом«: hierzu Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 470.
[36] »драма в двух действиях, с хорами, в прозе«: ebd.
[37] Ebd. und Abramovski, Russische Oper, S. 6.
[38] Die ersten russischen Opern mit Volkslieder sind Mel’nik / Мельник (Der Müller) von Sokolovski (1785), Sankt-Petersburgski gostinuj dvor / Санкт-Петербургский гостинный двор (Der Petersburger Gasthof) von Matinski (1779) und Fevej / Февей, Fedul s det’mi / Федул с детьми (Fedul mit Kindern) von Paškevič (1786, 1791). Hierzu Dieter Lehmann, Russlands Oper und Singspiel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1958.
[39] Keldysch, Geschichte der russischen Musik, S. 205ff.
[40] Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 308, Anm. 13.
[41] Wolfgang Schimpf, Lyrisches Theater. Das Melodrama des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1988, S. 21.
[42] Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, S. 31.
[43] Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 309.
[44] Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 107.
[45] Von diesem Melodram sind nur Orchesterstimmen erhalten geblieben. Sie werden in der Zentralen Nationalbibliothek Petersburg aufbewahrt. Siehe hierzu Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 74, Anm. 2; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307, Anm. 10.
[46] »Сообразно Греческому древнему вкусу«.
[47] Siehe die Beschreibung von originalen Partiturseiten bei Finagin, Musik und musikalischer Alltag, S. 104.
[48] Il’ina Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 481.
[49] Zur Gattung des Melodrams im 18. Jahrhundert siehe Schimpf, Lyrisches Theater; Ulrike Küster, Das Melodrama. Zum ästhetikgeschichtlichen Zusammenhang von Dichtung und Musik im 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main [u. a.] 1994.
[50] »Орфей играет на лире. Фурии показываются«.
[51] Zu den melodramatischen Techniken in Musik und Sprache von Benda siehe Küster, Das Melodrama.
[52] Den gesprochenen Text zu Fomins Orfeo im Beispiel A gebe ich mit einer deutschen Übersetzung von Thomas Weiler aus der Broschüre zur CD CM 0012008: Yevstigney Fomin (1761–1800) · Orfeo ed Euridice, 2009.
[53] Küster, Das Melodrama, S. 239.
[54] Zur Leitmotivik in Bendas Melodramen siehe ebd., S. 216ff.
[55] Jiří Antonín Benda, Medea. Melodram, Praha 1976.
[56] Georg Benda, Ariadne auf Naxos. Ein Duodrama mit musikalischen Zwischensätzen, Klavierauszug, hrsg. von Alfred Einstein, Leipzig 1920.
[57] Zu Bendas Melodramen siehe Küster, Das Melodrama, S. 234ff.
[58] Die Übersetzung ist nicht treffend. Der Text »Мне ада страшные места не дики« lässt sich besser als »Die wilde Gegend der Hölle ist mir nicht fremd« wiedergeben.
[59] »Душа души моей в сих областях живет.«
[60] »Еще, еще я зрю ужасную змею!«
[61] »Беги, спаси в себе ты жизнь мою. Но поздно…«
[62] Siehe hierzu Finagin, Evst. Fomin, S. 104.
[63] Ebd.
[64] Ebd.
[65] Ebd.
[66] Für eine erfolgreiche Aufführung des Orfeus spricht eine häufig zitierte Rezension vom 1817: »Im Melodram dieser Oper [Orpheus] war die Musik von Torelli, doch nach unserem russischen Herrn Fomin, der lange Zeit in fremden Ländern weilte, wurde die frühere Musik durch sein ausgezeichnetes Talent völlig verdunkelt, und obwohl er zu unserem allgemeinen Leidwesen aus dem Leben geschieden ist, schuf er sich im Orpheus eine bleibende Erinnerung«: zitiert nach der deutschen Übersetzung in Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307, Anm. 9.
[67] Das Stück sollte die außenpolitischen Ansprüche von Katharina II. auf Konstantinopel widerspiegeln, siehe hierzu Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 248; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 23.
[68] Siehe den Brief von Kathrina II. an den Fürsten Potëmkin vom 3. Dezember 1789: »Lieber Freund, ich bitte Dich gelegentlich daran zu erinnern, Sarti zu befehlen, die Chöre für Oleg zu schreiben; ein Chor von ihm gibt es bei uns und er ist sehr gut, hier können [die Komponisten] so gut nicht komponieren« (»Еще, мой друг, прошу тебя в досужий час вспомнить приказать Сартию сделать хоры для ›Олега‹; один его хор у нас есть и очень хорош, а здесь не умеют так хорошо компонировать«), zitiert nach Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 137.
[69] Die Beispiele zu Euripides’ Alkestis wurden einer Kopie der originalen Ausgabe 1791 entnommen: Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ, Москва у П. Юргенсона, С.-Петерсбургъ у І. Юргенсона, Варшава у Г. Зенневальда, 1791 (Anfang der Regierung von Oleg Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnliche Theaterregeln zu bewahren, Moskau bei P. Jurgenson, S.-Petersburg bei I. Jurgenson, Warschau bei G. Zennewald, 1791).
[70] Объясненіе на музыку Господиномъ Сартіемъ сочиненную для Историческаго представления: Начальное управленіе Олега: перевод Николая А. Львова, в: Начальное управленiе Олега, С. 4–6. (Erklärung zur von Herrn Sarti komponierten Musik für die Historische Handlung: Anfang der Regierung von Oleg, Übersetzung von Nikolaj A. L’vov, in: Anfang der Regierung von Oleg, S. 4–6).
[71] »Явленіе изъ Еврипида, по мѣсту и свойству своему, должно быть представлено во вкусѣ древнемъ Греческомъ, а по тому и музыка должна быть въ томъ же вкусѣ; въ слѣдствіе чего и сочинилъ я музыку совершенно Греческую относительно къ пѣнію, сопроводя оную однако по образу нынѣшней Армоніи«: ebd., S. 4.
[72] »Греческая декламація«, »нѣкоторый родъ Речитатива«: ebd.
[73] Ebd., S. 6.
[74] »an Sarti schicke ich mit einem Kurier tausend Červonych [alte Währung in Russland] und ein Geschenk für die Musik zu Oleg. Heute wurde Oleg zum dritten Mal in der Stadt aufgeführt und er [Oleg] hat einen grandiosen Erfolg«: Brief von Katharina II. an den Fürsten Potëmkin vom 1. November 1790 (»к Сартию с сим куръером посылаю за музыку к ›Олегу‹ тысячу червонных и подарок вещь. Сегодня Олега в третий раз представляют в городе, и он имеет величайший успех«), zitiert nach Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 138.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abramovski, Georgi K.: Die russische Oper des 18. Jahrhunderts, Moskau 1968 / Абрамовский, Георгий К.: Русская опера XVIII века, Москава 1968.
Anfang der Regierung von Oleg Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnliche Theaterregeln zu bewahren, Moskau bei P. Jurgenson, S.-Petersburg bei I. Jurgenson, Warschau bei G. Zennewald, 1791. / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ, Москва у П. Юргенсона, С.-Петерсбургъ у І. Юргенсона, Варшава у Г. Зенневальда, 1791. — Darin auch: Erklärung zur von Herrn Sarti komponierten Musik für die Historische Handlung: Anfang der Regierung von Oleg, Übersetzung von Nikolaj A. L’vov, S. 4–6 / Объясненіе на музыку Господиномъ Сартіемъ сочиненную для Историческаго представления: Начальное управленіе Олега: перевод Николая А. Львова, С. 4–6.
Benda, Georg Anton: Ariadne auf Naxos. Ein Duodrama mit musikalischen Zwischensätzen, Klavierauszug, hrsg. von Alfred Einstein, Leipzig 1920.
Benda, Jiří Antonín: Medea. Melodram, Praha 1976.
Dobrochotov, Boris V.: Evstignej Fomin, Moskau 1968 / Доброхотов, Борис В.: Евстигней Фомин, Москва 1968.
Findeisen, Nikolaj F.: Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland von der älteren Zeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, Bd. 2, Teile V/VI, Moskau 1928/29 / Финдейзен, Николай Ф.: Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века, Т. 2, Вып. V/VI, Москва 1928/29.
Finagin, Aleksej V.: Evst. Fomin. Leben und Werk, in: Musik und musikalischer Alltag im alten Russland. Materialien und Untersuchungen, Bd. 1, Leningrad 1927 / Финагин, Алексей В.: Евст. Фомин. Жизнь и творчество, в: Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования, Т. 1, Ленинград 1927.
Fomin, Evstignej: Orfeo, hrsg. von Boris Dobrochotov, Moskau 1953 / Фомин, Евстигней: Орфей, ред. Борис Доброхотов, Москва 1953.
Il’ina, Tat’jana V. und Maria N. Ščerbakova: Russisches 18. Jahrhundert: Darstellende Kunst und Musik, Moskau 2004 / Ильина, Татьяна В. и Мария Н. Щербакова: Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка, Москва 2004.
Keldysch, Juri W.: Essays und Untersuchungen über die Geschichte der russischen Musik, Moskau 1978, S. 130–140 / Келдыш, Юрий В.: Очерки и иследования по истории русской музыки, Москва 1978, С. 130–140.
Keldysch, Juri W.: Fomin und das russische Musiktheater des 18. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Musikwissenschaft 9, 3/4 (1967), S. 305–316.
Keldysch, Juri V.: Geschichte der russischen Musik, Bd. 1, Moskau 1990 / Келдыш, Юрий В.: История русской музыки, Вып. 1, Москва 1990.
Küster, Ulrike: Das Melodrama. Zum ästhetikgeschichtlichen Zusammenhang von Dichtung und Musik im 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main u. a. 1994.
Lehmann, Dieter: Russlands Oper und Singspiel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1958.
Lomtev, Denis: Deutsches Musiktheater in Russland, 1. Aufl., Lage-Hörste 2003.
Mooser, Aloys: Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siècle, T. II, Mont-Blanc 1953.
Mühlbach, Marc: Russische Musikgeschichte im Überblick. Ein Handbuch, 1. Aufl., Berlin 2004.
Naroditskaya, Inna: Bewitching Russian Opera. The Tsarina from State to Stage, New York 2012.
Neef, Sigfrid: Fomin, in: MGG2, Bd. 6, Kassel 2001, Sp. 1415–1417.
Rabinovič, Aleksandr S.: Die russische Oper vor Glinka, Moskau 1948 / Рабинович, Александр С.: Русская опера до Глинки, Москва 1948.
Ritzarev, Marina: Eighteenth-Century Russian Music, Cornwall 2006.
Schimpf, Wolfgang: Lyrisches Theater. Das Melodrama des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1988.
Stöckl, Ernst: Nachwort, in: Jakob von Stählin, Zur Geschichte des Theaters in Russland. Nachrichten von der Tanzkunst und Balletten in Russland. Nachrichten von der Musik in Russland, Leipzig 1982.
Taruskin, Richard: Fomin, Yevstigney Ipat’yevich, in: NGroveD, Bd. 9, London 2001, S. 71.
Elisabeth Sasso-Fruth: Das Melodramma in Italien. Felice Romanis Bearbeitungen des »Romeo und Julia«-Stoffes
Das Melodramma in Italien
Felice Romanis Bearbeitungen des »Romeo und Julia«-Stoffes
Elisabeth Sasso-Fruth (HMT Leipzig)
(Übertragungen sämtlicher italienischer und französischer Texte ins Deutsche: Elisabeth Sasso-Fruth)
Il dramma per musica deve
far piangere, inorridire, morire cantando.
(Vincenzo Bellini)
Das auf das Griechische zurückgehende Wort »Melodram« hat, zum Teil mit mehreren Bedeutungen, in viele europäische Sprachen Eingang gefunden. In einer Bedeutung bezeichnet es in zahlreichen Sprachen, etwa im Deutschen und Französischen, eine Gattung, in der Begleitmusik das gesprochene Wort untermalt. Das Italienische hat hierfür den Begriff melologo. Das Wort melodramma dagegen wird im Italienischen, angefangen bei Jacopo Peri und Claudio Monteverdi, durch die Jahrhunderte hindurch synonym zum Begriff für die Oper, opera (in musica) bzw. opera lirica, in ihren unterschiedlichen Ausprägungen verwendet.
I. Felice Romani
Im deutschen Sprachraum ist der Name Felice Romani (1788–1865) heutzutage nahezu in Vergessenheit geraten. Höchstens in Spezialistenkreisen ist er noch geläufig. Dabei war der gebürtige Genuese der meistgefragte Librettist seiner Zeit und gilt als der »Begründer des romantischen melodramma«.[1] Er arbeitete mit den namhaftesten Komponisten des frühen 19. Jahrhunderts zusammen: mit Rossini, Donizetti, Bellini, Mercadante und vielen mehr.
Seine Schaffensperiode als Librettist umfasste zwar nur gut zwanzig Jahre (von 1813 bis 1834), doch war sie mit ca. 90 Libretti sehr intensiv. Der Mittelpunkt seiner Arbeit als Librettist lag in Mailand (am Teatro alla Scala), wo Felice Romani seit 1814 wohnte. Aber auch in Venedig, Parma etc. gelangten seine Werke zur Aufführung.
Sein Ruhm, aber nicht zuletzt auch das Angebot aus Wien, als kaiserlicher Hofdichter in die Fußstapfen Metastasios zu treten, trugen ihm den Beinamen Metastasio redivivo (der wiedererstandene Metastasio) ein.[2] Felice Romani schlug die Einladung allerdings aus, schließlich wollte er nicht die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen. Doch auch hinsichtlich ihrer Libretti (Stoffwahl, sprachliche Bearbeitung etc.) weisen Metastasio und Romani große Unterschiede auf.
II. Felice Romani und Vincenzo Bellini
Besonders eng gestaltete sich die Beziehung zwischen Felice Romani und Vincenzo Bellini, was sich nicht zuletzt in der Intensität ihrer Zusammenarbeit niederschlug. Ihre Begegnung fällt in das Jahr 1827 in Mailand: Romani galt damals schon als der profilierteste Textdichter Italiens, der aus Sizilien stammende und um 13 Jahre jüngere Bellini dagegen stand noch am Anfang seines Schaffens. Von den acht Opern, die Bellini von da an noch komponieren sollte, stammt bei sieben das Libretto aus der Feder Romanis. Das erste Ergebnis ihrer Zusammenarbeit war Il Pirata, die 1827 an der Scala uraufgeführt wurde.
Wie sehr Bellini die Arbeit Romanis schätzte, geht beispielsweise aus einem Brief an seinen Freund Florimo hervor. Während der Arbeit an La Straniera war Romani erkrankt, so dass Gaetano Rossi als Librettist in Erwägung gezogen wurde. Bellini sah dadurch die Qualität der Oper gefährdet:
[…] [Rossi] mai mai potrebb’essere un verseggiatore come Romani, e specialmente per me che sono molto attaccato alle buone parole; ché vedi dal Pirata come i versi e non le situazioni mi hanno ispirato del genio […] e quindi per me Romani è necessario.
[…] [Rossi] könnte niemals ein so guter Versdichter sein wie Romani, vor allem für mich nicht, der ich doch solchen Wert auf eine gute Sprache lege; Du kannst schon am Pirata sehen, wie mich die Verse, und nicht die Situationen, inspiriert haben […] und so ist für mich Romani unabdingbar.[3]
Über der Arbeit an ihrer letzten gemeinsamen Oper, Beatrice di Tenda, kam es wegen der andauernden unpünktlichen Zuarbeit durch den chronisch überlasteten Romani zum Zerwürfnis mit Bellini. Der Streit war in Mailänder und venezianischen Zeitungen öffentlich ausgetragen worden. Obwohl sich Romani und Bellini nach der wenig erfolgreichen Uraufführung der Oper am 16. März 1833 in Venedig brieflich wieder aussöhnten,[4] kam es zu keiner weiteren Zusammenarbeit mehr. Das Libretto für das Pariser Auftragswerk I Puritani – der letzten Oper Bellinis – verfasste Carlo Pepoli (Uraufführung: 24. Januar 1835, Théâtre Italien, Paris). Im September 1835 starb Bellini in Puteaux bei Paris.
Für Romani war der Streit mit Bellini der Anfang vom Ende seiner Karriere als Librettist. 1834 ging er nach Turin, wo er fortan als Journalist arbeitete (zunächst als Direktor der Gazzetta Ufficiale Piemontese); ab 1836 stellte er seine Arbeit als Librettist vollständig ein.
III. Felice Romanis zweifache Beschäftigung
mit dem »Romeo und Julia«-Stoff
Nach Il pirata (Uraufführung: 27. Oktober 1827, Teatro alla Scala, Mailand), La straniera (Uraufführung: 14. Februar 1829, Teatro alla Scala, Mailand), und Zaira (Uraufführung: 16. Mai 1829, anlässlich der Einweihung des Teatro Ducale, Parma), ist I Capuleti e i Montecchi (Uraufführung: 11. März 1830, Teatro La Fenice, Venedig) die vierte Oper, die auf die Zusammenarbeit Vincenzo Bellinis mit Felice Romani zurückgeht. Später folgten La Sonnambula (Uraufführung: 6. März 1831, Teatro Carcano, Mailand), Norma (Uraufführung: 26. Dezember 1831, Teatro alla Scala, Mailand) und Beatrice di Tenda (Uraufführung: 16. März 1833, Teatro La Fenice, Venedig).[5]
Im Januar 1830 erhielt Bellini vom Teatro La Fenice di Venezia den Auftrag, eine Oper zu komponieren, deren Datum für die Uraufführung in der laufenden Karnevalssaison bereits auf den 11. März 1830 festgesetzt war.[6] Bellini und Romani standen also unter enorm hohen Zeitdruck. So ist es verständlich, dass sie beide für die neue »Romeo und Julia«-Oper, die Bellini dem Impresario der Fenice, Alessandro Lanari, vorgeschlagen hatte, auf schon erarbeitetes Material zurückgreifen: Bellini verwendete teilweise seine Melodien aus Zaira neu, Romani dagegen zog für seine Arbeit sein eigenes Libretto Romeo e Giulietta heran, das 1825 von Nicola Vaccai vertont und unter diesem Titel im Teatro alla Canobbiana in Mailand uraufgeführt worden war. Für Romani war es also innerhalb von fünf Jahren das zweite Mal, dass er sich mit dem »Romeo und Julia«-Stoff beschäftigte. Doch trotz des Rückgriffs auf schon vorhandenes Material sollte etwas Neues entstehen. So schrieb Bellini am 20. Januar 1830 an seinen Freund Florimo:
Il libro, Romani che già jeri è qui giunto, mi scriverà da nuovo Giulietta e Romeo, ma lo titolerà diversamente, e con diverse situazioni.
Das Buch, Giulietta e Romeo, das wird mir Romani, der gestern hier eingetroffen ist, neu schreiben, aber mit einem anderen Titel und anderen Situationen.[7]
So war also schon vor Beginn der Arbeit an der neuen Oper eine weitgehende Neuschöpfung gegenüber dem Vaccai-Libretto intendiert. Obwohl dieses als Grundlage für die neue Oper diente, sollten – mit neuem Titel und neuen Situationen – doch auch wesentlich neue Akzente gesetzt werden.
IV. Neuer Titel, neue Situationen:
Romanis Arbeiten für Vaccai und Bellini im Vergleich
Romanis »Romeo und Julia«-Libretti
vor dem Hintergrund der Stoffgeschichte
und zeitgenössischer Produktionen
Seit seinem Aufkommen in der italienischen Novellistik des 15. Jahrhunderts stieß der Stoff von Romeo und Julia auf großes Interesse seitens der Autoren und des rezipierenden Publikums, welches sich spätestens ab dem 16. Jahrhundert nicht mehr nur auf Italien beschränkte.[8] So sind auch die beiden Bearbeitungen des Stoffes durch Felice Romani als Glieder in einer europaweiten Reihe von Werken zu sehen, die sich mit der Geschichte der beiden Liebenden aus Verona auseinandersetzten.
Im ausgehenden 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren auf italienischen Bühnen mehrere neue Fassungen des »Romeo und Julia«-Stoffes aufgeführt worden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in Zusammenhang mit unserem Thema zunächst die Sprechtheaterfassungen, die auf zwei französischsprachige Autoren zurückgehen. Das Stück von Jean-François Ducis, Roméo et Juliette, tragédie imitée de l’Anglais (1772), wurde mindestens zweimal ins Italienische übersetzt.[9] Von der Tragödie von Louis-Sébastien Mercier, Les Tombeaux de Vérone, drame en 5 actes (1782), liegen ebenfalls mindestens zwei italienischsprachige Versionen vor.[10] Beide Stücke erfreuten sich in ihren italienischen Fassungen beim italienischsprachigen Publikum großer Beliebtheit und sollten, wie später zu zeigen sein wird, auch auf Romanis Schaffen Einfluss nehmen.
Obwohl Ducis im Untertitel seines Stückes darauf verweist, dass sich sein Werk an englischsprachigen Vorbildern orientiert, ist seine Tragödie nicht in der Tradition William Shakespeares zu sehen, der mit seiner Bearbeitung des »Romeo und Julia«-Stoffes im Jahr 1595 maßgebliche neue Akzente weit über den englischen Sprachraum hinaus gesetzt hatte. Während bei Shakespeare die Kerngeschichte um die beiden Titelhelden durch zahlreiche Nebenhandlungen mit durchaus auch komischen Zügen angereichert wird – was eine beträchtliche Erhöhung der Zahl der dramatis personae[11] gegenüber Vorläufermodellen zur Folge hatte –, reduziert Ducis die Handlung wieder auf ihre wesentlichen Momente und kommt so mit entsprechend wenigen Personen aus. Mercier folgt diesbezüglich dem Beispiel von Ducis. Auch bei ihm ist die Anzahl der Figuren gering gehalten, die Handlung konzentriert sich auf ihre wesentlichen Momente. Eine weitere, den beiden französischen Dramen gemeinsame Abweichung gegenüber Shakespeare besteht darin, dass sich in beiden die Handlung um eine ›Nebenfigur‹ zentriert: Bei Ducis steht Romeos Vater im Mittelpunkt,[12] bei Mercier dagegen Benvoglio, der als Arzt und Mitwisser um die Liebe der beiden Protagonisten die Funktion des namentlich seit der Novelle Luigi da Portos als Pater Lorenzo eingeführten Mönches übernimmt, auf dessen Initiative der Rettungsversuch für die Liebe Romeos und Julias zurückgeht.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten setzen die beiden französischen Sprechtheaterstücke aber durchaus auch unterschiedliche Akzente: so erfährt bei Ducis der Stoff eine deutliche Politisierung, der Streit der Familien wird bei ihm in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen Guelfen und Ghibellinen im Italien des 13. Jahrhunderts gebracht.[13] Eine Einbettung des Konfliktes in einen historischen politischen Kontext ist dagegen bei Shakespeare nicht intendiert, vielmehr unterstreicht dieser im Prologsonett mit dem Begriff mutiny die Belanglosigkeit des Anlasses für den Streit zwischen Capuleti und Montecchi.[14] Auch bei Mercier wird der Konflikt der beiden Häuser nicht vor dem Hintergrund des politischen Geschehens gesehen. Eine Besonderheit des Dramas Merciers liegt dagegen im glücklichen Ausgang, den der düstere Titel zunächst nicht suggeriert. Die zentrale Figur, der moralisierende Menschenfreund Benvoglio, überzeugt nicht nur die Familienoberhäupter, in die Heirat ihrer Kinder einzuwilligen, er wird darüber hinaus auch zum Garanten eines stabilen Friedens zwischen beiden Häusern.[15] Bei Ducis dagegen endet die Geschichte tragisch mit dem Tod der beiden Protagonisten. Trotz auch voneinander abweichender Akzentuierungen lässt sich also festhalten, dass sich das französische Sprechtheater des ausgehenden 18. Jahrhunderts, das um die Jahrhundertwende in Italien rezipiert wird, insgesamt von Shakespeare distanziert und auf Traditionen rückbesinnt, wie sie die italienische Novellistik schon vorgezeichnet hatte (Kernhandlung, reduzierte Anzahl von Figuren).
Doch nicht nur die Bühnen der Sprechtheater bekundeten um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert ihr Interesse am »Romeo und Julia«-Stoff, vielmehr datieren aus dieser Zeit auch die ersten Adaptionen für die Bühnen des Musiktheaters. Den Auftakt hierzu bildete das fünfaktige Ballett Giulietta, [sic!] e Romeo. Ballo tragico-pantomimo von Filippo Beretti nach Musik von Luigi Marescalchi (Uraufführung im Frühjahr 1785, Nuovo Regio-Ducal Teatro, Mantua).[16] Elf Jahre später, am 30. Januar 1796, fand an der Scala von Mailand die Uraufführung der Oper Giulietta e Romeo statt, die Nicola Zingarelli, der spätere Lehrer von Vincenzo Bellini am Konservatorium von Neapel, auf das Libretto von Giuseppe Maria Foppa komponiert hatte.[17]
Die folgende Synopsis zu Titel und Personenzahl insgesamt sowie die vergleichende Auflistung der einzelnen Personen geben Aufschluss, wie sehr im Opernlibretto Giuseppe Maria Foppas und den beiden Versionen Felice Romanis für Vaccai und Bellini die Stoffbearbeitungen, die auf das französischen Sprechtheater, insbesondere auf Mercier,[18] zurückgehen, nachwirken bzw. wo die Opernlibrettisten dieser Tradition gegenüber neue Akzente setzen.
Synopse zu Titeln und Personen in Sprech- und Musiktheater-Libretti
des »Romeo und Julia«-Stoffes
am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
(Die gleiche Tabelle als PDF.)
Titel
Die Titel führen, wie schon fast immer in der älteren Tradition sowie auch bei Shakespeare und Ducis, zumeist die Namen der beiden Liebenden. Wie bereits erwähnt, setzt Mercier mit seinem Titel Les Tombeaux de Vérone (Die Grabmale von Verona) einen düsteren Akzent, den er aber durch das lieto fine am Schluss überraschend konterkariert. So stellte sich bezüglich seines Stückes auch schnell die Gattungsfrage.[19] Romani beschreitet mit seinem Titel für das Vaccai-Libretto (im Folgenden: FR I) zunächst den Pfad der Tradition. Dagegen signalisiert er mit dem neuen Titel für das Bellini-Libretto (im Folgenden: FR II), dass der Opernbesucher etwas Neues gegenüber seiner Erstfassung des Stoffes von 1825 zu erwarten habe. – Die Namen der beiden Familien gehen auf den sechsten Gesang des Purgatorio der Divina Commedia (Verse 106–108) von Dante Alighieri[20] zurück, doch finden sich bei Dante keine Hinweis auf die Geschichte der beiden Liebenden,[21] mit der diese Namen später[22] verbunden wurden. Auch eine Verbindung zu dem Konflikt zwischen Ghibellinen und Guelfen wird von Dante nicht ausdrücklich hergestellt,[23] sie liegt nur insofern nahe, als dieser Canto insgesamt stark auf zeitpolitische Geschehnisse Bezug nimmt. Vor dem Hintergrund, dass Ducis aber Julias Familie, die Capuleti, und die von Romeo, die Montecchi, den unterschiedlichen politischen Lagern im Italien des 13. Jahrhunderts zugeordnet hatte – was dem italienischen Publikum im frühen 19. Jahrhundert noch präsent gewesen sein dürfte –, gewinnt die Neubetitelung durch Romani an Brisanz, evoziert sie doch mit den beiden Familiennamen sogleich den politischen Hintergrund des Italien des 13. Jahrhunderts. Dieser war zwar auch schon bei FR I klar gegeben, doch ist der Handlungsstrang der Liebe von Romeo und Julia mit dem der politisch bedingten Fehde zwischen den Guelfen (Capuleti) und den Ghibellinen (Montecchi) in FR II vom Beginn der Oper an konsequenter und geschickter verwoben.[24]
Gesamtzahl der Personen
Vom französischen Sprechtheater hin zu FR II ist eine Reduzierung der Gesamtzahl der Personen festzustellen, wobei diese aber von vornherein gering ist. Man vergleiche in diesem Zusammenhang die Anzahl der dramatis personae bei Shakespeare: Escalus, Prince of Verona – Mercutio, kinsman of the Prince and friend of Romeo – Paris, a young count, kinsman of the Prince and Mercutio, and suitor of Juliet – Page of Count Paris – Montague, head of a Veronese family at feud with the Capulets – Lady Montague – Romeo, son of Montague – Benvolio, nephew of Montague and friend of Romeo and Mercutio – Abram, servant of Montague – Balthasar, servant of Montague attending on Romeo – Capulet, head of a Veronese family at feud with Montagues – Lady Capulet – Juliet, daughter of Capulet – Tybalt, nephew of Lady Capulet – An old man of the Capulet family – Nurse of Juliet, her foster-mother – Peter, servant of Capulet attending on the Nurse – Sampson, Gregory, Anthony, Potpan, a Clown, Servingmen: of the Capulet household – Friar Laurence, a Franciscan – Friar John, a Franciscan – An Apothecary of Mantua – Three Musicians (Simon Catling, Hugh Rebeck, James Soundpost). – Members of the Watch – Citizens of Verona, maskers, torchbearers, pages, servants – Chorus.[25]
Die Väter
Die wie auch immer begründete Fehde zwischen den beiden Familien konfrontierte in der Tradition zunächst vor allem deren Oberhäupter, also die beiden Väter. Bei Ducis avancierte Romeos Vater sogar zur zentralen Figur des Stückes,[26] in FR I dagegen fällt dem Vater Julias die zentrale, da die Handlung im Wesentlichen bestimmende, Rolle zu. Das Ballett von Beretti und Marescalchi brachte noch beide Väter auf die Bühne, in den Opernlibretti von Foppa und Romani dagegen taucht der Vater von Romeo nicht mehr auf. Dies hat Konsequenzen für die Gestaltung der Figur des Romeo, der in allen drei Libretti als der einzige Vertreter der Montecchi auf der Bühne nicht nur der tragisch Liebende, sondern auch der (politische) Anführer seiner Familie ist. Diese handlungsstrategische Doppelfunktion der Figur gestattet in den beiden Versionen von Romani die Engführung der Liebes- mit der politischen Handlung, die, wie bereits erwähnt, in FR II stringenter und überzeugender erfolgt als in FR I.
Die Mutter und die Vertraute Julias
Während bei Mercier noch beide Positionen besetzt sind, fallen sie bei FR II ganz weg; Foppa und FR I dagegen arbeiten mit der einen oder der anderen Figur. In der Funktion sind sich die Vertraute und die Mutter der Julia ähnlich und auch ähnlich schwach: sie treiben die Handlung nicht voran und sind dadurch leicht austauschbar (Indiz hierfür ist auch derselbe Name für die Mutter Julias bei Mercier und für die Vertraute bei Foppa) oder gar zu eliminieren. Als wohlgesinnte Gesprächspartnerinnen Julias stellen sie strategisch eine Erweiterung der Figur der Julia dar, ohne ein wirklich ›eigenes Gesicht‹ zu bekommen. Mit ihrer Einfühlsamkeit bildet die Figur der Mutter der Julia auch einen Gegenpart zu ihrem Gatten, sie ist aber auch in diesem Zusammenhang auf eine andere, zentral handlungsbestimmende Figur, ihren Ehemann, hin ausgerichtet und erlangt kein richtiges Eigenleben.
»Te(o)baldo«
In dieser Figur fließen in den drei Opernlibretti zwei handlungsstrategisch wichtige Funktionen zusammen, die in der Tradition auf zwei Figuren aufgeteilt waren, von denen häufig eine als Bruder oder Vetter in verwandtschaftlichem Verhältnis zu Julia steht. Dieser nahe Verwandte wird in der Regel von Romeo getötet – was den Konflikt zwischen den verfeindeten Häusern neu entfacht und quasi unüberbrückbar macht.[27] Die zweite Funktion besteht darin, dass diese Figur, meist[28] aus der Gefolgschaft der Capuleti, der vom Vater Julias für seine Tochter auserkorene Bräutigam ist. Während bei Mercier diese Figur fehlt und auch mit nur einer der beiden Hauptfunktionen als Teil der Vorgeschichte die Handlung mitbedingt (Romeo hat Tebaldo getötet, daraufhin soll er ins Exil gehen, wovor ihn Benvoglio bewahrt, indem er ihn versteckt), gehen von der Figur des – nicht mit Julia verwandten – Tebaldo mit Elementen aus den beiden Funktionen in den Opernlibretti von Foppa und Romani immer wieder Impulse für den Handlungsverlauf aus. Dies trifft insbesondere für FR II zu.
Der ›Helfer‹ für Romeo und Giulietta
In der Tradition ist diese Figur entweder nur einer oder sogar beiden Familien freundschaftlich verbunden. Sofern sein Beruf genannt wird, ist der Helfer meist ein Mönch, gelegentlich auch Arzt, und trägt fast immer den Namen Lorenzo.[29] Möglicherweise bewog die Bedeutung des sprechenden Namens Benvoglio, »der das Gute will«, Mercier dazu, dem ›Gutmenschen‹ als der zentralen Figur seines moralisierenden Stückes den bei Shakespeare schon für eine Figur aus dem Lager der Montecchi verwendeten Namen zu geben. Schließlich beabsichtigt der Helfer in Merciers Version nicht nur das Gute, sondern bewirkt es am Ende sogar noch erfolgreich im lieto fine. Nicht in der Stofftradition begründet ist dagegen die Wahl des Namens »Gilberto« bei Foppa. Romani lehnt sich mit »Lorenzo« in beiden Libretti wieder stark an die Tradition an. – Durch seinen gut gemeinten, jedoch (in den meisten Versionen) verhängnisvoll verlaufenden Hilfsplan wird »Lorenzo« zum Verursacher des tragischen Endes der beiden Liebenden, in der Regel aber auch zugleich zum Begründer des Friedens zwischen den beiden Familien.
Romeo und Julia
Die beiden Liebenden, Sprösse zweier verfeindeter Familien aus Verona. In die Figur des Romeo fließt, je nachdem, ob die Rolle seines Vaters besetzt ist, auch die Funktion der politischen Führerschaft der Montecchi ein.
Strategien der Handlungsführung
in Felice Romanis »Romeo und Julia«-Libretti
In seinem Schreiben an Florimo vom 20. Januar 1830 hatte Bellini seinem Freund neben einem neuen Titel für die neue Oper auch angekündigt, dass Romani gegenüber dem Vaccai-Libretto an den Situationen ebenfalls Veränderungen vornehmen werde.[30] Im Folgenden sollen anhand dreier Beispiele Unterschiede in der Handlungsführung in FR I und FR II aufgezeigt werden.
Erstes Beispiel – das Duett von Romeo und Giulietta im ersten Akt
In beiden Libretti kommt es mit Hilfe Lorenzos im zweiten Bild des ersten Aktes jeweils zu einer heimlichen Begegnung Romeos und Giuliettas in deren gabinetto (Gemächern) (FR I: I, (6) 7–8; FR II: I, (5) 6). Während Romeo jeweils im ersten Teil des ersten Aktes bereits aufgetreten war, fällt der erste Auftritt Giuliettas bei beiden Versionen in den zweiten Teil. In FR I fällt er mit der Duettszene zusammen, während er in FR II dieser mit Rezitativ und Arie Eccomi in lieta vesta – Oh quante volte (FR II: I, 4) vorausgeht.
Der erste Auftritt Giuliettas erfüllt in FR II die Funktion, dem Publikum die weibliche Protagonistin in ihrer verzweifelten Lage vorzustellen und somit auch die folgende Duettszene vorzubereiten. Die Situation Giuliettas ist nicht nur verzweifelt, die Gefahr für sie ist auch imminent: schon ist sie als Braut gekleidet (»in lieta vesta« – »im Festkleid«), doch anstatt Freude über ihre bevorstehende Hochzeit zu empfinden, fühlt sie sich als Opfer (»vittima«), soll sie doch auf Wunsch des Vaters den ungeliebten Tebaldo heiraten, während derjenige, dem ihre Liebe gilt, als Feind ihrer Familie für sie als Bräutigam aus politischem Kalkül nicht in Frage kommt. Angesichts dieses Dilemmas lädt Giulietta in ihrem Wunschdenken die für die Trauungszeremonie bereitgestellten Gegenstände semantisch negativ auf, empfindet sie doch den ihr aufgezwungenen Weg als Braut zum Traualtar als den eines Opfers zum Opferaltar, wobei sie bei dieser imaginierten Alternative die Option ›Opfer‹ vorzieht und sich also die Hochzeitsfackeln (»nuziali tede«) als Fackeln ihres Todes (»faci ferali«) wünscht. Diese in nur wenigen Worten skizzierte Verzweiflung mündet noch im Rezitativ in den Ruf nach Romeo; in der anschließenden Arie bringt Giulietta ihre Sehnsucht nach dem (unerreichbar fern geglaubten) Geliebten zum Ausdruck.
Auch bei FR I wird das Publikum im Vorfeld des Duetts mit der verzweifelten Lage Giuliettas vertraut gemacht, doch fällt seine Konfrontation mit dem Unglück Giuliettas wesentlich sanfter aus. Dies liegt zum einen daran, dass sich Giulietta nicht selbst mitteilt, sondern der Zuschauer indirekt, zunächst aus einem Gespräch zwischen Lorenzo und Romeo (FR I: I,4) und dann aus Äußerungen der um ihre (in diesem Moment schlafende!) Tochter besorgten Mutter Adele (FR I: I,5), von Giuliettas Leid (»i suoi mali«) erfährt. Dieses erschöpft sich in diesen beiden Szenen außerdem auch in Giuliettas Sehnsucht nach Romeo und ihrem Leiden unter der Trennung – von der bevorstehenden Hochzeit aber muss sie in FR I an dieser Stelle erst noch in Kenntnis gesetzt werden, bittet doch Adele Lorenzo, die Tochter über die Entscheidung ihres Vaters aufzuklären.
In der nächsten Szene (FR I: I,6 und FR II: I,5) führt Lorenzo jeweils Romeo durch eine Geheimtür (»uscio segreto«) zu der von dem Wiedersehen völlig überraschten Giulietta. Während sie aber bei Bellini ihrem Geliebten im Brautkleid gegenüber steht, unterstreicht das Libretto für Vaccai ihre nachlässige Kleidung, hatte sie doch gerade noch geschlafen (»ella è vestita neglettamente« – »sie ist nachlässig gekleidet«). Nachdem sich die beiden Liebenden in die Arme gefallen sind, verlässt Lorenzo diskret Giuliettas Gemächer.
Das nun folgende Duett erstreckt sich in FR I über zwei Szenen, während es in FR II nur eine umfasst (FR I: I,7–8; FR II: I, 6). Die Aufteilung auf zwei Szenen bei Vaccai ist durch den Auftritt Lorenzos in der achten Szene bedingt, der die Liebenden aufsucht, um sie vor einer Gefahr zu warnen – ist doch Capellio auf dem Weg zu Giuliettas Gemach. Auch bei Bellini wird das Gespräch des Paares gestört: In der Ferne ist festliche Musik (nämlich die Hochzeitsmusik für Giuliettas Trauung) zu hören (»Odesi festiva musica da lontano«). Obwohl sich das Duett bei Bellini nur über eine Szene erstreckt, ist der Text in seiner Version allerdings erheblich länger als bei Vaccai. Dabei fällt vor allem die sehr unterschiedliche Länge der beiden Texte nach dem jeweiligen Störmoment auf.
Neben der in beiden Versionen vorhandenen Unterbrechung bzw. Störung des Dialoges weisen die beiden Duette aber auch am Anfang Parallelen auf. So mischen sich in die anfängliche übergroße Wiedersehensfreude die Erinnerungen an die leidvollen Tage der Trennung. Doch in der Folge nehmen die beiden Duette einen unterschiedlichen Verlauf. Zunächst zur Entwicklung des Gespräches bei Vaccai:
[I,7]
[…]
Romeo:
Ah! che divisi ognor / Ach! andauernd getrennt
non languirem così; / werden wir nicht mehr leiden;
a noi sereni ancor / frohe Tage sind uns bestimmt,
serban fortuna i dì. / die noch Glück für uns bereit halten.
Ma sia pur barbara / Doch wenn auch das Schicksal
con me la sorte, / grausam zu mir sein sollte,
potrà dividerci / vermag uns doch nur
la sola morte. / der Tod zu trennen.[…]
Romeo:
Il crudele l’esige invano / Der Grausame verlangt dies vergebens,
a noi scampo amor darà. / die Liebe wird uns retten.A 2: / Beide:
Ah più diletto / Ach, keine Freude
non spero in terra, / erhoffe ich mir mehr auf Erden,
eterna guerra / ewigen Krieg
ci giura amor. / verheißt uns die Liebe.
[I,8]
Lorenzo:
[…] a questa stanza […] Capellio
Volge Capellio il piè … / ist im Anmarsch…Giulietta:
Fuggi… ti salva… / Flieh… bring dich in Sicherheit…
Non esitar… / Zaudere nicht…Romeo:
Odimi in pria… / Hör mich erst noch an…
Nach der eingangs von beiden zum Ausdruck gebrachten Wiedersehensfreude und dem Rückblick auf das Leid fern vom anderen richtet Romeo seinen Blick auf die Zukunft: Ob ihre Tage von Glück (»fortuna«) geprägt sein werden oder ihnen ein grausames Schicksal (»barbara […] sorte«) bereithalten sollten, nie wieder wird das Paar sich trennen lassen, dies kann nur der Tod (»morte«) bewirken. Selbst angesichts der größten Bedrohung für das Paar, die Giuliettas Vater (»Il crudele« – »der Grausame«) verkörpert, der seine Tochter mit einem anderen vermählen möchte,[31] wissen die beiden sich von der Macht und Kraft der Liebe geschützt (»a noi scampo amor darà«). Allerdings ist das erhoffte Glück des gemeinsamen Lebens noch zu fern; sie ahnen, dass ihr Leben sich wohl zu einem ewigen Krieg (»eterna guerra«) um ihrer Liebe willen gestalten wird, so dass sie am Schluss der Szene ihrer Hoffnungslosigkeit Ausdruck verleihen (»più diletto non spero in terra«).
Obwohl die gegenwärtigen Hindernisse für die Realisierung des gemeinsamen Glückes sehr greifbar sind, richten die Liebenden ihren Blick vor allem auf ihr Leben in der Zukunft. Sie sprechen dabei in abstrakten Termini und überantworten ihr Schicksal höheren Mächten. Insofern haftet dem Dialog in I,7 etwas Träumerisches an, denn trotz der konkreten Gefahr (Giulietta soll Tebaldo ehelichen) wird kein konkreter Plan formuliert. Nach der Unterbrechung des Gespräches durch das Herannahen Capellios (I,8) allerdings sind die Liebenden gezwungen, auf der Stelle zu handeln: Giulietta fordert Romeo zur sofortigen Flucht auf, doch hebt Romeo in diesem Augenblick zu einem letzten Diskurs an: »Odimi in pria…«. Will er seiner Geliebten an dieser Stelle einen konkreten Handlungsplan unterbreiten? Diese Frage bleibt offen, schaltet sich doch Lorenzo ein zweites Mal mit der Aufforderung an Romeo zu gehen in das Gespräch ein, der dieser nun Folge leistet.
Nun zum Duett Romeo – Giulietta bei Bellini:
Romeo:
[…]
vengo,vengo a morir deciso, / ich komme, komme, entschlossen zu sterben,
o a rapirti per sempre ai tuoi nemici. / oder dich für immer deinen Widersachern zu entreißen.
Meco fuggir dêi tu. / Du musst mit mir fliehen.Giulietta:
Fuggire? Che dici? / Fliehen? Was sagst du da?
Romeo:
Sì, fuggire: a noi non resta / Ja, fliehen: in dieser äußersten Not
altro scampo in danno estremo / bleibt uns kein anderer Ausweg[…]
Giulietta:
Ah! Romeo! Per me la terra / Ach, Romeo! Für mich ist die Welt
è ristretta in queste porte: / auf diese Räume beschränkt:[…]
Qui m’annoda, qui mi serra / Hier bindet mich und schließt mich
un poter d’amor più forte. / eine stärkere Macht als die Liebe ein.
Solo, ah! solo all’alma mia / Nur, ach! nur meiner Seele
venir teco il ciel darà / wird der Himmel gestatten, mit dir zu ziehen[…]
Romeo:
Che mai sento? E qual potere / Was höre ich da? Und was für eine Macht
è maggior per te d’amore? / ist für dich stärker als die Liebe?Giulietta:
Quello, ah! quello del dovere, / Die, ach! die der Pflicht,
della legge, dell’onor, sì, sì, dell’onore. / des Gesetzes, der Ehre, ja, ja, der Ehre.[…]
(Odesi festiva musica di lontano.) / (In der Ferne ist festliche Musik zu hören)
Romeo:
Odi tu? L’altar funesto / Hörst du? Schon wird der unheilvolle Altar
Già s’infiora, già t’attende. / mit Blumen geschmückt und erwartet dich.Giulietta:
Fuggi, va. / Flieh, geh.
Romeo:
No, teco io resto. / Nein, ich bleibe bei dir.
[…]
Im Unterschied zum Duett in der Vaccai-Version präsentiert sich Romeo bei Bellini nach der gemeinsamen Wiedersehensfreude unumwunden mit der Alternative, die sich für ihn im textimmanenten Hier und Jetzt stellt. Er ist fest entschlossen, entweder zu sterben (»morire«) oder Giulietta für immer ihren (und seinen) Feinden zu entreißen (»rapirti per sempre ai tuoi nemici«), um anschließend mit ihr zu fliehen (»fuggir«). Durch dieses Ansinnen Romeos wird wiederum Giulietta vor eine Handlungsalternative gestellt, nämlich entweder Romeo Folge zu leisten oder ihrem Vater zu gehorchen. Sie fühlt sich in ihrem Inneren dem Konflikt zweier widerstreitender Mächte (»potere«) ausgesetzt, nämlich zwischen der Liebe (»amore«) und der Pflicht (»dovere«). Letztere wird weiter konkretisiert: Giulietta weiß sich in der Pflicht gegenüber dem Gesetz (»legge«) und der Ehre (»onore«).
Das Dilemma, vor dem Giulietta steht und das Romani mit den Wörtern »amore« und »dovere« sehr deutlich zitiert, ist der Konflikt schlechthin, in dem sich die Helden der klassischen französischen Tragödie des 17. Jahrhunderts befinden (amour vs. devoir) und auf dem die Handlung der jeweiligen Tragödie basiert. Die klassische französische Tragödie fand im Italien des 18. Jahrhunderts im Werk Vittorio Alfieris[32] eine Fortsetzung. Romani war mit der langen Tradition der klassischen Literatur nicht nur bestens vertraut, er hatte sich, teilweise noch vor seiner Tätigkeit als Librettist, immer wieder durch Veröffentlichungen[33] oder in literarischen Debatten als Verfechter der klassischen Ideale hervorgetan und gegen romantische Strömungen Position bezogen.[34]
Während für Romeo unbestritten die Liebe (»amore«) überwiegt, stellt für Giulietta die Pflicht (»dovere«) eine stärkere Macht als die Liebe dar (»un poter d’amor più forte«). Über dieser Frage der Gewichtung kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Liebenden, die erst durch das Erklingen der festlichen Musik in der Ferne (»festiva musica«) unterbrochen wird. Dieses lässt in Kürze das Kommen des Vaters erwarten, und so fordert Giulietta, wie schon in FR I, Romeo zur Flucht auf (»fuggi, va«). Doch im Gegensatz zu FR I, wo Romeo dieser Aufforderung ziemlich schnell nachkommt, beharrt er in der Version von Bellini auf der Klärung des Konflikts mit Giulietta, weswegen er bei ihr bleiben will (»No, teco io resto«) und wofür er sich sogar schon in diesem Moment zu sterben bereit erklärt. In dieser nach dem Störmoment durch die festliche Musik weiter ausgetragenen Diskussion liegt die unterschiedliche Länge der Duette in FR I und FR II begründet: Romeo wirft Giulietta ihre Unbeugsamkeit vor, Giulietta bittet ihn, nachzugeben – was er dann letztlich tut, bezwungen durch Giuliettas Bitten (»vinto dalle preghiere di Giulietta«).
Im Unterschied zu der Vaccai-Version befassen sich die beiden Protagonisten bei Bellini also konkret und durchaus kontrovers mit der Lösung ihres Problems. Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und überantworten es nicht abstrakten Mächten. Den Figuren haftet trotz ihrer großen Sehnsucht nach einem gemeinsamen Leben nichts in dem Maße wie bei Vaccai Träumerisches an, vielmehr scheinen sie pragmatischer und real(istisch)er und damit für den Zuschauer auch ›greifbarer‹ zu sein als bei Vaccai.
Zweites Beispiel – die Figur des Tebaldo
Sowohl bei Vaccai als auch bei Bellini ist Tebaldo der von Capellio für Giulietta auserkorene Ehemann. In beiden Versionen will Capellio mit der Hand seiner Tochter Tebaldo für seine treuen Dienste belohnen und damit zugleich dem Angebot des Unterhändlers der Montecchi (der der verkleidete Romeo selbst ist) eine Absage erteilen, in dem den Capuleti der Vorschlag unterbreitet wurde, mit der Heirat Romeos und Giuliettas den Streitigkeiten zwischen den beiden Häusern für immer ein Ende zu setzen.[35] Der Figur des Romeo, die in sich, wie oben dargelegt, zwei Funktionen vereint, nämlich die des politischen Anführers der Montecchi und die des Liebenden, sind im Lager der Capuleti zwei Gegenspieler zugeordnet: Capellio als der Anführer der politischen Gegner, und Tebaldo als der Rivale um Giulietta.
Neben diesen Parallelen in FR I und FR II weist der Tebaldo-Handlungsstrang in den beiden Versionen allerdings auch große Unterschiede auf. So ist bei Vaccai Tebaldo von Beginn der Oper an als der ›verlängerte Arm‹ des Capellio dargestellt und charakterlich an diesen angelehnt. Als Romeos Gegenspieler um die Hand Giuliettas wird er – zwischen dem ersten und zweiten Akt, also hinter den Kulissen – im Duell von Romeo getötet. Dass Romeo seinen Rivalen um Giulietta tötet, entspricht der Stofftradition. Wenn Lorenzo zu Beginn des zweiten Akts Giulietta seinen Plan erläutert, sind bereits alle über Tebaldos Tod informiert. Giuliettas Motivation, sich auf den Plan Lorenzos einzulassen, ist also nicht, der Hochzeit mit Tebaldo zu entgehen, sondern der Wut des Vaters (der sie wahrscheinlich in ein Kloster stecken würde):
Lorenzo:
E non temi / Und fürchtest du nicht
L’ira paterna? / Den Zorn deines Vaters?Giulietta:
A lui sottrarmi io spero / Ich hoffe, mich ihm zu entziehen,
Col tuo favor, e a pien mutar sorte. / Mit deiner Hilfe, und mein Schicksal völlig zu ändern.
Bei Bellini wird zwar ebenfalls die Vermählung von Tebaldo mit Giulietta von Capellio betrieben, doch zeichnet Romani in dieser Version Tebaldo von Beginn der Oper an als eine Figur, die tatsächlich zärtliche Gefühle für Giulietta hegt. Auch hier kommt es zum Duell zwischen den beiden Rivalen, das aber auf der Bühne stattfindet (II,6). Lorenzos Intrige wurde schon vor dem Duell der beiden eingeleitet (II,2), die Motivation der Giulietta lag darin begründet, dass sie sich so der Heirat mit Tebaldo entziehen wollte. Das Duell von Romeo und Tebaldo wird unterbrochen durch die Trauermusik, die den vorüber ziehenden Leichenzug der (scheintoten) Giulietta begleitet. An dieser Stelle wird in FR II nun zum zweiten Mal eine entscheidende Auseinandersetzung zwischen zwei Figuren durch die musikalische Untermalung eines wichtigen Ereignisses unterbrochen: War es im Duett Romeo – Giulietta im ersten Akt die Musik für die Hochzeit Giuliettas mit Tebaldo, ist es jetzt die Trauermusik anlässlich ihres vermeintlichen Todes.
Die beiden Gegner nehmen das Duell auch nicht wieder auf. Vielmehr entsteht aus der von beiden empfundenen Trauer eine verbale Auseinandersetzung, in der Romeo Tebaldo den Tod Giuliettas zum Vorwurf macht und dieser – plötzlich zur Einsicht in seine Mitschuld gelangt – sich daraufhin untröstlich in Selbstvorwürfen ergeht. Ihr Dialog kreist um die Frage, wessen Leid das größere sei, und gipfelt darin, dass jeder nun sterben möchte. Tebaldo, gerade noch Romeos Duellgegner, ist aber nun nicht mehr in der Lage, den untröstlichen Romeo, der ihn darum bittet, zu töten.
Obgleich es hier nicht zu einer expliziten Aussöhnung der Duellanten kommt, liegt doch eine Deutung der Szene in diese Richtung nahe. In der Tradition endet die Geschichte von Romeo und Julia in der Regel mit der Versöhnung der beiden verfeindeten Familien über dem Grab ihrer Kinder. Diese geschieht bei Romani in keiner der beiden Versionen.[36] Doch während in FR I das Ende so unversöhnlich ist wie schon der ganze Handlungsverlauf von Anfang an, kündigte sich in der Figur des liebenden Tebaldo bei FR II auf der Seite der Capuleti seit Beginn die Möglichkeit eines Einlenkens an. Trotzdem ihr Schmerz auch unterschiedliche Aspekte aufweist, eint Romeo und Tebaldo doch die Trauer um die tot geglaubte Giulietta, die ihnen eine Fortsetzung des Streites, hier des Duells, nicht möglich macht.
Drittes Beispiel – die Schlussszene
Die Tradition des »Romeo und Julia«-Stoffes kennt zwei Grundvarianten für die Schlussszene. In der einen Variante, die etwa bei Shakespeare zu finden ist, nimmt Romeo in der Gruft an der Seite der vermeintlich toten Julia das tödliche Gift zu sich und stirbt daran. Als Julia erwacht, fällt ihr Blick auf den toten Romeo und sie ersticht sich mit Romeos Dolch. In der anderen Variante, wie sie beispielsweise die italienische Novellistik bevorzugt, erwacht Julia, noch bevor Romeo stirbt. Es kommt zu einem dramatischen Dialog zwischen den beiden Liebenden, dann stirbt Romeo an den Folgen des Giftes, kurz darauf stirbt Julia.[37]
Für das Musiktheater ist die zweite die reizvollere Variante, bietet sie doch die Gelegenheit, nach einer Arie des Romeo, in der er beim Anblick der vermeintlich toten Giulietta seine Trauer und Verzweiflung zum Ausdruck bringt und das Gift nimmt, die Protagonisten nach Giuliettas Erwachen in einer hochdramatischen Situation ein letztes Liebesduett im Angesicht des nahen Todes singen zu lassen. Nach Foppa und Zingarelli optiert auch Romani bei beiden Versionen seines Stoffes für diese Schlussvariante – und doch unterscheiden sich seine beiden Libretti auch in der Schlussszene wesentlich. Denn während in FR I nach dem Duett Giulietta noch ein letzter musikalischer Höhepunkt, nämlich eine Arie, gegönnt ist, die sie in Anwesenheit von Lorenzo und der inzwischen unter der Führung Capellios in die Gruft geeilten Capuleti singt und in der sie bittere Vorwürfe an ihren Vater richtet und ihren Wunsch zu sterben äußert, folgt in FR II der Tod Giuliettas unmittelbar auf den Romeos:
Romeo:
Addio… ah! Giulie… / Lebewohl…. ah! Giulie…
Giulietta:
Ei muore… oh, Dio! / Er stirbt… oh, Gott!
(Cade sul corpo di Romeo) / (Sie bricht über dem toten Romeo zusammen)«
Dann erst stürmen Lorenzo, Capellio und in ihrem Gefolge die Capuleti in die Gruft. Sie können nur mehr den Tod beider feststellen (Lorenzo: »Morti ambedue« – »sie sind beide tot«, FR II: II,11). Im Unterschied zu FR I findet also die Vereinigung Romeos und Giuliettas im Tod in FR II ihre Entsprechung auch auf der musikalischen und der Handlungsebene, ist ihr letzter musikalischer Auftritt doch ein gemeinsamer, an dessen Ende sie gleichzeitig aus dem Leben und als aktive Figuren von der Bühne scheiden.
Für die Schlussszenen der beiden Libretti ergibt sich also folgendes Schema der musikalischen Nummern:[38]
FR I:
- Arie (Romeo)
- Duett (Romeo und Giulietta)
- Arie (Giuletta)
FR II:
- Arie (Romeo)
- Duett (Romeo und Giuletta)
Diese unterschiedliche Disposition des Opernschlusses veranlasste die Mezzosopranistin Maria Malibran, 1832 bei der Aufführung der Bellini-Oper am Teatro Comunale di Bologna, in der sie die Rolle des Romeo sang,[39] zu der Anregung, das Finale von FR II durch das Vaccai-Finale zu ersetzen, was dann auch so geschah.[40] Dieses Beispiel machte Schule: Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde Bellini immer wieder mit dem Vaccai-Schluss aufgeführt, übrigens sehr zum Verdruss des Nobelpreisträgers für Literatur, Eugenio Montale, der 1966 in seinen Besprechungen der Erstaufführungen an der Mailänder Scala bemerkt:
I Capuleti e i Montecchi, settima fra le undici opere di Vincenzo Bellini, apparvero più volte alla Scala dopo il successo ottenuto a Venezia nel 1830. In ognuna di queste rappresentazioni (1834, 1837, 1844, 1849 e 1861) l’opera continuava a portare un finale che non apparteneva al Bellini ma al maestro marchigiano Nicola Vaccai, autore di una precedente Giulietta e Romeo già apparsa alla Scala nel ’26. E lo stesso libretto del Romani non era che il rimaneggiamento del testo composto dallo stesso Romani per il Vaccai. Figuratevi che cosa accadrebbe oggi se un’opera di Pizzetti portasse il finale di un’opera scritta da un altro e rappresentata appena quattro anni prima nel medesimo teatro![41]
I Capuleti e i Montecchi, die siebte der insgesamt elf Opern von Vincenzo Bellini, ist nach der erfolgreichen Erstaufführung von 1830 in Venedig mehrmals auch an der Scala gespielt worden. Bei jeder dieser Aufführungen (1834, 1837, 1844, 1849 und 1861) endete die Oper immer mit einem Finale, das nicht aus der Feder Bellinis stammt, sondern dem aus den Marken stammenden Maestro Nicola Vaccai zuzuschreiben ist, der zuvor eine Oper mit dem Titel Giulietta e Romeo komponiert hatte, die bereits 1826 an der Scala uraufgeführt worden war. Und sogar das Libretto Romanis war lediglich eine Umarbeitung des Textes, den ebenderselbe Romani schon für Vaccai geschrieben hatte. Stellen Sie sich vor, was heute passieren würde, wenn in einer Oper von Pizzetti das Finale einer Oper aus der Feder von jemand anderem zu sehen wäre, die gerade erst einmal vier Jahre vorher in demselben Theater aufgeführt worden ist!
V. Ausblick auf das französische Repertoire
Hector Berlioz
In dieser Hinsicht war Hector Berlioz mehr Glück beschieden, der sich 1831 in Florenz, wo er sich unter anderem in den wundervollen Gärten am linken Arnoufer (»dans les bois délicieux qui bordent la rive gauche de l’Arno«) schon tagelang mit Shakespearelektüren vergnügt hatte, mit großer Vorfreude ins Theater begab und auch tatsächlich Bellinis Werk in seiner ganzen Länge zu sehen bekam:
Sachant bien que je ne trouverais pas dans la capitale de la Toscane ce que Naples et Milan me faisaient tout au plus espérer, je ne songeais guère à la musique, quand les conversations de table d’hôte m’apprirent que le nouvel opéra de Bellini (I Montecchi ed i Capuleti (sic!)) allait être représenté. On disait beaucoup de bien de la musique, mais aussi beaucoup du libretto, ce qui, eu [sic!] égard au peu de cas que les Italiens font pour l’ordinaire des paroles d’un opéra, me surprenait étrangement. Ah ! ah ! c’est une innovation !!! je vais donc, après tant de misérables essais lyriques sur ce beau drame, entendre un véritable opéra de Roméo, digne du génie de Shakespeare ! Quel sujet ! Comme tout y est dessiné pour la musique !… D’abord le bal éblouissant dans la maison de Capulet, où, au milieu d’un essaim tourbillonnant de beautés, le jeune Montaigu aperçoit pour la première fois la sweet Juliet, dont la fidélité doit lui coûter la vie ; puis ces combats furieux, dans les rues de Vérone, auxquels le bouillant Tybalt semble présider comme le génie de la colère et de la vengeance ; cette inexprimable scène de nuit au balcon de Juliette, où les deux amants murmurent un concert d’amour tendre, doux et pur comme les rayons de l’astre des nuits qui les regarde en souriant amicalement, les piquantes bouffonneries de l’insouciant Mercutio, le naïf caquet de la vieille nourrice, le grave caractère de l’ermite, cherchant inutilement à ramener un peu de calme sur ces flots d’amour et de haine dont le choc tumultueux retentit jusque dans sa modeste cellule… puis l’affreuse catastrophe, l’ivresse du bonheur aux prises avec celle du désespoir, de voluptueux soupirs changés en râle de mort, et enfin le serment solennel des deux familles ennemies jurant, trop tard, sur le cadavre de leurs malheureux enfants, d’éteindre la haine qui fit verser tant de sang et de larmes. Je courus au théâtre de la Pergola. Les choristes nombreux qui couvraient la scène me parurent assez bons, leurs voix sonores et mordantes ; il y avait surtout une douzaine de petits garçons de quatorze à quinze ans, dont les contralti étaient d’un excellent effet. Les personnages se présentèrent successivement et chantèrent tous faux, à l’exception de deux femmes, dont l’une, grande et forte, remplissait le rôle de Juliette, et l’autre, petite et grêle, celui de Roméo. — Pour la troisième ou quatrième fois après Zingarelli et Vaccaï, écrire encore Roméo pour une femme !… Mais, au nom de Dieu, est-il donc décidé que l’amant de Juliette doit paraître dépourvu des attributs de la virilité ? Est-il un enfant, celui qui, en trois passes, perce le cœur du furieux Tybalt, le héros de l’escrime, et qui, plus tard, après avoir brisé les portes du tombeau de sa maîtresse, d’un bras dédaigneux, étend mort sur les degrés du monument le comte Pâris qui l’a provoqué ? Et son désespoir au moment de l’exil, sa sombre et terrible résignation en apprenant la mort de Juliette, son délire convulsif après avoir bu le poison, toutes ces passions volcaniques germent-elles d’ordinaire dans l’âme d’un eunuque ?
Trouverait-on que l’effet musical de deux voix féminines est le meilleur ?… Alors, à quoi bon des ténors, des basses, des barytons ? Faites donc jouer tous les rôles par des soprani ou des contralti, Moïse et Othello ne seront pas beaucoup plus étranges avec une voix flûtée que ne l’est Roméo. Mais il faut en prendre son parti ; la composition de l’ouvrage va me dédommager…
Quel désappointement !!! dans le libretto il n’y a point de bal chez Capulet, point de Mercutio, point de nourrice babillarde, point d’ermite grave et calme, point de scène au balcon, point de sublime monologue pour Juliette recevant la fiole de l’ermite, point de duo dans la cellule entre Roméo banni et l’ermite désolé ; point de Shakespeare, rien ; un ouvrage manqué. Et c’est un grand poëte, pourtant, c’est Félix [sic!] Romani, que les habitudes mesquines des théâtres lyriques d’Italie ont contraint à découper un si pauvre libretto dans le chef-d’œuvre shakespearien !
Le musicien, toutefois, a su rendre fort belle une des principales situations ; à la fin d’un acte, les deux amants, séparés de force par leurs parents furieux, s’échappent un instant des bras qui les retenaient et s’écrient en s’embrassant : « Nous nous reverrons aux cieux. » Bellini a mis, sur les paroles qui expriment cette idée, une phrase d’un mouvement vif, passionné, pleine d’élan et chantée à l’unisson par les deux personnages. Ces deux voix, vibrant ensemble comme une seule, symbole d’une union parfaite, donnent à la mélodie une force d’impulsion extraordinaire ; et, soit par l’encadrement de la phrase mélodique et la manière dont elle est ramenée, soit par l’étrangeté bien motivée de cet unisson auquel on est loin de s’attendre, soit enfin par la mélodie elle-même, j’avoue que j’ai été remué à l’improviste et que j’ai applaudi avec transport.[42]
Mir war sehr wohl klar, dass ich in der Hauptstadt der Toscana nicht das finden würde, worauf ich in Neapel und Mailand in höchstem Maße hoffen konnte, so hatte ich die Musik gar nicht im Sinne, als ich aus den Unterhaltungen am Esstisch erfuhr, dass die neue Oper von Bellini (I Montecchi ed i Capuleti [sic]) aufgeführt werden sollte. Man äußerte sich sehr lobend zur Musik, aber auch zum Libretto, was mich doch sehr überraschte, machen doch die Italiener gewöhnlich um die Worte einer Oper kaum Aufhebens. Ah! ah! das ist also etwas ganz Neues! ich werde also, nach so vielen erbärmlichen dichterischen Versuchen an diesem schönen Theaterstück, eine richtige Romeo-Oper zu hören bekommen, die dem Genie Shakespeares würdig ist! Was für ein Sujet! Und wie hier auch alles schon für die Musik vorgezeichnet ist!… Zunächst der rauschende Ball im Hause der Capulet, wo, inmitten einer wirbelnder Schar von Schönheiten, der junge Montaigu zum ersten Mal die sweet Juliet erblickt, zu der ihn seine Treue sein Leben kosten soll; dann die wilden Kämpfe in den Straßen von Verona, die der aufbrausende Tybalt wie der Geist der Wut und der Rache anzuführen scheint, diese unaussprechliche Nachtszene am Balkon von Juliette, in der die beiden Liebenden ein Konzert der zärtlichen Liebe murmeln, die so süß und rein ist wie die Strahlen des Nachtgestirns, das freundlich lächelnd auf sie herabblickt; die stichelnden Späße des unbekümmerten Mercutio, das naive Geschwätz der alten Amme, der schwermütige Charakter des Eremiten, der vergeblich versucht, ein bisschen Ruhe in die Wogen der Liebe und des Hasses zurückzubringen, deren lärmender Aufschlag bis in seine bescheidene Zelle dringt… schließlich die entsetzliche Katastrophe, der Rausch des Glückes im Widerstreit mit dem der Verzweiflung, die Seufzer der Lust, die zum Todesröcheln werden, und dann das feierliche Versprechen der beiden verfeindeten Familien, die, zu spät, über den Leichnamen ihrer unglücklichen Kinder, dem Hass abschwören, der sie so viel Blut und Tränen vergießen ließ. Ich eilte zum Pergola-Theater. Zahlreiche Chorsänger bevölkerten die Bühne, sie schienen mir ziemlich gut zu sein mit ihren sonoren und beissenden Stimmen; da gab es vor allem etwa ein Duzend kleiner Jungen von vierzehn, fünfzehn Jahren, deren contralti hervorragend wirkten. Nach und nach traten die Figuren auf die Bühne, sie sangen alle falsch, außer zwei Frauen, von denen die eine, sie war groß und kräftig, die Rolle der Juliette bekleidete, und die andere, klein und zierlich, Romeo darstellte. – Zum dritten oder vierten Mal nach Zingarelli und Vaccai wird da noch einmal ein Romeo für eine Frau geschrieben!… Aber, um Himmels Willen, ist das jetzt also ein für alle mal so festgesetzt, dass der Geliebte Juliettes bar der Attribute der Männlichkeit in Erscheinung zu treten hat? Ist ein Knabe dazu in der Lage, in drei Zügen das Herz des rasenden Tybalt, dieses Meisters der Fechtkunst, zu durchbohren, und später, nachdem er den Zugang zur Gruft seiner Geliebten aufgebrochen hat, den Grafen Paris, der ihn provoziert hatte, auf den Stufen des Grabmales mit verächtlicher Geste zur Strecke zu bringen? Und seine Verzweiflung im Augenblick des Exils, seine dumpfe und schreckliche Resignation bei der Nachricht von Juliettes Tod, sein Wahn und seine Todeskrämpfe, nachdem er das Gift getrunken hat, all diese vulkanischen Leidenschaften – keimen die gewöhnlich in der Seele eines Eunuchen?
Sollte man etwa befinden, dass die musikalische Wirkung von zwei Frauenstimmen besser ist?… Wozu sind denn dann Tenöre, Bässe, Baritone überhaupt nutze? Dann sollen doch gleich Soprane und contralti alle Rollen übernehmen, Moses und Othello werden mit einer Flötenstimme auch nicht sehr viel befremdlicher sein als Romeo. Aber damit hat man sich wohl abzufinden, die Komposition des Stückes wird mich schon entschädigen…
Was für eine Enttäuschung!!! in dem Libretto kommt kein Ball bei den Capulet vor, kein Mercutio, keine schwatzhafte Amme, kein schwermütiger Eremit, keine Balkonszene, kein sublimer Monolog für Juliette, wenn sie das Fläschchen aus der Hand des Eremiten entgegennimmt, kein Duett in der Zelle zwischen dem verbannten Romeo und dem untröstlichen Eremiten; kein Shakespeare, gar nichts; ein missglücktes Werk. Und dabei ist das doch ein großer Dichter, dieser Felix [sic] Romani, den die armseligen Gewohnheiten der Operntheater in Italien dazu gezwungen haben, ein so klägliches Libretto aus dem Meisterwerk Shakespeares herauszuschneiden!
Doch eine der Hauptsituationen ist dem Musiker doch sehr gut gelungen; am Ende des einen Aktes, wenn die beiden Liebenden gewaltsam von ihren wütenden Eltern getrennt werden und sich für einen Augenblick den Armen entreißen können, die sie eben noch zurückhielten und nun, sich umarmend, ausrufen: »Im Himmel werden wir uns wieder sehen«, hat Bellini die Worte, die diese Idee ausdrücken, mit einer lebhaften, leidenschaftlichen Phrase untermalt, die voller Schwung ist und von den beiden Figuren im Unisono gesungen wird. Diese beiden Stimmen, die zusammen wie eine einzige vibrieren, sind als Symbol einer perfekten Vereinigung anzusehen und verleihen der Melodie eine außergewöhnliche Antriebskraft; und, sei es aufgrund der Einbettung der melodischen Phrase und der Art ihrer Herbeiführung, sei es aufgrund des sehr wohl begründeten seltsamen Eindruckes dieses Unisono, das nicht im Entferntesten zu erwarten war, oder vielleicht auch aufgrund der Melodie selbst, muss ich jedenfalls zugeben, dass ich auf einmal gerührt war und begeistert Beifall klatschte.[43]
Die Erwartungen Berlioz’, mit der Komposition von Bellini eine ›Shakespeare-Oper‹ genießen zu können, hatten sich also nicht erfüllt, war doch die Handlung des Romani-Librettos gegenüber dem überquellenden englischen Drama auf die wesentlichen Handlungsabläufe reduziert.[44] Als Berlioz dann 1839 in seiner Symphonie dramatique Roméo et Juliette den Stoff selbst neu vertonte, trug er dieser Enttäuschung beim Theaterbesuch in Florenz Rechnung und reicherte nicht nur sein Stück wieder mit den aus Shakespeare bekannten poetischen Momenten, lyrischen Akzenten und (realen wie phantastischen) (Neben-)Figuren an[45] (z. B. Ball- und Balkonszene, Mercutio, die Königin Mab, Versöhnung der verfeindeten Familien etc.), sondern bringt im Text selbst auch seine große Bewunderung für Shakespeare explizit zum Ausdruck:
Premier amour, n’êtes-vous pas
Plus haut que toute poésie?
Ou ne seriez-vous point, dans notre exil mortel,
Cette poésie elle-même,
Dont Shakespeare lui seul eut le secret suprême
Et qu’il remporta dans le ciel?
Erste Liebe, bist du nicht
Höher als alle Poesie?
Oder bist du vielleicht, hier in unserem irdischen Dasein,
Jene Poesie selbst,
Deren höchstes Geheimnis Shakespeare allein kannte
Und das er mit sich in den Himmel nahm?
Charles Gounod
Begeistert von Berlioz’ Komposition, die er in jungen Jahren am Conservatoire de Paris zu hören bekam, ließ sich Charles Gounod zu seiner Oper Roméo et Juliette (Uraufführung 1867, Théâtre Lyrique, Paris) anregen, wobei auch er und seine Textdichter Jules Barbier und Michel Carré sich in die stoffgeschichtliche Tradition nach Shakespeare stellen, diese weiterentwickeln (z. B. im Duett Roméo und Juliette (IV, erstes Bild), wo die beiden Lieben nicht wissen, ob schon die Lerche, die Künderin des Tages (»messagère du jour«), singt und sie sich also trennen müssen, oder ob noch die Nachtigall, die Vertraute der Liebe (»confidant de l’amour«) zu hören sei) und der gegenüber sie beispielsweise mit der Figur der Pagen Stéphano, neue Akzente setzen.
Nachweise und Anmerkungen
[1] Albert Gier, Das Libretto – Theorie und Geschichte, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel 2000, S. 215.
[2] So die Witwe Felice Romanis, Emilia Branca, in der von ihr verfassten Biographie ihres Mannes (Emilia Branca, Felice Romani ed i più riputati maestri di musica del suo tempo. Cenni biografici ed aneddotici, Torino: Loescher 1882, S. 116), zitiert in: Valeria Gaffuri, Felice Romani librettista per Bellini, in: Il magnifico parassita, hrsg. von Ilaria Bonomi und Edoardo Buroni, Milano: Franco Angeli 2010, S. 76, und in: Alessandro Roccatagliati, Felice Romani Librettista, Lucca: Libreria Musicale Italiana 1996, S. 23, Anm. 11.
[3] Vincenzo Bellini an Florimo, September 1828, zitiert in: Gaffuri, S. 76. – Über Felice Romani als den idealen Librettisten für Vincenzo Bellini siehe auch: Vincenzo Bellini, Norma. Melodramma in due atti di Felice Romani, hrsg. von Carlo Parmentola, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1974, S. 51f.
[4] Vincenzo Bellini an Felice Romani, 7. Oktober 1834, zitiert in: Roccatagliati, S. 384: »Forse scriverò un’opera per Napoli, forse sarà per Milano, forse anche per Parigi, eccoti tutte le offerte che mi sono state fatte in questo momento: io mi riserberò di accettare le più utili per l’interesse e per la gloria di noi due. Ora che sono ritornato con te, o mio gran Romani, mio egregio collaboratore e protettore, mi sento riposato e contento. […] Scrivimi subito e dimmi dove sei, se a Milano o a Torino, che presto ci rivedremo. Non vedo l’ora di abbracciarti.« (»Vielleicht schreibe ich eine Oper für Neapel, vielleicht wird es für Mailand sein, vielleicht auch für Paris, hier hast du alle Angebote, die man mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemacht hat: Ich werde mir vorbehalten, diejenigen anzunehmen, die für unser beider Interesse und Ruhm am nützlichsten sind. Jetzt wo ich mich wieder mit Dir zusammen getan habe, oh Du mein großer Romani, mein vortrefflicher Mitarbeiter und Förderer, fühle ich mich erholt und zufrieden. […] Schreib mir sofort und sag mir, wo du bist, ob in Mailand oder Turin, so werden wir uns bald wiedersehen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu umarmen.«
[5] Der Vollständigkeit halber sei hier auch die Oper Bianca e Fernando (erste Aufführung am 7. April 1828 anlässlich der Einweihung des Teatro Carlo Felice, Genua) genannt, doch handelt es sich hierbei nicht um eine Neuschöpfung Romanis, sondern vielmehr um eine Überarbeitung des von Domenico Gilardoni verfassten Librettos, das Bellini unter dem Titel Bianca e Gernando vertont hatte und das 1826 am S. Carlo in Neapel uraufgeführt worden war. Der Name des männlichen Helden bei Gilardoni sollte ursprünglich ebenfalls Fernando lauten, er wurde aber modifiziert, um sich nicht dem Verdacht der Anspielung auf den König beider Sizilien, Ferdinando di Borbone, auszusetzen (vgl. hierzu: Friedrich Lippmann, Romani e Bellini. I fatti e i principi della collaborazione, in: Felice Romani – Melodrammi, Poesie, Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 86ff., und Gaffuri, S. 75).
[6] Ursprünglich war Giovanni Pacini mit der Komposition einer Oper für diesen Termin beauftragt worden. Da er jedoch parallel dazu an drei weiteren Opern arbeitete (Auftragsarbeiten für die Theater San Carlo di Napoli, Scala di Milano und Regio di Torino), wendete sich der Impresario der Fenice, Alessandro Lanari, besorgt um die rechtzeitige Fertigstellung des Auftrags für sein Opernhaus, an Bellini, der sich gerade in Venedig aufhielt. Bellini nahm den Auftrag an. Vgl. hierzu: Fabio Vittorini, Shakespeare e il melodramma romantico, Firenze: La Nuova Italia 2000, S. 351.
[7] Bellini an Florimo, 20. Januar 1830, zitiert in: Gaffuri, S. 77.
[8] Einen Überblick über die Geschichte des Stoffes von Romeo und Julia in der europäischen Literatur bis hin zu Gottfried Keller bietet Elisabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart: Kröner 8/1992, S. 689–692.
[9] Die erste Übersetzung stammt von Antonio Bonucci, Florenz, 1778, die zweite von Francesco Balbi, Venedig, 1804. Von diesem Stück ließ sich der aus Brescia stammende Luigi Scevola zu seiner Tragödie Giulietta e Romeo inspirieren. Zu diesen und weiteren »Romeo und Julia«-Stücken auf italienischen Bühnen im Vorfeld der Libretti von Romani siehe Vittorini, S. 325ff.
[10] Die erste Übersetzung aus der Feder eines Unbekannten stammt aus dem Jahre 1789 und wurde in Venedig angefertigt, die zweite wird dem Venezianer Giuseppe Ramirez zugeschrieben (1797) und sollte Anfang des 19. Jahrhunderts Cesare Della Valle zu einer Neufassung anregen, vgl. Vittorini, S. 327f.
[11] Zu den dramatis personae bei Shakespeare im Vergleich zu der Anzahl der Figuren in Nachfolgestücken siehe die folgenden Kommentare zur Synopse.
[12] Die Figur des Montaigu reichert Ducis zudem mit Motiven aus dem Inferno von Dantes Divina Commedia an, vgl. Vittorini, S. 326.
[13] Vgl. ebd., S. 326f.
[14] William Shakespeare, Romeo and Juliet – Romeo und Julia, übers. und hrsg. von Herbert Geisen, Stuttgart: Reclam 1979, bibliographisch ergänzte Ausgabe 2009, S. 8 und S. 207.
[15] Vgl. Vittorini, S. 329f.
[16] Vgl. ebd., S. 330ff. – Die Betrachtung der Balletttradition würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen.
[17] Vgl. Vittorini, S. 332ff.
[18] Vittorini folgend gehen auch wir von einem gegenüber Ducis etwas stärkeren Einfluss Merciers auf die hier besprochenen »Romeo und Julia«-Libretti aus, obwohl weder Foppa noch Romani ihn unter ihren Quellen anführen (für Foppa: Vittorini, S. 333; für Romani: ebd., S. 341ff.). Da Mercier unter anderem, wie dargestellt, auf Ducis als Vorlage zurückgreift, wird in der Synopse der Übersichtlichkeit halber die Tradition des französischen Sprechtheaters auf Mercier beschränkt.
[19] Vgl. Vittorini, S. 328.
[20] Dante Alighieri, La Divina Commedia, Vol. II: Purgatorio, hrsg. von Natalino Sapegno, Firenze: La Nuova Italia 1984, S. 67f.
[21] Wie bereits erwähnt, ist der »Romeo und Julia«-Stoff erstmals in der italienischen Novellistik des 15. Jahrhunderts, also nach Dante, dokumentiert, und zwar im Novellino des Masuccio (1476), der die Geschichte in Siena ansiedelt: vgl. Frenzel, S. 689.
[22] Ab Luigi da Porto: Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti (1524), vgl. Frenzel, S. 689.
[23] Dieser Umstand hat die Dante-Kritik seit jeher zu unterschiedlichen Mutmaßungen angeregt, siehe hierzu den entsprechenden Kommentar von Natalino Sapegno, in Dante Alighieri, S. 67f.
[24] Siehe unten.
[25] Shakespeare, S. 4/6
[26] Siehe oben.
[27] Dieser Tradition folgend, geht der Handlung von FR I und FR II jeweils die Tötung des Bruders Giuliettas durch Romeo voraus, was textimmanent die Unnachgiebigkeit des Vaters Giuliettas im Konflikt mit den Montecchi erklärt.
[28] Aber nicht immer: So ist etwa die Figur mit dieser Funktion bei Shakespeare, der Graf Paris, als Verwandter des Prinzen und Mercutios nicht den Capuleti zuzuordnen.
[29] Bei Shakespeare fließen in die Figur des Friar Laurence beide ›berufliche‹ Aspekte ein: Bei seinem ersten Auftritt (II,3) sortiert er »baleful weeds and precious-juiced flowers« (II,3, Vers 4), eine Tätigkeit, die ihn in philosophische Gedankengänge abschweifen und auch über die »medicine power« (II,3, Vers 20) der Pflanzen sinnieren lässt. Shakespeare bewegt sich damit nahe an der Realität des Mittelalters, verfügten die Klöster und Abteien doch in der Regel auch über einen Garten mit medizinischen bzw. Heilpflanzen. Vgl. hierzu: Matteo Vercelloni und Virgilio Vercelloni, L’invenzione del giardino occidentale, Milano: Editoriale Jaca Book 2009, S. 32–34.
[30] Siehe oben.
[31] An dieser Stelle ist insofern eine logische Inkohärenz des Librettos festzustellen, als noch aus I,5 hervorgeht, dass Giulietta nichts von den Plänen ihres Vaters weiß, während sie in dieser Szene darüber bereits informiert ist.
[32] Spuren des verehrten Dichters von Tragödien im klassischen Stil, Vittorio Alfieri, bei Felice Romani stellt auch Stefano Verdino fest, wenn er beispielsweise in Zusammenhang mit der Schlussarie Giuliettas, die an den Vater gerichtet ist, ihre verzweifelte Wut als eine »rabbia alfieriana«, einer Wut à la Alfieri, bezeichnet (Stefano Verdino, Come lavorava Felice Romani. Dalle fonti contemporanee ai melodrammi seri, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 162).
[33] Zu nennen wären in diesem Zusammenhang etwa seine Beiträge ab 1818/19 zum Dizionario d’ogni mitologia e antichità, dessen Fertigstellung bis 1827 er dann zusammen mit Antonio Peracchi übernahm: vgl. Roccatagliati, S. 25f.
[34] Siehe etwa seine Polemik gegen die Lombardi alla prima Crociata von Tommaso Grossi (1826) oder seine vernichtende Kritik an den Promessi sposi von Alessandro Manzoni in der Zeitschrift La vespa (1827), vgl. Roccatagliati, S. 30 und S. 44ff.
[35] Die Verflechtung des politischen Handlungsstranges mit dem der Liebe ist in den ersten Szenen von FR I und FR II unterschiedlich stringent. Während beispielsweise in FR I die Absicht Capellios, Giulietta mit Tebaldo zu vermählen, erst später mit der festen und ewigen Freundschaft (»costante ed eterna amistà«, FR I: I,1) Tebaldos begründet wird, stellt Felice Romani diesen Zusammenhang in seinem Libretto für Bellini von vornherein her.
[36] Da mit Romeo am Schluss der Oper in beiden Versionen Romanis auch der einzige handlungsrelevante Vertreter der Montecchi (neben ihm gibt es nur noch den Chor der Gefolgschaft der Montecchi) im Stück stirbt, ist die Versöhnung der beiden Häuser auf der Bühne auch gar nicht möglich.
[37] Ob Julia sich selbst tötet oder vom Schmerz angesichts des toten Romeo dahingerafft wird, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, die Tradition kennt beide Möglichkeiten. Vgl. hierzu Vittorini, Shakespeare e il melodramma romantico, S. 317ff.
[38] Vgl. Vittorini, S. 357.
[39] Giulietta wurde von Sofia Schoberlechner interpretiert.
[40] Vgl. Vittorini, S. 359f.
[41] Eugenio Montale, Prime alla Scala, in: Il secondo mestiere. Arte, musica, società, hrsg. von Giorgio Zampa, Milano: Mondadori 1996, S. 881.
[42] Hector Berlioz, Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm,Kap. XXXV.
[43] Die hier von Berlioz besprochene Szene befindet sich am Ende des ersten Aktes.
[44] Vgl. Lippmann, S. 91: « Qui, in Romani, Romeo e Giulietta parlano solo della fuga, se non della morte. Non vi è alcun corrispondente della “scena del balcone”. » – »Hier, bei Romani, sprechen Romeo und Giulietta nur von der Flucht, wenn nicht gar vom Tod. Es gibt keine Ensprechung für die ›Balkonszene‹.«
[45] Berlioz hält in seinen Mémoires fest, dass er zunächst selbst eine Prosafassung für seine Symphonie dramatique verfasste, die dann der Dichter Emile Deschamps in Verse setzte (Hector Berlioz, Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm, Kapitel XLIX).
Bibliographie
Bellini, Vincenzo: Norma. Melodramma in due atti di Felice Romani, hrsg. von Carlo Parmentola, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1974.
Berlioz, Hector: Mémoires: http://www.hberlioz.com/Writings/HBMindex.htm.
Dante Alighieri: La Divina Commedia, Vol. II: Purgatorio, hrsg. von Natalino Sapegno, Firenze: La Nuova Italia 1984.
Frenzel, Elisabeth: Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart: Kröner 8/1992.
Gaffuri, Valeria: Felice Romani librettista per Bellini, in: Il magnifico parassita, hrsg. von Ilaria Bonomi und Edoardo Buroni, Milano: FrancoAngeli 2010, S. 75–114.
Gier, Albert: Das Libretto – Theorie und Geschichte, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel 2000.
Lippmann, Friedrich: Romani e Bellini. I fatti e i principi della collaborazione, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 83–114.
Montale, Eugenio: Prime alla Scala, in: Il secondo mestiere. Arte, musica, società, hrsg. von Giorgio Zampa, Milano: Mondadori 1996, S. 881–884.
Roccatagliati, Alessandro: Felice Romani Librettista, Lucca: Libreria Musicale Italiana 1996.
Shakespeare, William: Romeo and Juliet – Romeo und Julia, übers. und hrsg. von Herbert Geisen, Stuttgart: Reclam 1979, bibliographisch ergänzte Ausgabe 2009.
Vercelloni, Matteo, und Virgilio Vercelloni: L’invenzione del giardino occidentale, Milano: Editoriale Jaca Book 2009, deutsche Ausgabe: Geschichte der Gartenkultur, Darmstadt: Philipp von Zabern 2010.
Verdino, Stefano: Come lavorava Felice Romani. Dalle fonti tragiche contemporanee ai melodrammi seri, in: Felice Romani – Melodrammi Poesie Documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Firenze: Olschki 1996, S. 145–181.
Vottironi, Fabio: Shakespeare e il melodramma romantico, Firenze: La Nuova Italia 2000.
Diskographie
Bellini, Vincenzo: I Capuleti e i Montecchi, Emi 1985 (Riccardo Muti – Royal Opera House, Covent Garden)
Bellini, Vincenzo: I Capuleti e i Montecchi, Deutsche Grammophon 2009 (Fabio Luisi – Wiener Symphoniker)
Berlioz, Hector: Roméo et Juliette, Deutsche Grammophon 1980 (Daniel Barenboim – Orchestre de Paris)
Gounod, Charles: Roméo et Juliette, RCA Victor Red Seal 1995 (Leonard Slatkin – Münchner Rundfunkorchester)
Vaccai, Nicola: Giulietta e Romeo, Bongiovanni 1996 (Tiziano Severini – Orchestra Filarmonica Marchigiana/Teatro G. B. Pergolesi di Jesi)